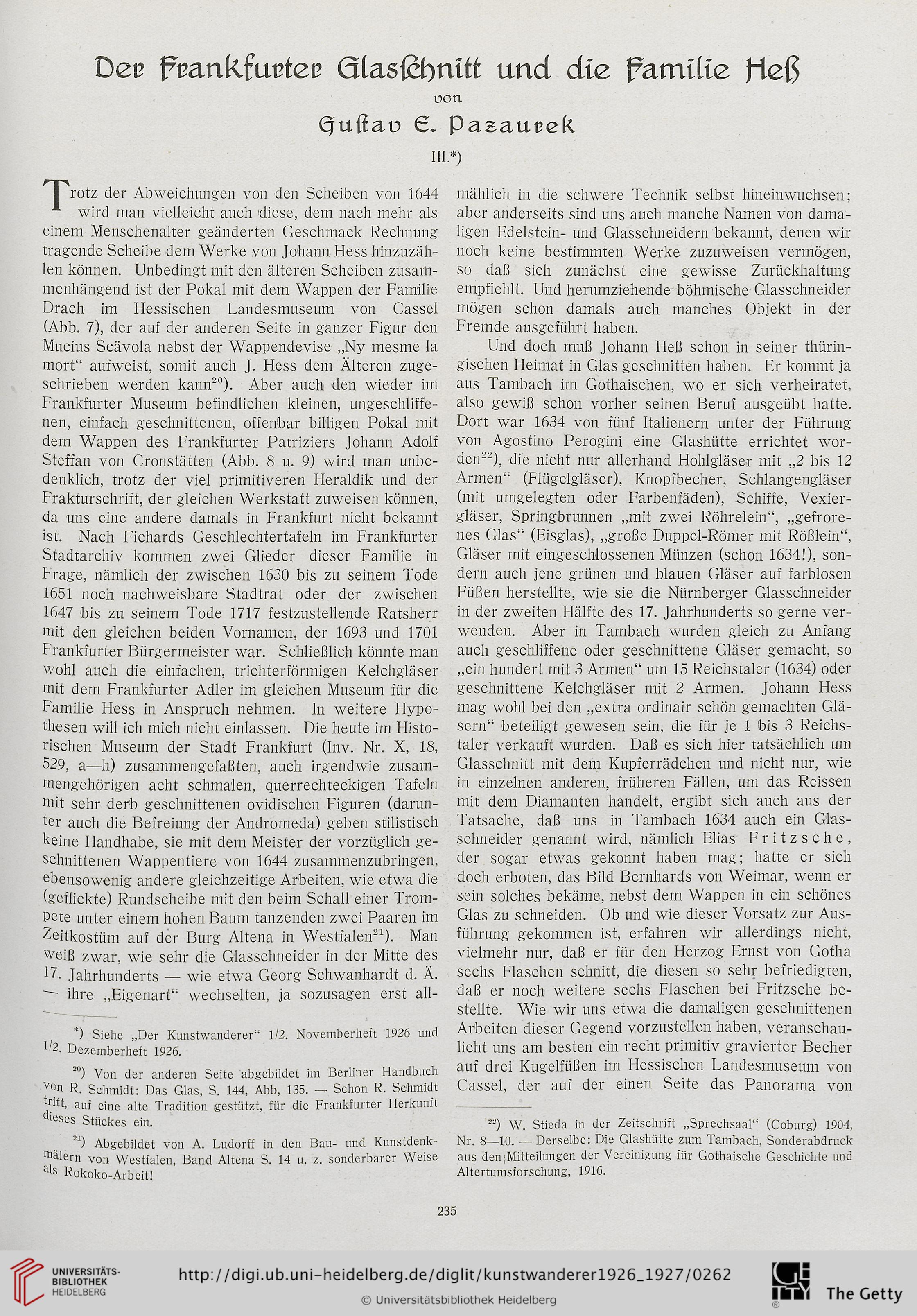Oet? füankfuütee Qtastebnitt und dte famttie Heß
oon
Qußaü 6. PaBauuek.
iii.*)
rotz der Abweichungen von den Scheiben von 1644
wird rnan vielleicht auch diese, dem nach mehr als
einem Menschenaiter giänderten Geschmack Rechnung
tragende Scheibe dem Werke von Johann Hess hinzuzäh-
len können. Unbedingt mit den älteren Scheiben zusam-
menhängend ist der Pokal mit dem Wappen der Familie
Drach im Hessischen Landesmuseum von Cassel
(Abb. 7), der auf der anderen Seite in ganzer Figur den
Mucius Scävola nebst der Wappendevise „Ny mesme la
mort“ aufweist, somit auch J. Hess dem Älteren zuge-
schrieben werden kann20). Aber auch den wieder im
Frankfurter Museum befindlichen kleinen, ungeschliffe-
nen, einfach geschnittenen, offenbar billigen Pokal mit
dem Wappen des Frankfurter Patriziers Johann Adolf
Steffan von Cronstätten (Abb. 8 u. 9) wird man unbe-
denklich, trotz der viel primitiveren Heraldik und der
Frakturschrift, der gleichen Werkstatt zuweisen können,
da uns eine andere damals in Frankfurt nicht bekannt
ist. Nach Fichards Geschlechtertafeln im Frankfurter
Stadtarchiv kommen zwei Glieder dieser Fainilie in
Frage, nämlich der zwischen 1630 bis zu seinem Tode
1651 noch nachweisbare Stadtrat oder der zwischen
1647 bis zu seinem Tode 1717 festzustellende Ratsherr
mit den gleichen beiden Vornamen, der 1693 und 1701
Frankfurter Bürgermeister war. Schließlich könnte man
wohl auch die einfachen, trichterförmigen Kelchgläser
iriit dem Frankfurter Adler im gleichen Museum für die
Familie Hess in Anspruch nehmen. In weitere Hypo-
thesen wiil ich mich nicht einlassen. Die heute im Histo-
rischen Museum der Stadt Frankfurt (Inv. Nr. X, 18,
529, a—h) zusammengefaßten, auch irgendwie zusam-
ttiengehörigen acht schmalen, querrechteckigen Tafeln
mit sehr derb geschnittenen ovidischen Figuren (darun-
ter auch die Befreiung der Andromeda) geben stilistisch
keine Handhabe, sie mit dem Meister der vorzüglich ge-
schnittenen Wappentiere von 1644 zusammenzubringen,
ebensowenig andere gleichzeitige Arbeiten, wie etwa die
feeflickte) Rundscheibe mit den beim Schall einer Trom-
Pete unter einem hohen Baum tanzenden zwei Paaren im
Zeitkostüm auf der Burg Altena in Westfalen21)- Man
Weiß zwar, wie sehr die Glasschneider in der Mitte des
D. Jahrhunderts — wie etwa Georg Schwanhardt d. Ä.
ihre „Eigenart“ wechselten, ja sozusagen erst all-
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1/2. Novemberheft 1926 und
02. Dezemberheft 1926.
20) Von der anderen Seite abgebildet im Berliner Handbuch
v°n R. Schmidt: Das Glas, S. 144, Abb, 135. — Schon R. Schmidt
^r4t, auf eine alte Tradition gesttitzt, fiir die Frankfurter Herkunft
dieses Stückes ein.
‘9 Abgebildet von A. Ludorff in den Bau- und Kunstdenk-
^nälern von Westfalen, Band Altena S. 14 u. z. sonderbarer Weise
aIs Rokoko-Arbeit!
mählich in die schwere Technik selbst hineinwuchsen;
aber anderseits sind uns auch inanche Namen von dama-
ligen Edelstein- und Glasschneidern bekannt, denen wir
noch keine bestimmten Werke zuzuweisen vermögen,
so daß sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung
empfiehlt. Und herumziehende böhmische Glasschneider
mögen schon damals auch manches Objekt in der
Fremde ausgeführt haben.
Und doch muß Johann Heß schon in seiner thürin-
gischen Heimat in Glas geschnitten haben. Er kommt ja
aus Tambach im Gothaischen, wo er sich verheiratet,
also gewiß schon vorher seinen Beruf ausgeübt hatte.
Dort war 1634 von fünf Italienern unter der Führung
von Agostino Perogini eine Glashütte errichtet wor-
den22), die nicht nur allerhand Hohlgläser mit „2 bis 12
Armen“ (Flügelgläser), Knopfbecher, Schlangengläser
(mit umgelegten oder Farbenfäden), Schiffe, Vexier-
gläser, Springbrunnen „mit zwei Röhrelein“, „gefrore-
nes Glas“ (Eisglas), „große Duppel-Römer mit Rößlein“,
Gläser mit eingeschlossenen Münzen (schon 1634!), son-
dern auch jene grünen und blauen Gläser auf farblosen
Füßen herstellte, wie sie die Nürnberger Glasschneider
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so gerne ver-
wenden. Aber in Tambach wurden gleich zu Anfang
auch gescMiffene oder geschnittene Gläser gemacht, so
„ein hundert mit 3 Armen“ um 15 Reichstaler (1634) oder
geschnittene Kelchgläser mit 2 Armen. Johann Hess
mag wohl bei den „extra ordinair schön gemachten Glä-
sern“ beteiligt gewesen sein, die für je 1 'bis 3 Reichs-
taler verkauft wurden. Daß es sich hier tatsächlich um
Glasschnitt mit dem Kupferrädchen und nicht nur, wie
in einzelnen anderen, früheren Fällen, um das Reissen
mit dem Diamanten handelt, ergibt sich auch aus der
Tatsache, daß uns in Tambach 1634 auch ein Glas-
schneider genannt wird, nämlich Elias Fritzsche,
der sogar etwas gekonnt haben mag; hatte er sich
doch erboten, das Bild Bernhards von Weimar, wenn er
sein solches bekäme, nebst dem Wappen in ein schönes
Glas zu schneiden. Ob und wie dieser Vorsatz zur Aus-
führung gekommen ist, erfahren wir allerdings nicht,
vielmehr nur, daß er für den Herzog Ernst von Gotha
sechs Flaschen schnitt, die diesen so sehr befriedigten,
daß er noch weitere sechs Flaschen bei Fritzsche be-
stellte. Wie wir uns etwa die damaligen geschnittenen
Arbeiten dieser Gegend vorzustellen haben, veranschau-
licht uns am besten ein recht primitiv gravierter Becher
auf drei Kugelfüßen im Hessischen Landesmuseuin von
Cassel, der auf der einen Seite das Panorama von
") W. Stieda in der Zeitschrift „Sprechsaal“ (Coburg) 1904,
Nr. 8—10. — Derselbe: Die Glashütte zum Tambach, Sonderabdruck
aus den.Mitteilungen der Vereinigung ftir Gothaische Geschichte und
Altertumsforschung, 1916.
235
oon
Qußaü 6. PaBauuek.
iii.*)
rotz der Abweichungen von den Scheiben von 1644
wird rnan vielleicht auch diese, dem nach mehr als
einem Menschenaiter giänderten Geschmack Rechnung
tragende Scheibe dem Werke von Johann Hess hinzuzäh-
len können. Unbedingt mit den älteren Scheiben zusam-
menhängend ist der Pokal mit dem Wappen der Familie
Drach im Hessischen Landesmuseum von Cassel
(Abb. 7), der auf der anderen Seite in ganzer Figur den
Mucius Scävola nebst der Wappendevise „Ny mesme la
mort“ aufweist, somit auch J. Hess dem Älteren zuge-
schrieben werden kann20). Aber auch den wieder im
Frankfurter Museum befindlichen kleinen, ungeschliffe-
nen, einfach geschnittenen, offenbar billigen Pokal mit
dem Wappen des Frankfurter Patriziers Johann Adolf
Steffan von Cronstätten (Abb. 8 u. 9) wird man unbe-
denklich, trotz der viel primitiveren Heraldik und der
Frakturschrift, der gleichen Werkstatt zuweisen können,
da uns eine andere damals in Frankfurt nicht bekannt
ist. Nach Fichards Geschlechtertafeln im Frankfurter
Stadtarchiv kommen zwei Glieder dieser Fainilie in
Frage, nämlich der zwischen 1630 bis zu seinem Tode
1651 noch nachweisbare Stadtrat oder der zwischen
1647 bis zu seinem Tode 1717 festzustellende Ratsherr
mit den gleichen beiden Vornamen, der 1693 und 1701
Frankfurter Bürgermeister war. Schließlich könnte man
wohl auch die einfachen, trichterförmigen Kelchgläser
iriit dem Frankfurter Adler im gleichen Museum für die
Familie Hess in Anspruch nehmen. In weitere Hypo-
thesen wiil ich mich nicht einlassen. Die heute im Histo-
rischen Museum der Stadt Frankfurt (Inv. Nr. X, 18,
529, a—h) zusammengefaßten, auch irgendwie zusam-
ttiengehörigen acht schmalen, querrechteckigen Tafeln
mit sehr derb geschnittenen ovidischen Figuren (darun-
ter auch die Befreiung der Andromeda) geben stilistisch
keine Handhabe, sie mit dem Meister der vorzüglich ge-
schnittenen Wappentiere von 1644 zusammenzubringen,
ebensowenig andere gleichzeitige Arbeiten, wie etwa die
feeflickte) Rundscheibe mit den beim Schall einer Trom-
Pete unter einem hohen Baum tanzenden zwei Paaren im
Zeitkostüm auf der Burg Altena in Westfalen21)- Man
Weiß zwar, wie sehr die Glasschneider in der Mitte des
D. Jahrhunderts — wie etwa Georg Schwanhardt d. Ä.
ihre „Eigenart“ wechselten, ja sozusagen erst all-
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1/2. Novemberheft 1926 und
02. Dezemberheft 1926.
20) Von der anderen Seite abgebildet im Berliner Handbuch
v°n R. Schmidt: Das Glas, S. 144, Abb, 135. — Schon R. Schmidt
^r4t, auf eine alte Tradition gesttitzt, fiir die Frankfurter Herkunft
dieses Stückes ein.
‘9 Abgebildet von A. Ludorff in den Bau- und Kunstdenk-
^nälern von Westfalen, Band Altena S. 14 u. z. sonderbarer Weise
aIs Rokoko-Arbeit!
mählich in die schwere Technik selbst hineinwuchsen;
aber anderseits sind uns auch inanche Namen von dama-
ligen Edelstein- und Glasschneidern bekannt, denen wir
noch keine bestimmten Werke zuzuweisen vermögen,
so daß sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung
empfiehlt. Und herumziehende böhmische Glasschneider
mögen schon damals auch manches Objekt in der
Fremde ausgeführt haben.
Und doch muß Johann Heß schon in seiner thürin-
gischen Heimat in Glas geschnitten haben. Er kommt ja
aus Tambach im Gothaischen, wo er sich verheiratet,
also gewiß schon vorher seinen Beruf ausgeübt hatte.
Dort war 1634 von fünf Italienern unter der Führung
von Agostino Perogini eine Glashütte errichtet wor-
den22), die nicht nur allerhand Hohlgläser mit „2 bis 12
Armen“ (Flügelgläser), Knopfbecher, Schlangengläser
(mit umgelegten oder Farbenfäden), Schiffe, Vexier-
gläser, Springbrunnen „mit zwei Röhrelein“, „gefrore-
nes Glas“ (Eisglas), „große Duppel-Römer mit Rößlein“,
Gläser mit eingeschlossenen Münzen (schon 1634!), son-
dern auch jene grünen und blauen Gläser auf farblosen
Füßen herstellte, wie sie die Nürnberger Glasschneider
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so gerne ver-
wenden. Aber in Tambach wurden gleich zu Anfang
auch gescMiffene oder geschnittene Gläser gemacht, so
„ein hundert mit 3 Armen“ um 15 Reichstaler (1634) oder
geschnittene Kelchgläser mit 2 Armen. Johann Hess
mag wohl bei den „extra ordinair schön gemachten Glä-
sern“ beteiligt gewesen sein, die für je 1 'bis 3 Reichs-
taler verkauft wurden. Daß es sich hier tatsächlich um
Glasschnitt mit dem Kupferrädchen und nicht nur, wie
in einzelnen anderen, früheren Fällen, um das Reissen
mit dem Diamanten handelt, ergibt sich auch aus der
Tatsache, daß uns in Tambach 1634 auch ein Glas-
schneider genannt wird, nämlich Elias Fritzsche,
der sogar etwas gekonnt haben mag; hatte er sich
doch erboten, das Bild Bernhards von Weimar, wenn er
sein solches bekäme, nebst dem Wappen in ein schönes
Glas zu schneiden. Ob und wie dieser Vorsatz zur Aus-
führung gekommen ist, erfahren wir allerdings nicht,
vielmehr nur, daß er für den Herzog Ernst von Gotha
sechs Flaschen schnitt, die diesen so sehr befriedigten,
daß er noch weitere sechs Flaschen bei Fritzsche be-
stellte. Wie wir uns etwa die damaligen geschnittenen
Arbeiten dieser Gegend vorzustellen haben, veranschau-
licht uns am besten ein recht primitiv gravierter Becher
auf drei Kugelfüßen im Hessischen Landesmuseuin von
Cassel, der auf der einen Seite das Panorama von
") W. Stieda in der Zeitschrift „Sprechsaal“ (Coburg) 1904,
Nr. 8—10. — Derselbe: Die Glashütte zum Tambach, Sonderabdruck
aus den.Mitteilungen der Vereinigung ftir Gothaische Geschichte und
Altertumsforschung, 1916.
235