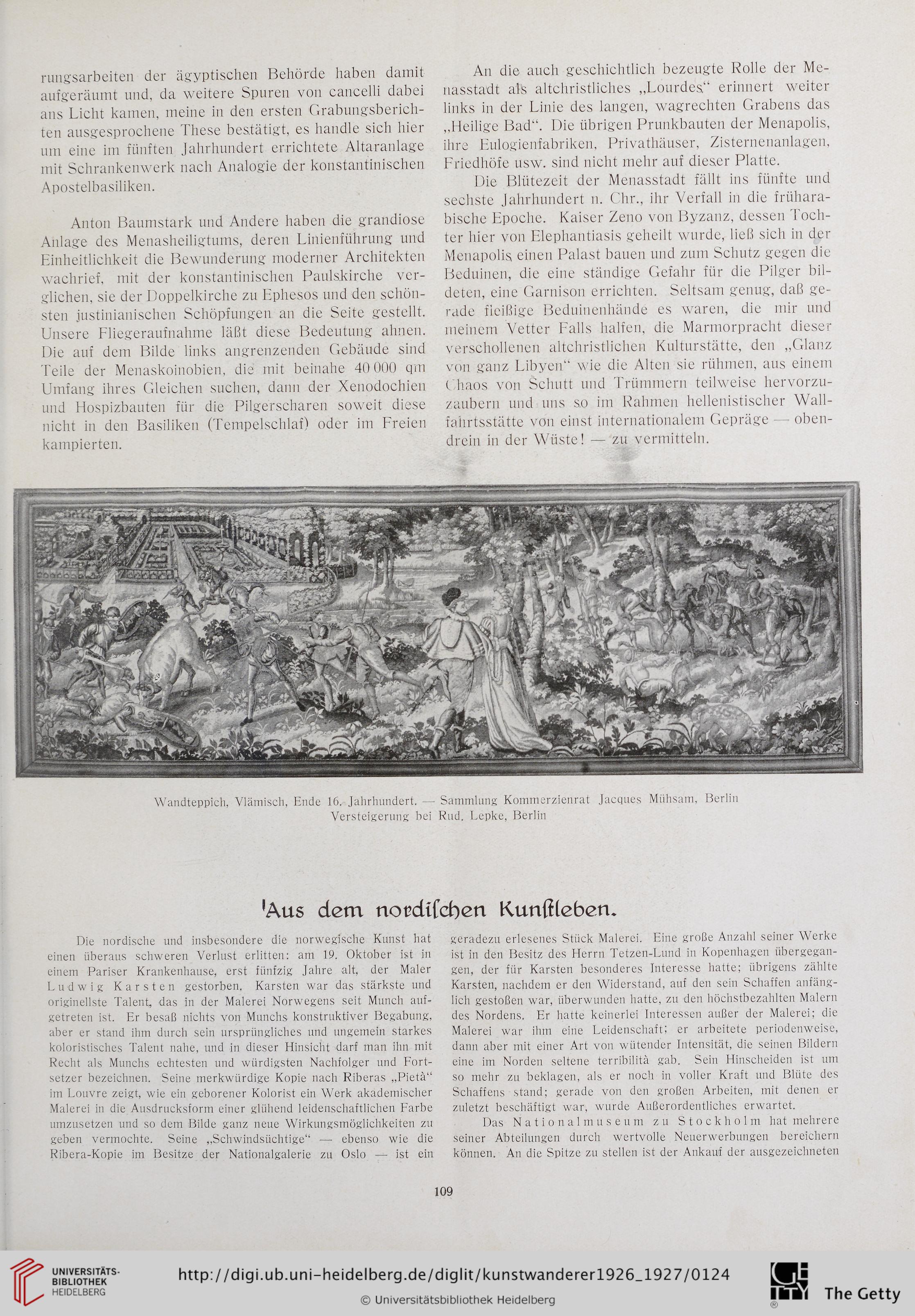rungsarbeiten der ägyptischen Behörde haben damit
aufgeräumt und, da weitere Spuren von cancelli dabei
ans Licht kamen, meine in den ersten Grabungsberich-
ten ausgesprochene These bes.tätigt, es handle sich liier
um eine im fünften Jahrhundert errichtete Altaranlage
mit Schrankenwerk nach Analogie der konstantinischen
Apostelbasiliken.
Anton Baumstark und Andere haben die grandiose
Anlage des Menasheiligtums, dereu Linienführung und
Einheitlichkeit die Bewunderung moderner Architekten
wachrief, mit der konstantinischen Paulskirche vcr-
glichen, sie der Doppelkirche zu Ephesos und den schön-
sten justinianischen Schöpfungen an die Seite gestellt.
Unsere Fliegeraufnahme läßt diese Bedeutung ahnen.
Die auf dem Bilde links angrenzenden Gebäude sind
Teile der Menaskoinobien, die mit beinahe 40 000 qm
Umfang ihres Gleichen suchen, dann der Xenodochien
und Hospizbauten für die Pilgerscharen soweit diese
nicht in den Basiliken (Tempelschlaf) oder im Freien
kampierten.
An die auch geschichtlich bezeugte Rolle der Me-
nasstadt als altchristliches „Lourdes“ erinnert weiter
links in der Linie des langen, wagrechten Grabens das
„Heilige Bad“. Die übrigen Prunkbauten der Menapolis,
ihre Eulogienfabriken, Privathäuser, Zisternenanlagen,
Friedhöfe usw. sind niclit mehr anf dieser Platte.
Die Bliitezeit der Menasstadt fällt ins fünfte und
sechste Jahrhundert n. Chr., ihr Verfall iii die frühara-
bische Epoche. Kaiser Zeno von Byzanz, dessen Toch-
ter hier von Elephantiasis geheilt wurde, ließ sich in der
Menapolis einen Palast bauen und zum Schutz gegen die
Beduinen, die eine ständige Gefahr für die Pilger bil-
deten, eine Garnison errichten. Seltsam genug, daß ge-
rade fieißige Beduinenhände es waren, die mir und
rneinem Vetter Falls halfen, die Marmorpracht dieser
verschollenen altchristlichen Kulturstätte, den „Glanz
von ganz Libyen“ wie die Alten sie rühmen, aus einem
C-haos von Schutt und Trümmern teilweise hervorzu-
zaubern und uns so im Rahmen hellenistischer Wall-
fahrtsstätte von einst internationalem Gepräge —• oben-
drein in der Wüste! — zu vermitteln.
Wandteppich, Vlämisch, Ende 16. Jahrhundert. — Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berliu
Versteigerung bei Rud. Lepke, Berlin
'Aus dem not’difeben Kunttleben.
Die nordische und insbesondere die norwegische Kunst hat
einen überaus schweren Verlust erlitten: am 19. Oktober ist in
einem Pariser Krankenhause, erst fünfzig Jahre ait, der Maler
Ludwig Karsten gestorben. Karsten war das stärkste und
originellste Talent, das in der Malerei Norwegens seit Munch auf-
getreten ist. Er besaß nichts von Munchs konstruktiver Begabung,
aber er stand ihm durch sein ursprüngliches und ungemein starkes
koloristisches Talent nahe, und in dieser Hinsicht darf man ihn mit
Recht als Munchs echtesten und würdigsten Nachfolger und Fort-
setzer bezeichnen. Seine merkwürdige Kopie nach Riberas „Pietä“
im Louvre zeigt, wie ein geborener Kolorist ein Werk akademischer
Malerei in die Ausdrucksform einer glühend leidenschaftlichen Farbe
umzusetzen und so dem Bilde ganz neue Wirkungsmöglichkeiten zu
geben vermochte. Seine „Schwindsüchtige“ — ebenso wie die
Ribera-Kopie im Besitze der Nationalgalerie zu Oslo — ist ein
geradezu erlesenes Stiick Malerei. Eine große Anzahl seiner Werke
ist in den Besitz des Herrn Tetzen-Lund in Kopenhagen iibergegan-
gen, der fiir Karsten besonderes Interesse hatte; iibrigens zählte
Karsten, nachdem er den Widerstand, auf den sein Schaffen anfäng-
lich gestoßen war, iiberwunden hatte, zu den höchstbezahlten Malern
des Nordens. Er hatte keinerlei Interessen außer der Malerei; die
Malerei war ihm eine Leidenschaft; er arbeitete periodenweise,
dann aber mit einer Art von wütender Intensität, die seinen Bildern
eine im Norden seltene terribilitä gab. Sein Hinscheiden ist um
so mehr zu beklagen, als er noch in voller Kraft und Blüte des
Schaffens stand; gerade von den großen Arbeiten, mit denen er
zuletzt beschäftigt war, wurde Außerordentliches erwartet.
Das N a t i o n a 1 m u s e u m z u S t o c k h o 1 m hat mehrere
seiner Abteilungen durch wertvolle Neuerwerbungen bereichern
können. An die Spitze zu stellen ist der Ankauf der ausgezeiclmeten
109
aufgeräumt und, da weitere Spuren von cancelli dabei
ans Licht kamen, meine in den ersten Grabungsberich-
ten ausgesprochene These bes.tätigt, es handle sich liier
um eine im fünften Jahrhundert errichtete Altaranlage
mit Schrankenwerk nach Analogie der konstantinischen
Apostelbasiliken.
Anton Baumstark und Andere haben die grandiose
Anlage des Menasheiligtums, dereu Linienführung und
Einheitlichkeit die Bewunderung moderner Architekten
wachrief, mit der konstantinischen Paulskirche vcr-
glichen, sie der Doppelkirche zu Ephesos und den schön-
sten justinianischen Schöpfungen an die Seite gestellt.
Unsere Fliegeraufnahme läßt diese Bedeutung ahnen.
Die auf dem Bilde links angrenzenden Gebäude sind
Teile der Menaskoinobien, die mit beinahe 40 000 qm
Umfang ihres Gleichen suchen, dann der Xenodochien
und Hospizbauten für die Pilgerscharen soweit diese
nicht in den Basiliken (Tempelschlaf) oder im Freien
kampierten.
An die auch geschichtlich bezeugte Rolle der Me-
nasstadt als altchristliches „Lourdes“ erinnert weiter
links in der Linie des langen, wagrechten Grabens das
„Heilige Bad“. Die übrigen Prunkbauten der Menapolis,
ihre Eulogienfabriken, Privathäuser, Zisternenanlagen,
Friedhöfe usw. sind niclit mehr anf dieser Platte.
Die Bliitezeit der Menasstadt fällt ins fünfte und
sechste Jahrhundert n. Chr., ihr Verfall iii die frühara-
bische Epoche. Kaiser Zeno von Byzanz, dessen Toch-
ter hier von Elephantiasis geheilt wurde, ließ sich in der
Menapolis einen Palast bauen und zum Schutz gegen die
Beduinen, die eine ständige Gefahr für die Pilger bil-
deten, eine Garnison errichten. Seltsam genug, daß ge-
rade fieißige Beduinenhände es waren, die mir und
rneinem Vetter Falls halfen, die Marmorpracht dieser
verschollenen altchristlichen Kulturstätte, den „Glanz
von ganz Libyen“ wie die Alten sie rühmen, aus einem
C-haos von Schutt und Trümmern teilweise hervorzu-
zaubern und uns so im Rahmen hellenistischer Wall-
fahrtsstätte von einst internationalem Gepräge —• oben-
drein in der Wüste! — zu vermitteln.
Wandteppich, Vlämisch, Ende 16. Jahrhundert. — Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berliu
Versteigerung bei Rud. Lepke, Berlin
'Aus dem not’difeben Kunttleben.
Die nordische und insbesondere die norwegische Kunst hat
einen überaus schweren Verlust erlitten: am 19. Oktober ist in
einem Pariser Krankenhause, erst fünfzig Jahre ait, der Maler
Ludwig Karsten gestorben. Karsten war das stärkste und
originellste Talent, das in der Malerei Norwegens seit Munch auf-
getreten ist. Er besaß nichts von Munchs konstruktiver Begabung,
aber er stand ihm durch sein ursprüngliches und ungemein starkes
koloristisches Talent nahe, und in dieser Hinsicht darf man ihn mit
Recht als Munchs echtesten und würdigsten Nachfolger und Fort-
setzer bezeichnen. Seine merkwürdige Kopie nach Riberas „Pietä“
im Louvre zeigt, wie ein geborener Kolorist ein Werk akademischer
Malerei in die Ausdrucksform einer glühend leidenschaftlichen Farbe
umzusetzen und so dem Bilde ganz neue Wirkungsmöglichkeiten zu
geben vermochte. Seine „Schwindsüchtige“ — ebenso wie die
Ribera-Kopie im Besitze der Nationalgalerie zu Oslo — ist ein
geradezu erlesenes Stiick Malerei. Eine große Anzahl seiner Werke
ist in den Besitz des Herrn Tetzen-Lund in Kopenhagen iibergegan-
gen, der fiir Karsten besonderes Interesse hatte; iibrigens zählte
Karsten, nachdem er den Widerstand, auf den sein Schaffen anfäng-
lich gestoßen war, iiberwunden hatte, zu den höchstbezahlten Malern
des Nordens. Er hatte keinerlei Interessen außer der Malerei; die
Malerei war ihm eine Leidenschaft; er arbeitete periodenweise,
dann aber mit einer Art von wütender Intensität, die seinen Bildern
eine im Norden seltene terribilitä gab. Sein Hinscheiden ist um
so mehr zu beklagen, als er noch in voller Kraft und Blüte des
Schaffens stand; gerade von den großen Arbeiten, mit denen er
zuletzt beschäftigt war, wurde Außerordentliches erwartet.
Das N a t i o n a 1 m u s e u m z u S t o c k h o 1 m hat mehrere
seiner Abteilungen durch wertvolle Neuerwerbungen bereichern
können. An die Spitze zu stellen ist der Ankauf der ausgezeiclmeten
109