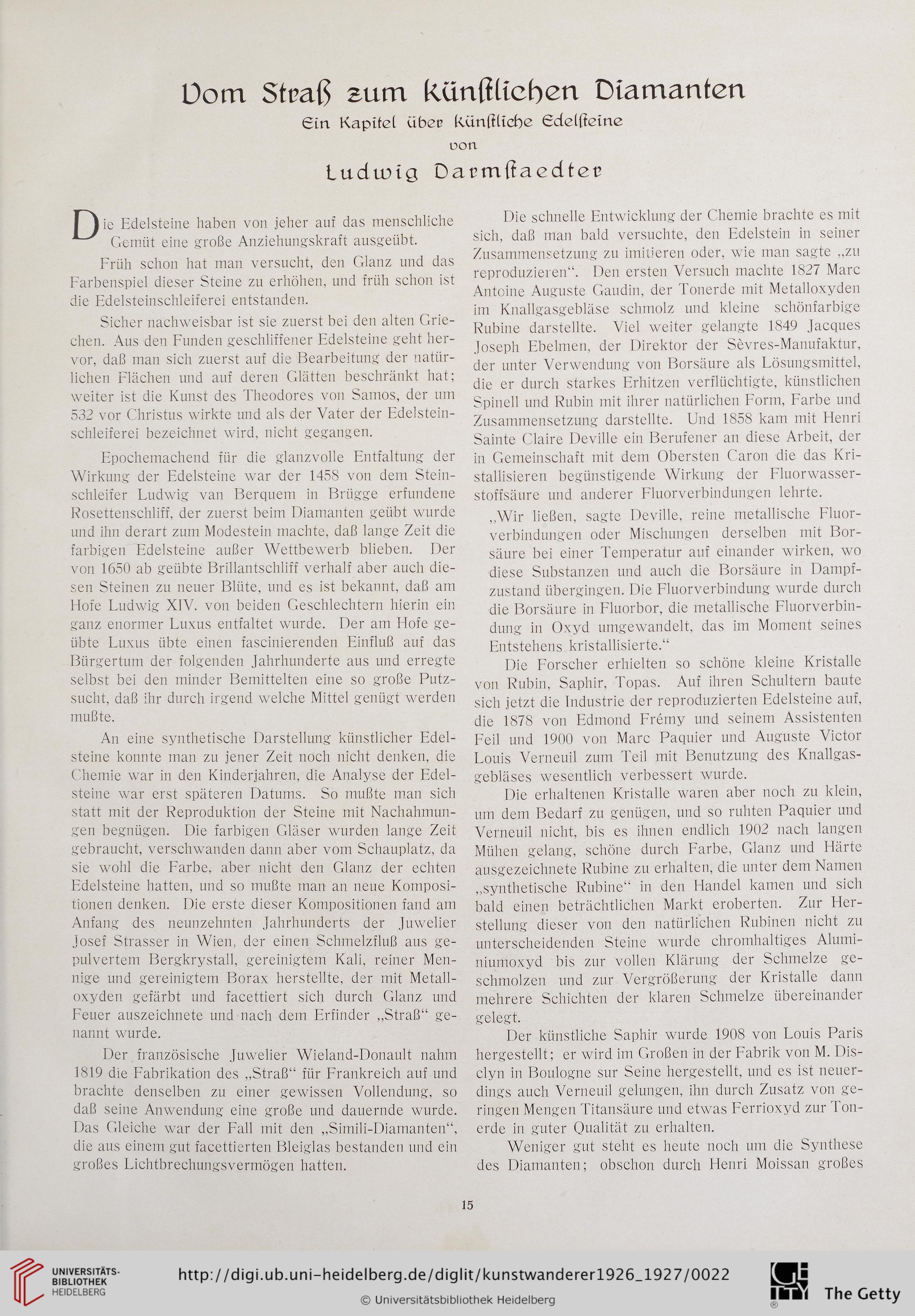Dom Stt?aß sutn künßttcbon Dtamantcn
Sin Kapitet übet? KünffBcbe Sctetfleine
üon
Ludtülö Davmfiaedtev
■ 1 ie Edelsteine haben von jeher auf das menschliche
Gemüt eine große Anziehungskraft ausgeübt.
Früh schon hat man versucht, den Glanz und das
Farbenspiel dieser Steine zu erhöhen, und früh schon ist
die Edelsteinschleiferei entstanden.
Sicher nachweisbar ist sie zuerst bei den alten Grie-
chen. Aus den Funden geschliffener Edelsteine geht her-
vor, daß man sich zuerst auf die Bearbeitung der natiir-
lichen Flächen und auf deren Glätten beschränkt hat;
weiter ist die Kunst des Theodores von Samos, der um
532 vor Christus wirkte und als der Vater der Edelstein-
schleiferei bezeichnet wird, nicht gegangen.
Epochemachend für die glanzvolle Entfaltung der
Wirkung der Edelsteine war der 1458 von dem Stein-
schleifer Ludwig van Berquem in Brügge erfundene
Rosettenschliff, der zuerst beim Diamanten geübt wurde
und ihn derart zum Modestein machte, daß lange Zeit die
farbigen Edelsteine außer Wettbewerb blieben. Der
von 1650 ab geübte Brillantschliff verhalf aber auch die-
sen Steinen zu neuer Blüte, u.nd es ist bekannt, daß am
Hofe Ludwig XIV. von beiden Geschlechtern hierin ein
ganz enormer Luxus entfaltet wurde. Der am Hofe ge-
übte Luxus übte einen fascinierenden Einfluß auf das
Bürgertum der folgenden Jahrhunderte aus und erregte
selbst bei den minder Bemittelten eine so große Putz-
sucht, daß ihr durch irgend welche Mittel genügt werden
mußte.
An eine synthetische Darstellung künstlicher Edel-
steine konnte man zu jener Zeit noch nicht denken, die
Chemie war in den Kinderjahren, die Analyse der Edel-
steine war erst späteren Datums. So mußte man sich
statt mit der Reproduktion der Steine mit Nachahmun-
gen begnügen. Die farbigen Gläser wurden lange Zeit
gebraucht, verschwanden dann aber vom Schauplatz, da
sie wohl die Farbe, aber nicht den Glanz der echten
Edelsteine hatten, und so mußte man an neue Komposi-
tionen denken. Die erste dieser Kompositionen fand am
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Juwelier
Josef Strasser in Wien, der einen Schmelzfluß aus ge-
pulvertem Bergkrystall, gereinigtem Kali, reiner Men-
nige und gereinigtem Borax herstellte, der mit Metall-
oxyden gefärbt und facettiert sich durch Glanz und
Eeuer auszeichnete und nach dem Erfinder ,,Straß“ ge-
nannt wurde.
Der französische Juwelier Wieland-Donault nahm
1819 die Fabrikation des „Straß“ für Frankreich auf und
brachte denselben zu einer gewissen Vollendung, so
daß seine Anwendung eine große und dauernde wurde.
Das Gleiche war der Fall mit den „Simili-Diamanten“,
die aus einem gut facettierten Bleiglas bestanden und ein
großes Lichtbrechungsvermögen hatten.
Die schnelle Entwicklung der Chemie brachte es mit
sich, daß man bald versuchte, den Edelstein in seiner
Zusammensetzung zu imitieren oder, wie man sagte „zu
reproduzieren“. Den ersten Versuch machte 1827 Marc
Antoine Auguste Gaudin, der Tonerde mit Metalloxyden
im Knallgasgebläse schmolz und kleine schönfarbige
Rubine darstellte. Viel weiter gelangte 1849 Jacques
Joseph Ebelmen, der Direktor der Sevres-Manufaktur,
der unter Verwendung von Borsäure als Lösungsmittel,
die er durch starkes Erhitzen verflüchtigte, künstlichen
Spinell und Rubin mit ihrer natürlichen Form, Farbe und
Zusammensetzung darstellte. Und 1858 kam mit Henri
Sainte Claire Deville ein Berufener an diese Arbeit, der
in Gemeinscbaft mit dem Obersten Caron die das Kri-
stallisieren begünstigende Wirkung der Fluorwasser-
stoffsäure und anderer Fluorverbindungen lehrte.
„Wir ließen, sagte Deville, reine metallische Fluor-
verbindungen oder Mischungen derselben mit Bor-
säure bei einer Temperatur auf einander wirken, wo
diese Substanzen und auch die Borsäure in Dampf-
zustand übergingen. Die Fluorverbindung wurde durch
die Borsäure in Fluorbor, die metallische Fluorverbin-
dung in Oxyd umgewandelt, das im Moment seines
Entstehens kristallisierte.“
Die Forscher erhielten so schöne kleine Kristalle
von Rubin, Saphir, Topas. Auf ihren Schultern baute
sich jetzt die Industrie der reproduzierten Edelsteine auf,
die 1878 von Edmond Fremy und seinem Assistenten
Feil und 1900 von Marc Paquier und Auguste Victor
Louis Verneuil zum Teil mit Benutzung des Knallgas-
gebläses wesentlich verbessert wurde.
Die erhaltenen Kristalle waren aber noch zu klein,
um dem Bedarf zu genügen, und so ruhten Paquier und
Verneuil nicht, bis es ihnen endlich 1902 nach langen
Mühen gelang, schöne durch Farbe, Glanz und Härte
ausgezeichnete Rubine zu erhalten, die unter dem Namen
„synthetische Rubine“ in den Handel kamen und sich
bald einen beträchtlichen Markt eroberten. Zur Her-
stellung dieser von den natürlichen Rubinen nicht zu
unterscheidenden Steine wurde chromhaltiges Alumi-
niumoxyd bis zur vollen Klärung der Schmelze ge-
schmolzen und zur Vergrößerung der Kristalle dann
mehrere Schichten der klaren Schmelze übereinandcr
gelegt.
Der künstliche Saphir wurde 1908 von Louis Paris
hergestellt; er wird im Großen in der Fabrik von M. Dis-
clyn in Boulogne sur Seine hergestellt, und es ist neuer-
dings auch Verneuil gelungen, ihn durch Zusatz von ge-
ringen Mengen Titansäure und etwas Ferrioxyd zur Ton-
crde in guter Qualität zu erhalten.
Weniger gut stelit es heute noch um die Synthese
des Diamanten; obschon durch Henri Moissan großes
15
Sin Kapitet übet? KünffBcbe Sctetfleine
üon
Ludtülö Davmfiaedtev
■ 1 ie Edelsteine haben von jeher auf das menschliche
Gemüt eine große Anziehungskraft ausgeübt.
Früh schon hat man versucht, den Glanz und das
Farbenspiel dieser Steine zu erhöhen, und früh schon ist
die Edelsteinschleiferei entstanden.
Sicher nachweisbar ist sie zuerst bei den alten Grie-
chen. Aus den Funden geschliffener Edelsteine geht her-
vor, daß man sich zuerst auf die Bearbeitung der natiir-
lichen Flächen und auf deren Glätten beschränkt hat;
weiter ist die Kunst des Theodores von Samos, der um
532 vor Christus wirkte und als der Vater der Edelstein-
schleiferei bezeichnet wird, nicht gegangen.
Epochemachend für die glanzvolle Entfaltung der
Wirkung der Edelsteine war der 1458 von dem Stein-
schleifer Ludwig van Berquem in Brügge erfundene
Rosettenschliff, der zuerst beim Diamanten geübt wurde
und ihn derart zum Modestein machte, daß lange Zeit die
farbigen Edelsteine außer Wettbewerb blieben. Der
von 1650 ab geübte Brillantschliff verhalf aber auch die-
sen Steinen zu neuer Blüte, u.nd es ist bekannt, daß am
Hofe Ludwig XIV. von beiden Geschlechtern hierin ein
ganz enormer Luxus entfaltet wurde. Der am Hofe ge-
übte Luxus übte einen fascinierenden Einfluß auf das
Bürgertum der folgenden Jahrhunderte aus und erregte
selbst bei den minder Bemittelten eine so große Putz-
sucht, daß ihr durch irgend welche Mittel genügt werden
mußte.
An eine synthetische Darstellung künstlicher Edel-
steine konnte man zu jener Zeit noch nicht denken, die
Chemie war in den Kinderjahren, die Analyse der Edel-
steine war erst späteren Datums. So mußte man sich
statt mit der Reproduktion der Steine mit Nachahmun-
gen begnügen. Die farbigen Gläser wurden lange Zeit
gebraucht, verschwanden dann aber vom Schauplatz, da
sie wohl die Farbe, aber nicht den Glanz der echten
Edelsteine hatten, und so mußte man an neue Komposi-
tionen denken. Die erste dieser Kompositionen fand am
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Juwelier
Josef Strasser in Wien, der einen Schmelzfluß aus ge-
pulvertem Bergkrystall, gereinigtem Kali, reiner Men-
nige und gereinigtem Borax herstellte, der mit Metall-
oxyden gefärbt und facettiert sich durch Glanz und
Eeuer auszeichnete und nach dem Erfinder ,,Straß“ ge-
nannt wurde.
Der französische Juwelier Wieland-Donault nahm
1819 die Fabrikation des „Straß“ für Frankreich auf und
brachte denselben zu einer gewissen Vollendung, so
daß seine Anwendung eine große und dauernde wurde.
Das Gleiche war der Fall mit den „Simili-Diamanten“,
die aus einem gut facettierten Bleiglas bestanden und ein
großes Lichtbrechungsvermögen hatten.
Die schnelle Entwicklung der Chemie brachte es mit
sich, daß man bald versuchte, den Edelstein in seiner
Zusammensetzung zu imitieren oder, wie man sagte „zu
reproduzieren“. Den ersten Versuch machte 1827 Marc
Antoine Auguste Gaudin, der Tonerde mit Metalloxyden
im Knallgasgebläse schmolz und kleine schönfarbige
Rubine darstellte. Viel weiter gelangte 1849 Jacques
Joseph Ebelmen, der Direktor der Sevres-Manufaktur,
der unter Verwendung von Borsäure als Lösungsmittel,
die er durch starkes Erhitzen verflüchtigte, künstlichen
Spinell und Rubin mit ihrer natürlichen Form, Farbe und
Zusammensetzung darstellte. Und 1858 kam mit Henri
Sainte Claire Deville ein Berufener an diese Arbeit, der
in Gemeinscbaft mit dem Obersten Caron die das Kri-
stallisieren begünstigende Wirkung der Fluorwasser-
stoffsäure und anderer Fluorverbindungen lehrte.
„Wir ließen, sagte Deville, reine metallische Fluor-
verbindungen oder Mischungen derselben mit Bor-
säure bei einer Temperatur auf einander wirken, wo
diese Substanzen und auch die Borsäure in Dampf-
zustand übergingen. Die Fluorverbindung wurde durch
die Borsäure in Fluorbor, die metallische Fluorverbin-
dung in Oxyd umgewandelt, das im Moment seines
Entstehens kristallisierte.“
Die Forscher erhielten so schöne kleine Kristalle
von Rubin, Saphir, Topas. Auf ihren Schultern baute
sich jetzt die Industrie der reproduzierten Edelsteine auf,
die 1878 von Edmond Fremy und seinem Assistenten
Feil und 1900 von Marc Paquier und Auguste Victor
Louis Verneuil zum Teil mit Benutzung des Knallgas-
gebläses wesentlich verbessert wurde.
Die erhaltenen Kristalle waren aber noch zu klein,
um dem Bedarf zu genügen, und so ruhten Paquier und
Verneuil nicht, bis es ihnen endlich 1902 nach langen
Mühen gelang, schöne durch Farbe, Glanz und Härte
ausgezeichnete Rubine zu erhalten, die unter dem Namen
„synthetische Rubine“ in den Handel kamen und sich
bald einen beträchtlichen Markt eroberten. Zur Her-
stellung dieser von den natürlichen Rubinen nicht zu
unterscheidenden Steine wurde chromhaltiges Alumi-
niumoxyd bis zur vollen Klärung der Schmelze ge-
schmolzen und zur Vergrößerung der Kristalle dann
mehrere Schichten der klaren Schmelze übereinandcr
gelegt.
Der künstliche Saphir wurde 1908 von Louis Paris
hergestellt; er wird im Großen in der Fabrik von M. Dis-
clyn in Boulogne sur Seine hergestellt, und es ist neuer-
dings auch Verneuil gelungen, ihn durch Zusatz von ge-
ringen Mengen Titansäure und etwas Ferrioxyd zur Ton-
crde in guter Qualität zu erhalten.
Weniger gut stelit es heute noch um die Synthese
des Diamanten; obschon durch Henri Moissan großes
15