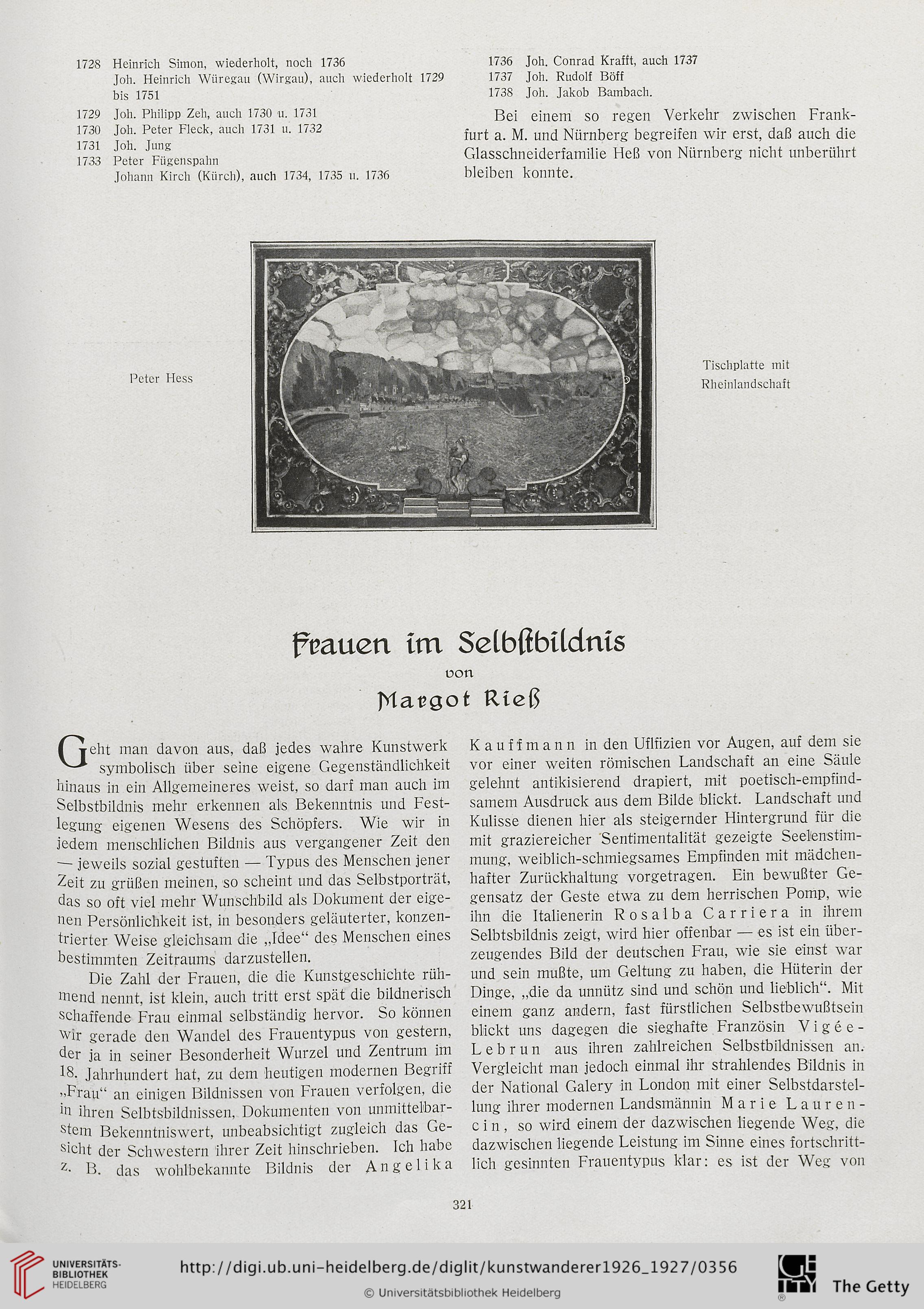Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0356
DOI Heft:
1./2. Aprilheft
DOI Artikel:Pazaurek, Gustav Edmund: Der Frankfurter Glasschnitt und die Familie Heß, [5]
DOI Artikel:Riess, Margot: Frauen im Selbstbildnis
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0356
1728 Heinrich Simon, wiederholt, noch 1736
Joh. Heinrich Wiiregau (Wirgau), auch wiederholt 1729
bis 1751
1729 Joh. Philipp Zeh, auch 1730 u. 1731
1730 Joh. Peter Fleck, auch 1731 u. 1732
1731 Joh. Jung
1733 Peter Fiigenspahn
Johann Kirch (Kiircli), auch 1734, 1735 u. 1736
1736 Joh. Conrad Krafft, auch 1737
1737 Joh. Rudolf Böff
1738 Joh. Jakob Bambach.
Bei einem so regen Verkehr zwischen Frank-
furt a. M. und Nürnberg begreifen wir erst, daß auch die
Ctlasschneiderfamilie Heß von Niirnberg nicht unberührt
bleiben konnte.
Pctcr Hess
Tischplatte mit
Rheinlandschaft
frauen tm Setbßbtldnts
non
piavQot Ricß
I reht man davon aus, daß jedes wahre Kunstwerk
symbolisch über seine eigene Gegenständlichkeit
hinaus in ein Allgemeineres weist, so darf man auch im
Selbstbildnis mehr erkennen als Bekenntnis und Fest-
legung eigenen Wesens des Schöpfers. Wie wir in
iedem menschlichen Bildnis aus vergangener Zeit den
— jeweils sozial gestuften — Typus des Menschen jener
Zeit zu grüßen meinen, so scheint und das Selbstporträt,
das so oft viel mehr Wunschbild als Idokument der eige-
nen Persönlichkeit ist, in besonders geläuterter, konzen-
trierter Weise gleichsam die „Idee“ des Menschen eines
bestimmten Zeitraums darzustellen.
Die Zahl der Frauen, die die Kunstgeschichte rüh-
^iend nennt, ist klein, auch tritt erst spät die bildnerisch
schaffende Frau einmal selbständig hervor. So können
^ir gerade den Wandel des Frauentypus von gestern,
her ja in seiner Besonderheit Wurzel und Zentrum im
18- Jahrhundert hat, zu dem heutigen modernen Begriff
»Frau“ an einigen Bildnissen von Frauen verfolgen, die
hi ihren Selbtsbildnissen, Dokumenten von unmittelbar-
steni Bekenntniswert, unbeabsichtigt zugleich das Ge-
siclit der Schwestern ihrer Zeit hinschrieben. Ich habe
z- B. das wohlbekannte Bildnis der Angelika
Kauffmann in den Uflfizien vor Augen, auf dem sie
vor einer weiten römischen Landschaft an eine Säule
gelehnt antikisierend drapiert, mit poetisch-empfind-
samem Ausdruck aus dem Bilde blickt. Landschaft und
Kulisse dienen hier als steigernder Hintergrund für die
mit graziereicher Sentimentalität gezeigte SeeJenstim-
mung, weiblich-schmiegsames Empfinden mit mädchen-
hafter Zurückhaltung vorgetragen. Ein bewußter Ge-
gensatz der Geste etwa zu dem herrischen Pomp, wie
ihn die Italienerin Rosalba Carriera in ihrem
Selbtsbildnis zeigt, wird hier offenbar — es ist ein über-
zeugendes Bild der deutschen Frau, wie sie einst war
und sein mußte, um Geltung zu haben, die Hüterin der
Dinge, „die da unnütz sind und schön und lieblich“. Mit
einem ganz andern, fast fürstlichen Selbstbewußtsein
blickt uns dagegen die sieghafte Französin V i g e e -
Lebrun aus ihren zahlreichen Selbstbildnissen an.
Vergleicht man jedoch einmal ihr strahlendes Bildnis in
der National Galery in London mit einer Selbstdarstel-
lung ihrer modernen Landsmännin M a r i e L a u r e n -
c i n , so wird einem der dazwischen liegende Weg, die
dazwischen liegende Leistung im Sinne eines fortschritt-
lich gesinnten Frauentypus klar: es ist der Weg von
321
Joh. Heinrich Wiiregau (Wirgau), auch wiederholt 1729
bis 1751
1729 Joh. Philipp Zeh, auch 1730 u. 1731
1730 Joh. Peter Fleck, auch 1731 u. 1732
1731 Joh. Jung
1733 Peter Fiigenspahn
Johann Kirch (Kiircli), auch 1734, 1735 u. 1736
1736 Joh. Conrad Krafft, auch 1737
1737 Joh. Rudolf Böff
1738 Joh. Jakob Bambach.
Bei einem so regen Verkehr zwischen Frank-
furt a. M. und Nürnberg begreifen wir erst, daß auch die
Ctlasschneiderfamilie Heß von Niirnberg nicht unberührt
bleiben konnte.
Pctcr Hess
Tischplatte mit
Rheinlandschaft
frauen tm Setbßbtldnts
non
piavQot Ricß
I reht man davon aus, daß jedes wahre Kunstwerk
symbolisch über seine eigene Gegenständlichkeit
hinaus in ein Allgemeineres weist, so darf man auch im
Selbstbildnis mehr erkennen als Bekenntnis und Fest-
legung eigenen Wesens des Schöpfers. Wie wir in
iedem menschlichen Bildnis aus vergangener Zeit den
— jeweils sozial gestuften — Typus des Menschen jener
Zeit zu grüßen meinen, so scheint und das Selbstporträt,
das so oft viel mehr Wunschbild als Idokument der eige-
nen Persönlichkeit ist, in besonders geläuterter, konzen-
trierter Weise gleichsam die „Idee“ des Menschen eines
bestimmten Zeitraums darzustellen.
Die Zahl der Frauen, die die Kunstgeschichte rüh-
^iend nennt, ist klein, auch tritt erst spät die bildnerisch
schaffende Frau einmal selbständig hervor. So können
^ir gerade den Wandel des Frauentypus von gestern,
her ja in seiner Besonderheit Wurzel und Zentrum im
18- Jahrhundert hat, zu dem heutigen modernen Begriff
»Frau“ an einigen Bildnissen von Frauen verfolgen, die
hi ihren Selbtsbildnissen, Dokumenten von unmittelbar-
steni Bekenntniswert, unbeabsichtigt zugleich das Ge-
siclit der Schwestern ihrer Zeit hinschrieben. Ich habe
z- B. das wohlbekannte Bildnis der Angelika
Kauffmann in den Uflfizien vor Augen, auf dem sie
vor einer weiten römischen Landschaft an eine Säule
gelehnt antikisierend drapiert, mit poetisch-empfind-
samem Ausdruck aus dem Bilde blickt. Landschaft und
Kulisse dienen hier als steigernder Hintergrund für die
mit graziereicher Sentimentalität gezeigte SeeJenstim-
mung, weiblich-schmiegsames Empfinden mit mädchen-
hafter Zurückhaltung vorgetragen. Ein bewußter Ge-
gensatz der Geste etwa zu dem herrischen Pomp, wie
ihn die Italienerin Rosalba Carriera in ihrem
Selbtsbildnis zeigt, wird hier offenbar — es ist ein über-
zeugendes Bild der deutschen Frau, wie sie einst war
und sein mußte, um Geltung zu haben, die Hüterin der
Dinge, „die da unnütz sind und schön und lieblich“. Mit
einem ganz andern, fast fürstlichen Selbstbewußtsein
blickt uns dagegen die sieghafte Französin V i g e e -
Lebrun aus ihren zahlreichen Selbstbildnissen an.
Vergleicht man jedoch einmal ihr strahlendes Bildnis in
der National Galery in London mit einer Selbstdarstel-
lung ihrer modernen Landsmännin M a r i e L a u r e n -
c i n , so wird einem der dazwischen liegende Weg, die
dazwischen liegende Leistung im Sinne eines fortschritt-
lich gesinnten Frauentypus klar: es ist der Weg von
321