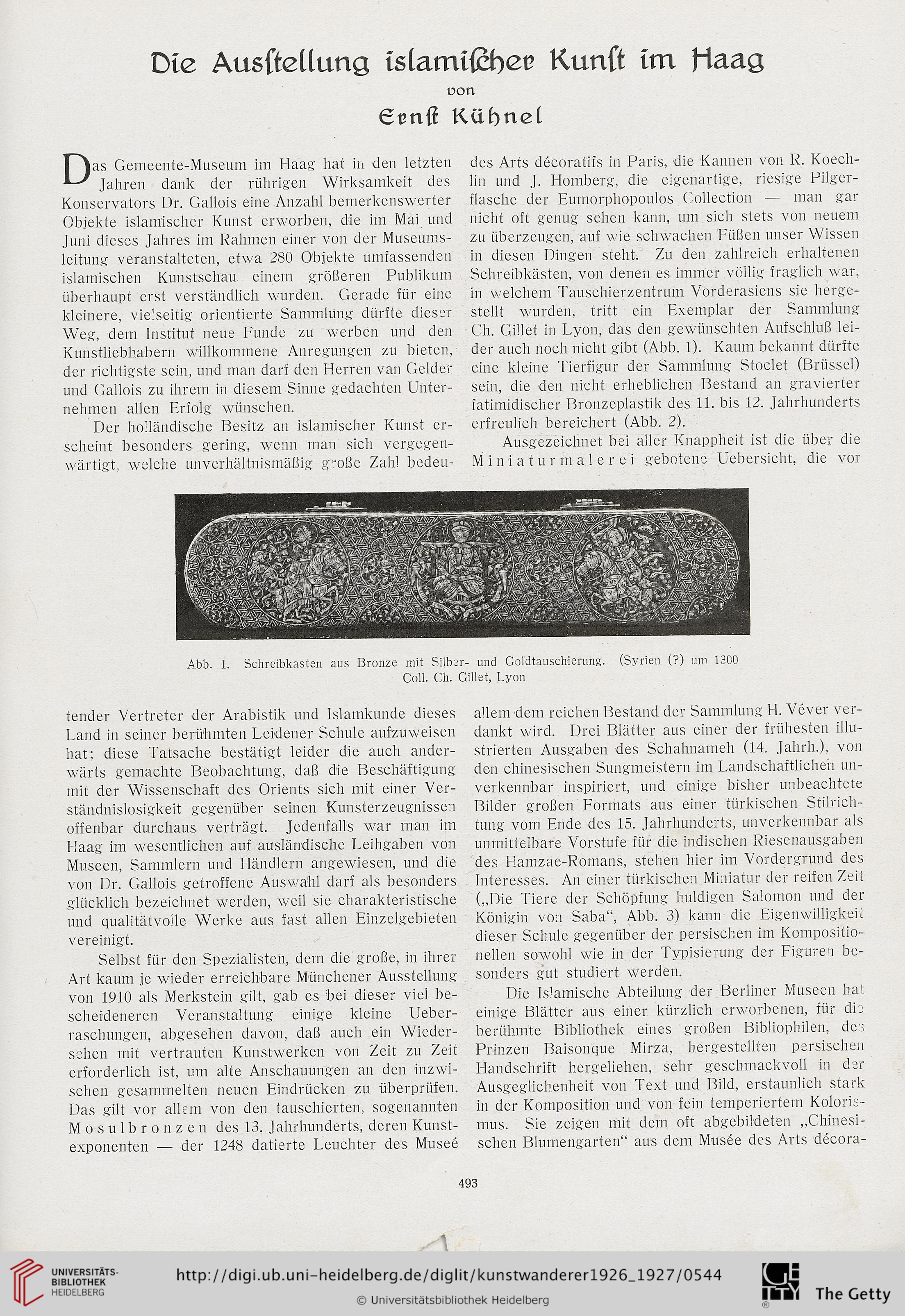Dte Ausfteüung islamtfebet’ Kunft tm Jiaag
üon
Jas Gemeente-Museum im Haag hat in den letzten
Jahren dank der rührigen Wirksamkeit dcs
Konservators Dr. Gallois eine Anzahl bemerkenswerter
Objekte islamischer Kunst erworben, die im Mai und
Juni dieses Jahres im Rahmen einer von der Museums-
leitung veranstalteten, etwa 280 Objekte umfassenden
islamischen Kunstschau einem größeren Publikum
überhaupt erst verständlich wurden. Gerade für eine
kleinere, vielseitig orientierte Sammlüng dürfte dieser
We^, dem Institut neue Funde zu werben und den
Kunstliebhabern willkommene Anregungen zu bieten,
der ric-htigste sein, und man darf den Herren van Gelder
und Gallois zu ihrem in diesem Sinne gedachten Unter-
nehmen allen Erfolg wünschen.
Der hoüändische Besitz an islamischer Kunst er-
scheint besonders gering, wenn man sich vergegen-
wärtigt, welche unverhältnismäßig gmße Zahl bedeu-
tender Vertreter der Arabistik und Islamkunde dieses
Land in seiner berühmten Leidener Schule aufzuweisen
hat; diese Tatsache bestätigt leider die auch ander-
wärts gemachte Beobachtung, daß die Beschäftigung
mit der Wissenschaft des Orients sich mit einer Ver-
ständnislosigkeit gegenüber seinen Kunsterzeugnissen
offenbar aurchaus verträgt. Jedenfalls war man im
Haag im wesentlichen auf ausländische Leihgaben von
Museen, Sammlern und Händlern angewiesen, und die
von Dr. Gallois getroffenc Auswahl darf als besonders
glücklich bezeichnet werden, weil sie charakteristische
und qualitätvolle Werke aus fast allen Einzelgebieten
vereinigt.
Selbst für den Spezialisten, dem die große, in ihrer
Art kaum je wieder erreichbare Münchener Ausstellung
von 1910 als Merkstein gilt, gab es bei dieser viel be-
scheideneren Veranstaltung einige kleine Ueber-
raschungen, abgesehen davon, daß auch ein Wieder-
sehen mit vertrauten Kunstwerken von Zeit zu Zeit
erforderlich ist, um alte Anschauungen an den inzwi-
schen gesammelten neuen Eindrücken zu überprüfen.
Das gilt vor allem von den tauschierten, sogenannten
M o s u 1 b r o n z e n des 13. Jahrhunderts, deren Kunst-
exponenten — der 1248 datierte Leuchtcr des Musee
dcs Arts decoratifs in Paris, die Kannen von R. Koech-
lin und J. Homberg, dic eigenartige, ricsige Pilger-
flasche der Eumorphopoulos Collection — man gar
nicht oft genug sehen kann, um sicli stets von neuem
zu überzeugen, auf wie schwachen Füßen unser Wissen
in diesen Dingen steht. Zu den zahlreich erhaltenen
Schreibkästen, von denen es inuncr völlig fraglich war,
in welchem Tauschierzentrum Vörderasiens sie herge-
stellt wurden, tritt ein Exemplar der Sammlung
Ch. Gillet in Lyon, das den gewünschten Aufschluß lei-
der auch noch nicht gibt (Abb. 1). Kaum bekannt diirfte
eine kleine Tierfigur dcr Sammlung Stoclet (Brüssel)
sein, die den nicht erheblichen Bestand an gravierter
fatimidischer Bronzeplastik des 11. bis 12. Jahrhunderts
crfreulich bereichert (Abb. 2).
Ausgezeichnet bei aller Knappheit ist die iiber die
Miniaturmalerei gebotene Uebersicht, die vor
allem dem reichen Bestand der Sammhmg H. Vever ver-
dankt wird. Drei Blätter aus einer der frühesten illu-
strierten Ausgaben des Schahnameh (14. Jahrh.), von
den chinesischen Sungmeistern im Landschaftlicheh un-
verkennbar inspiriert, und einige bisher unbeachtetc
Bilder großen Formats aus einer türkischen Stilrich-
tung vom Ende des 15. Jahrhunderts, unverkennbar als
unmittelbare Vorstufe für die indischen Riesenausgaben
des Hamzae-Romans, stehen hier im Vordergrund des
Interesses. An einer türkischen Miniatur der reifen Zeit
(„Die Tiere der Schöpfung huldigen Salomon und der
Königin von Saba“, Abb. 3) kann die Eigenwdlligkeii
dieser Schule gegenüber der persischen im Kompositio-
nellen sowohl wie in der Typisierung der Figuren be-
sonders gut studiert werden.
Die Isiamische Abteilung der Berliner Museen hat
einige Blätter aus einer kürzlich erworbenen, für di:
beriihmte Bibliothek eincs großen Bibliophilen, des
Prinzen Baisonque Mirza, hergestellten persisclien
Handschrift hergeliehen, sehr geschmackvoll in der
Ausgeglichenheit von Text und Bild, erstaunlich stark
in der Komposition und von fein temperiertem Koloris-
mus. Sic zeigen mit dem oft abgebildeten „Chinesi-
schen Blumengarten“ aus dem Musee des Arts decora-
Abb. 1. Schreibkasten aus Bronze mit Silber- und Goldtauschierung. (Syrien (?) um 1300
Coll. Ch. Gillet, Lyon
493
üon
Jas Gemeente-Museum im Haag hat in den letzten
Jahren dank der rührigen Wirksamkeit dcs
Konservators Dr. Gallois eine Anzahl bemerkenswerter
Objekte islamischer Kunst erworben, die im Mai und
Juni dieses Jahres im Rahmen einer von der Museums-
leitung veranstalteten, etwa 280 Objekte umfassenden
islamischen Kunstschau einem größeren Publikum
überhaupt erst verständlich wurden. Gerade für eine
kleinere, vielseitig orientierte Sammlüng dürfte dieser
We^, dem Institut neue Funde zu werben und den
Kunstliebhabern willkommene Anregungen zu bieten,
der ric-htigste sein, und man darf den Herren van Gelder
und Gallois zu ihrem in diesem Sinne gedachten Unter-
nehmen allen Erfolg wünschen.
Der hoüändische Besitz an islamischer Kunst er-
scheint besonders gering, wenn man sich vergegen-
wärtigt, welche unverhältnismäßig gmße Zahl bedeu-
tender Vertreter der Arabistik und Islamkunde dieses
Land in seiner berühmten Leidener Schule aufzuweisen
hat; diese Tatsache bestätigt leider die auch ander-
wärts gemachte Beobachtung, daß die Beschäftigung
mit der Wissenschaft des Orients sich mit einer Ver-
ständnislosigkeit gegenüber seinen Kunsterzeugnissen
offenbar aurchaus verträgt. Jedenfalls war man im
Haag im wesentlichen auf ausländische Leihgaben von
Museen, Sammlern und Händlern angewiesen, und die
von Dr. Gallois getroffenc Auswahl darf als besonders
glücklich bezeichnet werden, weil sie charakteristische
und qualitätvolle Werke aus fast allen Einzelgebieten
vereinigt.
Selbst für den Spezialisten, dem die große, in ihrer
Art kaum je wieder erreichbare Münchener Ausstellung
von 1910 als Merkstein gilt, gab es bei dieser viel be-
scheideneren Veranstaltung einige kleine Ueber-
raschungen, abgesehen davon, daß auch ein Wieder-
sehen mit vertrauten Kunstwerken von Zeit zu Zeit
erforderlich ist, um alte Anschauungen an den inzwi-
schen gesammelten neuen Eindrücken zu überprüfen.
Das gilt vor allem von den tauschierten, sogenannten
M o s u 1 b r o n z e n des 13. Jahrhunderts, deren Kunst-
exponenten — der 1248 datierte Leuchtcr des Musee
dcs Arts decoratifs in Paris, die Kannen von R. Koech-
lin und J. Homberg, dic eigenartige, ricsige Pilger-
flasche der Eumorphopoulos Collection — man gar
nicht oft genug sehen kann, um sicli stets von neuem
zu überzeugen, auf wie schwachen Füßen unser Wissen
in diesen Dingen steht. Zu den zahlreich erhaltenen
Schreibkästen, von denen es inuncr völlig fraglich war,
in welchem Tauschierzentrum Vörderasiens sie herge-
stellt wurden, tritt ein Exemplar der Sammlung
Ch. Gillet in Lyon, das den gewünschten Aufschluß lei-
der auch noch nicht gibt (Abb. 1). Kaum bekannt diirfte
eine kleine Tierfigur dcr Sammlung Stoclet (Brüssel)
sein, die den nicht erheblichen Bestand an gravierter
fatimidischer Bronzeplastik des 11. bis 12. Jahrhunderts
crfreulich bereichert (Abb. 2).
Ausgezeichnet bei aller Knappheit ist die iiber die
Miniaturmalerei gebotene Uebersicht, die vor
allem dem reichen Bestand der Sammhmg H. Vever ver-
dankt wird. Drei Blätter aus einer der frühesten illu-
strierten Ausgaben des Schahnameh (14. Jahrh.), von
den chinesischen Sungmeistern im Landschaftlicheh un-
verkennbar inspiriert, und einige bisher unbeachtetc
Bilder großen Formats aus einer türkischen Stilrich-
tung vom Ende des 15. Jahrhunderts, unverkennbar als
unmittelbare Vorstufe für die indischen Riesenausgaben
des Hamzae-Romans, stehen hier im Vordergrund des
Interesses. An einer türkischen Miniatur der reifen Zeit
(„Die Tiere der Schöpfung huldigen Salomon und der
Königin von Saba“, Abb. 3) kann die Eigenwdlligkeii
dieser Schule gegenüber der persischen im Kompositio-
nellen sowohl wie in der Typisierung der Figuren be-
sonders gut studiert werden.
Die Isiamische Abteilung der Berliner Museen hat
einige Blätter aus einer kürzlich erworbenen, für di:
beriihmte Bibliothek eincs großen Bibliophilen, des
Prinzen Baisonque Mirza, hergestellten persisclien
Handschrift hergeliehen, sehr geschmackvoll in der
Ausgeglichenheit von Text und Bild, erstaunlich stark
in der Komposition und von fein temperiertem Koloris-
mus. Sic zeigen mit dem oft abgebildeten „Chinesi-
schen Blumengarten“ aus dem Musee des Arts decora-
Abb. 1. Schreibkasten aus Bronze mit Silber- und Goldtauschierung. (Syrien (?) um 1300
Coll. Ch. Gillet, Lyon
493