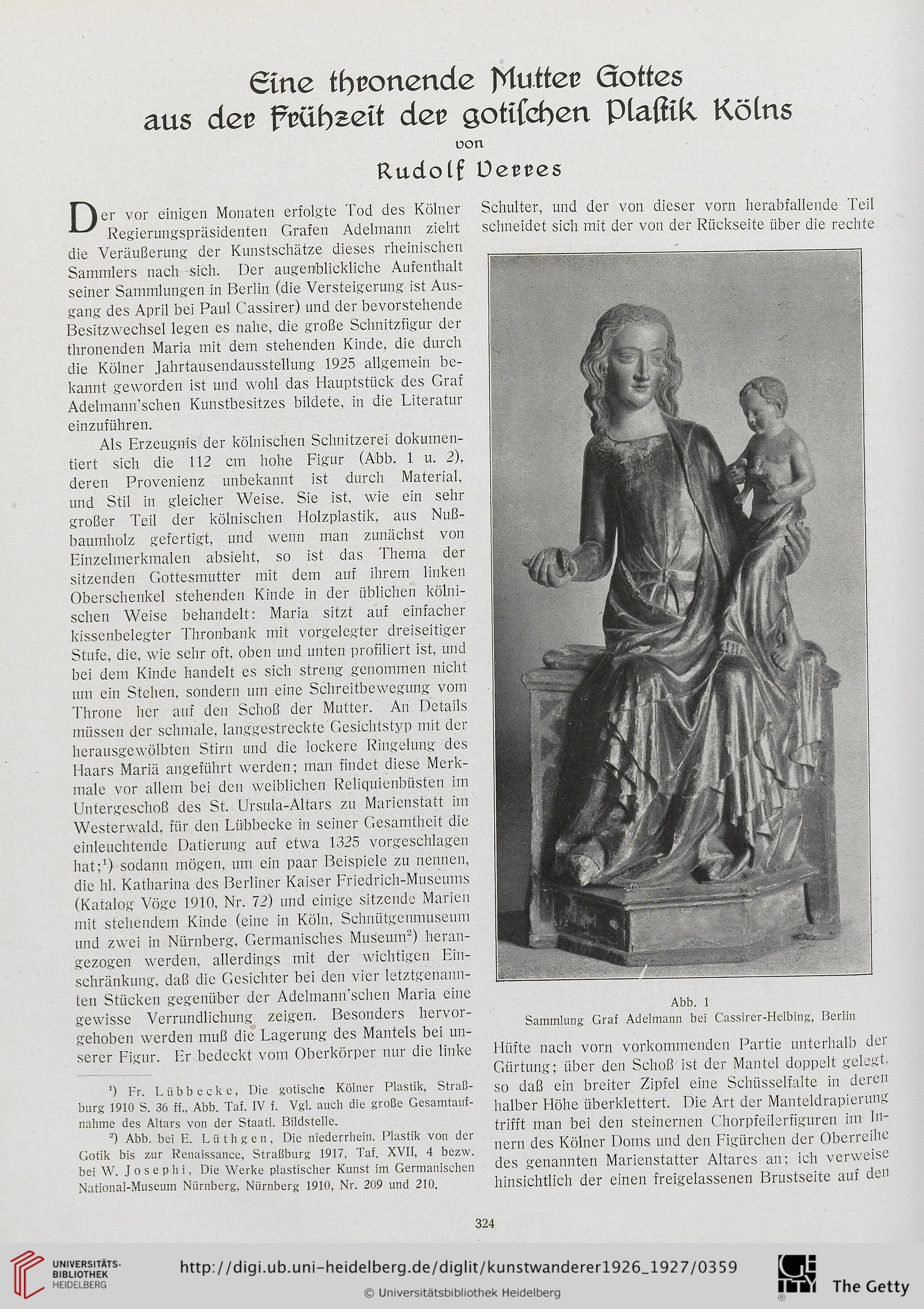Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0359
DOI Heft:
1./2. Aprilheft
DOI Artikel:Verres, Rudolf: Eine thronende Mutter Gottes aus der Frühzeit der gotischen Plastik Kölns
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0359
€tne tbeonende Mutteß Qottes
aus det? fmtyzeit dev gotifcben ptaßtk Kötns
oon
Rudolf Uccccs
Jer vor einigen Monaten erfolgte Tod des Kölner
Regierungspräsidenten Grafen Adelmann zieht
die Veräußerung der Kunstschätze dieses rheinischen
Sammlers nach sich. Der augenblickliche Aufenthalt
seiner Sammlungen in Berlin (die Versteigerung ist Aus-
gang des April bei Paul Cassirer) und der bevorstehende
Besitzwechsel legen es nahe, die große Schnitzfigur der
thronenden Maria mit dem stehenden Kinde, die durch
die Kölner Jahrtausendausstellung 1925 allgemein be-
kannt geworden ist und wohl das Hauptstück des Graf
Adelmann’schen Kunstbesitzes biklete, in die Literatur
einzuführen.
Als Erzeugnis der kölnischen Schnitzerei dokumen-
tiert sich die 112 cm hohe Figur (Abb. 1 u. 2),
deren Provenienz unbekannt ist durch Material,
und Stil in gleicher Weise. Sie ist, wie ein sehr
großer Teii der kölnischen Holzplastik, aus Nuß-
baumholz gefertigt, und wenn man zunächst von
Einzelmerkmaien absieht, so ist das Thema der
sitzenden Gottesmutter mit dem auf ihrem linken
Oberschenkel stehenden Kinde in der üblichen kölni-
schen Weise behandelt: Maria sitzt auf einfacher
kissenbelegter Thronbank mit vorgelcgter dreiseitiger
Stufe, die, wie sehr oft, oben und unten profiliert ist, und
bei dem Kindc handelt es sicli streng genommen nicht
um ein Stehen, sondern um eine Schreitbewegung vom
Throne her auf den Sclioß der Mutter. An Details
müssen der schmale, langgestreckte Gcsiclitstyp mit der
herausgewölbten Stirn und die lockere Ringelung des
Haars Mariä angeführt werden; man findet diese Merk-
male vor allem bei den weiblichen Reliquienbüsten im
Untergcschoß des St. Ursula-Altars zu Maricnstatt im
Westerwald, ftir den Liibbecke in seincr Gesamthcit die
einleuchtende Datierung auf etwa 1325 vorgeschlagen
liat;1) sodann mögen, um ein paar Beispiele zu nennen,
die hl. Katharina des Berliner Kaiser Friedrich-Museums
(Katalog Vögc 1910. Nr. 72) und cinige sitzende Marien
mit stehendem Kinde (eine in Köln, Schnütgenmuseum
und zwei in Nürnberg, Germanisches Museum2) herau-
gezogen werden, allerdings mit der wichtigen Ein-
schränkung, daß die Gesichter bei den vicr letztgenann-
ten Stücken gegenüber der Adelmann’schen Maria eine
gewisse Verrundlichung zeigen. Besondcrs hervor-
gehoben werden muß die Lagerung des Mantels bei un-
serer Figur. Er bedcckt vom Obcrkörper nur die linke
0 Fr. L ii b b e c k c , Die gotischc Kölner Plastik, Straß-
burg 1910 S. 36 ff., Abb. Taf. IV f. Vgl. auch die große Gesamtauf-
nahme des Altars von der Staatl. Bildstelle.
") Abb. bei E. Ltithgen, Die niederrhein. Plastik von der
Gotik bis zur Retiaissance, Straßburg 1917, Taf. XVII, 4 bezw.
bei W. Josephi, Die Werke plastischer Kunst im Germanischen
National-Museum Nürnberg, Niirnberg 1910, Nr. 209 und 210.
Schulter, und der von dieser vorn herabfallende Teil
schneidet sich mit der von der Rückseite über die rechte
Abb. 1
Sammlung Graf Adelmann bei Cassirer-Helbing, Berlin
Hüfte nach vorn vorkommenden Partie unterhalb der
Gürtung; über den Schoß ist der Mantel doppelt gelegt,
so daß ein breiter Zipfel eine Schüsselfalte in deren
lialber Höhe überklettert. Die Art der Manteldrapierung
trifft man bei den steinernen Chorpfeilerfiguren im In-
nern des Kölner Doms und den Figürchen der Oberreihe
des genannten Marienstattcr Altarcs an; ich verweise
hinsichtlich der einen freigelassenen Brustseite auf den
324
aus det? fmtyzeit dev gotifcben ptaßtk Kötns
oon
Rudolf Uccccs
Jer vor einigen Monaten erfolgte Tod des Kölner
Regierungspräsidenten Grafen Adelmann zieht
die Veräußerung der Kunstschätze dieses rheinischen
Sammlers nach sich. Der augenblickliche Aufenthalt
seiner Sammlungen in Berlin (die Versteigerung ist Aus-
gang des April bei Paul Cassirer) und der bevorstehende
Besitzwechsel legen es nahe, die große Schnitzfigur der
thronenden Maria mit dem stehenden Kinde, die durch
die Kölner Jahrtausendausstellung 1925 allgemein be-
kannt geworden ist und wohl das Hauptstück des Graf
Adelmann’schen Kunstbesitzes biklete, in die Literatur
einzuführen.
Als Erzeugnis der kölnischen Schnitzerei dokumen-
tiert sich die 112 cm hohe Figur (Abb. 1 u. 2),
deren Provenienz unbekannt ist durch Material,
und Stil in gleicher Weise. Sie ist, wie ein sehr
großer Teii der kölnischen Holzplastik, aus Nuß-
baumholz gefertigt, und wenn man zunächst von
Einzelmerkmaien absieht, so ist das Thema der
sitzenden Gottesmutter mit dem auf ihrem linken
Oberschenkel stehenden Kinde in der üblichen kölni-
schen Weise behandelt: Maria sitzt auf einfacher
kissenbelegter Thronbank mit vorgelcgter dreiseitiger
Stufe, die, wie sehr oft, oben und unten profiliert ist, und
bei dem Kindc handelt es sicli streng genommen nicht
um ein Stehen, sondern um eine Schreitbewegung vom
Throne her auf den Sclioß der Mutter. An Details
müssen der schmale, langgestreckte Gcsiclitstyp mit der
herausgewölbten Stirn und die lockere Ringelung des
Haars Mariä angeführt werden; man findet diese Merk-
male vor allem bei den weiblichen Reliquienbüsten im
Untergcschoß des St. Ursula-Altars zu Maricnstatt im
Westerwald, ftir den Liibbecke in seincr Gesamthcit die
einleuchtende Datierung auf etwa 1325 vorgeschlagen
liat;1) sodann mögen, um ein paar Beispiele zu nennen,
die hl. Katharina des Berliner Kaiser Friedrich-Museums
(Katalog Vögc 1910. Nr. 72) und cinige sitzende Marien
mit stehendem Kinde (eine in Köln, Schnütgenmuseum
und zwei in Nürnberg, Germanisches Museum2) herau-
gezogen werden, allerdings mit der wichtigen Ein-
schränkung, daß die Gesichter bei den vicr letztgenann-
ten Stücken gegenüber der Adelmann’schen Maria eine
gewisse Verrundlichung zeigen. Besondcrs hervor-
gehoben werden muß die Lagerung des Mantels bei un-
serer Figur. Er bedcckt vom Obcrkörper nur die linke
0 Fr. L ii b b e c k c , Die gotischc Kölner Plastik, Straß-
burg 1910 S. 36 ff., Abb. Taf. IV f. Vgl. auch die große Gesamtauf-
nahme des Altars von der Staatl. Bildstelle.
") Abb. bei E. Ltithgen, Die niederrhein. Plastik von der
Gotik bis zur Retiaissance, Straßburg 1917, Taf. XVII, 4 bezw.
bei W. Josephi, Die Werke plastischer Kunst im Germanischen
National-Museum Nürnberg, Niirnberg 1910, Nr. 209 und 210.
Schulter, und der von dieser vorn herabfallende Teil
schneidet sich mit der von der Rückseite über die rechte
Abb. 1
Sammlung Graf Adelmann bei Cassirer-Helbing, Berlin
Hüfte nach vorn vorkommenden Partie unterhalb der
Gürtung; über den Schoß ist der Mantel doppelt gelegt,
so daß ein breiter Zipfel eine Schüsselfalte in deren
lialber Höhe überklettert. Die Art der Manteldrapierung
trifft man bei den steinernen Chorpfeilerfiguren im In-
nern des Kölner Doms und den Figürchen der Oberreihe
des genannten Marienstattcr Altarcs an; ich verweise
hinsichtlich der einen freigelassenen Brustseite auf den
324