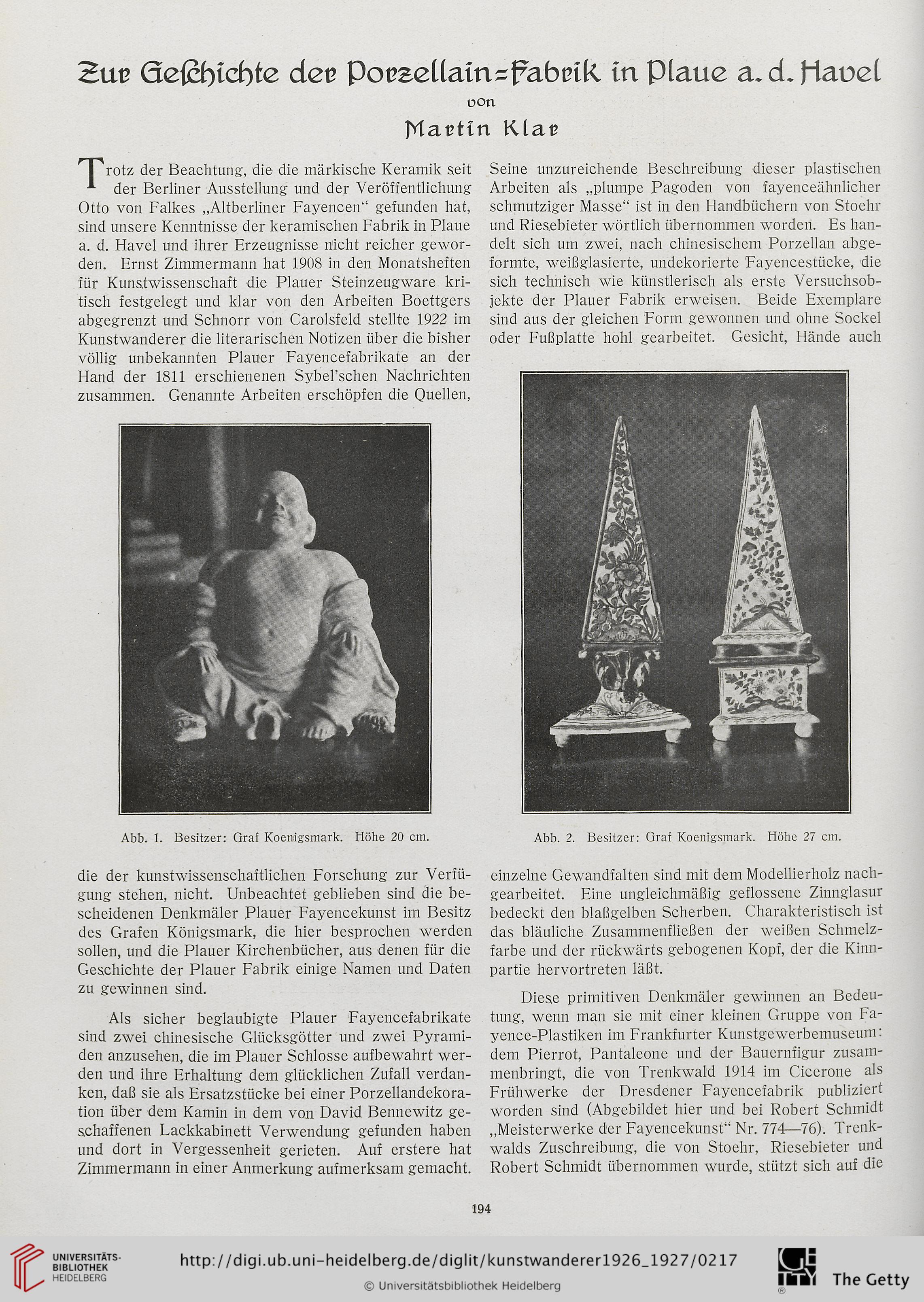Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0217
DOI Heft:
1./2. Januarheft
DOI Artikel:Klar, Martin: Zur Geschichte der Porzellain-Fabrik in Plaue a.d. Havel
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0217
Euc Ge{ebid)te dev PocEettainsfabctk in ptaue a. d. Jiaoet
üon
]Ylacttn Klac
I rotz der Beachtung, die die märkische Keramik seit
* der Berliner Ausstellung und der Veröffentlichung
Otto von Falkes „Altberliner Fayencen“ gefunden hat,
sind unsere Kenntnisse der keramischen Fabrik in Plaue
a. d. Havel und ihrer Erzeugnis.se nicht reicher gewor-
den. Ernst Zimmermann hat 1908 in den Monatsheften
für Kunsiwissenschaft die Plauer Steinzeugware kri-
tisch festgelegt und klar von den Arbeiten Boettgers
abgegrenzt und Schnorr von Carolsfeld stellte 1922 im
Kunstwanderer die literarischen Notizen über die bisher
völlig unbekannten Plauer Fayencefabrikate an der
Hand der 1811 erschienenen Sybel’schen Nachrichten
zusammen. Genannte Arbeiten erschöpfen die Quellen,
Abb. 1. Besitzer: Qraf Koenigsmark. Höhe 20 cm.
die der kunstwissenschaftlichen Forschung zur Verfü-
gung stehen, nicht. Unbeachtet geblieben sind die be-
scheidenen Denkmäler Plauer Fayencekunst im Besitz
des Grafen Königsmark, die hier besprochen werden
sollen, und die Plauer Kirchenbücher, aus denen für die
Geschichte der Plauer Fabrik einige Namen und Daten
zu gewinnen sind.
Als sicher beglaubigte Plauer Fayencefabrikate
sind zwei chinesische Glücksgötter und zwei Pyrami-
den anzusehen, die im Plauer Schlosse aufbewahrt wer-
den und ihre Erhaltung dem glücklichen Zufall verdan-
ken, daß sie als Ersatzstücke bei einer Porzellandekora-
tion über dem Kamin in dem von David Bennewitz ge-
schaffenen Fackkabinett Verwendung gefunden haben
und dort in Vergessenheit gerieten. Auf erstere hat
Zimmermann in einer Anmerkung aufmerksam gemacht.
Seine unzureichende Beschreibung dieser plastischen
Arbeiten als „plumpe Pagoden von fayenceähnlicher
schmutziger Masse“ ist in den Handbüchern von Stoehr
und Riesebieter wörtlich übernommen worden. Es han-
delt sich um zwei, nach chinesischem Porzellan abge-
formte, weißglasierte, undekorierte Fayencestiicke, die
sich technisch wie künstlerisch als erste Versuchsob-
jekte der Plauer Fabrik erweisen. Beide Exemplare
sind aus der gleichen Form gewonnen und ohne Sockel
oder Fußplatte hohl gearbeitet. Gesicht, Hände auch
Abb. 2. Besitzer: Graf Kocnigsmark. Höhe 27 cm.
einzelne Gewandfalten sind mit dem Modellierholz nach-
gearbeitet. Eine ungleichmäßig geflossene Zinnglasur
bedeckt den blaßgelben Scherben. Charakteristisch ist
das bläuliche Zusammeufließen der weißen Schmelz-
farbe und der rückwärts gebogenen Kopf, der die Kinn-
partie hervortreten läßt.
Diese primitiven Denkmäler gewinnen an Bedeu-
tung, wenn man sie mit einer kleinen Gruppe von Fa-
yence-Plastiken im Frankfurter Kunstgewerbemuseum'
dem Pierrot, Pantaleone und der Bauernfigur zusam-
menbringt, die von Trenkwald 1914 im Cicerone als
Frühwerke der Dresdcner Fayencefabrik publiziert
wordeu sind (Abgebildet hier und bei Robert Schmidt
„Meisterwerke der Fayencekunst“ Nr. 774—76). Trenk-
walds Zuschreibung, die von Stoehr, Riesebieter und
Robert Schmidt übernommen wurde, stiitzt sich auf die
194
üon
]Ylacttn Klac
I rotz der Beachtung, die die märkische Keramik seit
* der Berliner Ausstellung und der Veröffentlichung
Otto von Falkes „Altberliner Fayencen“ gefunden hat,
sind unsere Kenntnisse der keramischen Fabrik in Plaue
a. d. Havel und ihrer Erzeugnis.se nicht reicher gewor-
den. Ernst Zimmermann hat 1908 in den Monatsheften
für Kunsiwissenschaft die Plauer Steinzeugware kri-
tisch festgelegt und klar von den Arbeiten Boettgers
abgegrenzt und Schnorr von Carolsfeld stellte 1922 im
Kunstwanderer die literarischen Notizen über die bisher
völlig unbekannten Plauer Fayencefabrikate an der
Hand der 1811 erschienenen Sybel’schen Nachrichten
zusammen. Genannte Arbeiten erschöpfen die Quellen,
Abb. 1. Besitzer: Qraf Koenigsmark. Höhe 20 cm.
die der kunstwissenschaftlichen Forschung zur Verfü-
gung stehen, nicht. Unbeachtet geblieben sind die be-
scheidenen Denkmäler Plauer Fayencekunst im Besitz
des Grafen Königsmark, die hier besprochen werden
sollen, und die Plauer Kirchenbücher, aus denen für die
Geschichte der Plauer Fabrik einige Namen und Daten
zu gewinnen sind.
Als sicher beglaubigte Plauer Fayencefabrikate
sind zwei chinesische Glücksgötter und zwei Pyrami-
den anzusehen, die im Plauer Schlosse aufbewahrt wer-
den und ihre Erhaltung dem glücklichen Zufall verdan-
ken, daß sie als Ersatzstücke bei einer Porzellandekora-
tion über dem Kamin in dem von David Bennewitz ge-
schaffenen Fackkabinett Verwendung gefunden haben
und dort in Vergessenheit gerieten. Auf erstere hat
Zimmermann in einer Anmerkung aufmerksam gemacht.
Seine unzureichende Beschreibung dieser plastischen
Arbeiten als „plumpe Pagoden von fayenceähnlicher
schmutziger Masse“ ist in den Handbüchern von Stoehr
und Riesebieter wörtlich übernommen worden. Es han-
delt sich um zwei, nach chinesischem Porzellan abge-
formte, weißglasierte, undekorierte Fayencestiicke, die
sich technisch wie künstlerisch als erste Versuchsob-
jekte der Plauer Fabrik erweisen. Beide Exemplare
sind aus der gleichen Form gewonnen und ohne Sockel
oder Fußplatte hohl gearbeitet. Gesicht, Hände auch
Abb. 2. Besitzer: Graf Kocnigsmark. Höhe 27 cm.
einzelne Gewandfalten sind mit dem Modellierholz nach-
gearbeitet. Eine ungleichmäßig geflossene Zinnglasur
bedeckt den blaßgelben Scherben. Charakteristisch ist
das bläuliche Zusammeufließen der weißen Schmelz-
farbe und der rückwärts gebogenen Kopf, der die Kinn-
partie hervortreten läßt.
Diese primitiven Denkmäler gewinnen an Bedeu-
tung, wenn man sie mit einer kleinen Gruppe von Fa-
yence-Plastiken im Frankfurter Kunstgewerbemuseum'
dem Pierrot, Pantaleone und der Bauernfigur zusam-
menbringt, die von Trenkwald 1914 im Cicerone als
Frühwerke der Dresdcner Fayencefabrik publiziert
wordeu sind (Abgebildet hier und bei Robert Schmidt
„Meisterwerke der Fayencekunst“ Nr. 774—76). Trenk-
walds Zuschreibung, die von Stoehr, Riesebieter und
Robert Schmidt übernommen wurde, stiitzt sich auf die
194