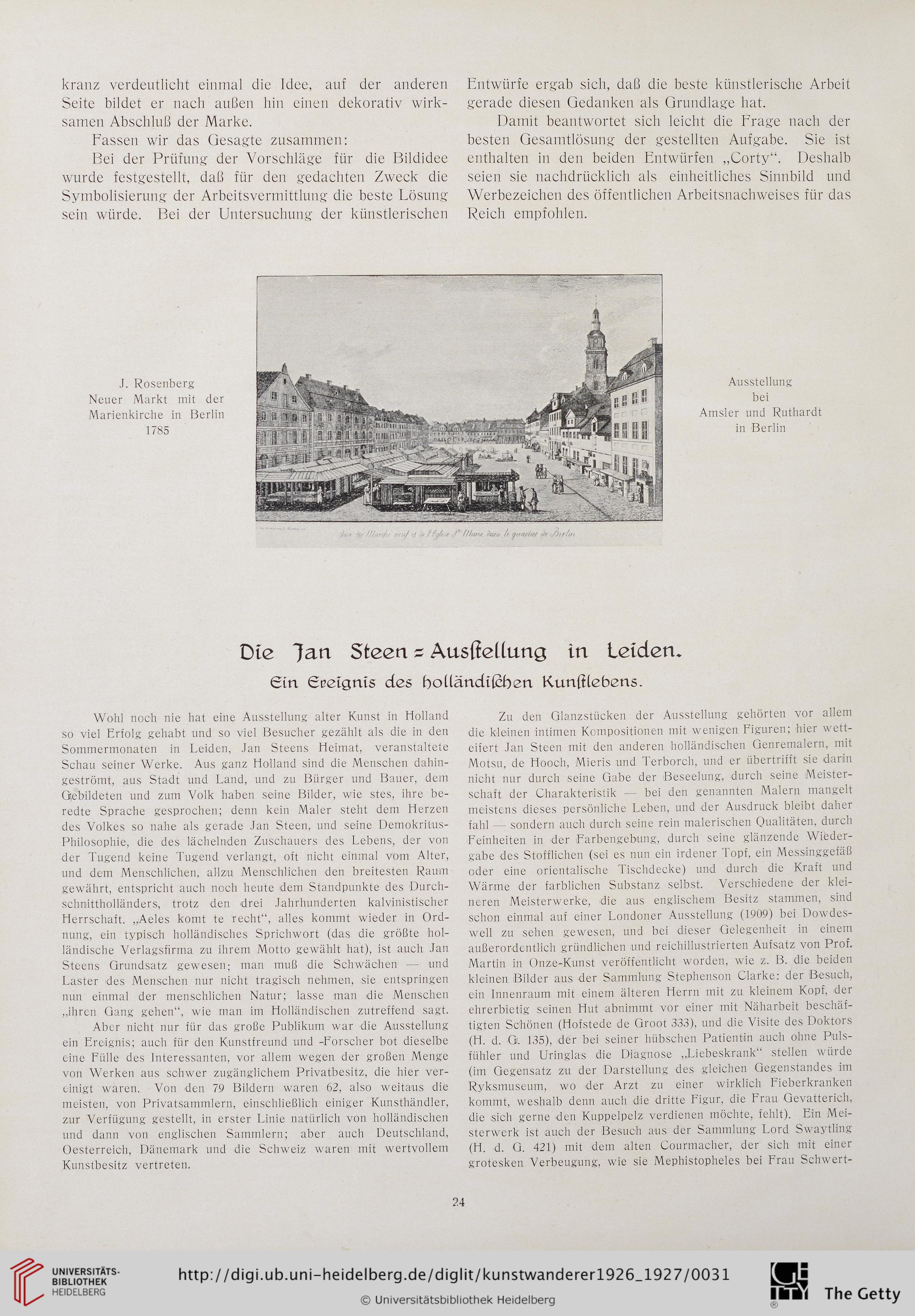kranz verdeutlicht einmal die Idee, auf der anderen
Seite bildet er nach außen hin einen dekorativ wirk-
samen Abschluß der Marke.
Fassen wir das Qesagte zusammen:
Bei der Prüfung der Vorschläge für die Bildidee
wurde festgestellt, daß für den gedachten Zweck die
Symbolisierung der Arbeitsvermittlung die beste Lösung
sein würde. Bei der Untersuchung der künstlerischen
Entwürfe ergab sich, daß die beste künstlerische Arbeit
gerade diesen Gedanken als Grundlage hat.
Damit beantwortet sich leicht die Frage nach der
besten Gesamtlösung der gestellten Aufgabe. Sie ist
enthalten in den beiden Entwürfen „Corty“. Deshalb
seien sie nachdrücklich als einheitliches Sinnbild und
Werbezeichen des öffentlichen Arbeitsnachweises für das
Reich empfohlen.
J. Rosenberg
Neuer Markt mit der
Marienkirche in Berlin
1785
Ausstellung
bei
Amsler und Ruthardt
in Berlin
Dtc lari Steeri r Ausfeltung in teiden.
6in 6t?eignts des bolländiicbzn Kunfttebens.
Wohl noch nie hat eine Ausstellung alter Kunst in Holland
so viel Erfolg gehabt und so viel Besucher gezählt als die in den
Sommermonaten in Leiden, Jan Steens Heimat, veranstaltete
Schau seiner Werke. Aus ganz Holland sind die Menschen dahin-
geströmt, aus Stadt und Land, und zu Bürger und Bauer, dem
Qebildeten und zum Volk haben seine Bilder, wie stes, ihre be-
redte Sprache gesprochen; denn kein Maler steht dem Herzen
des Volkes so nahe als gerade Jan Steen, und seine Demokritus-
Philosophie, die des lächelnden Zuschauers des Lebens, der von
der Tugend keine Tugend verlangt, oft nicht einmal vom Alter,
und dem Menschlichen, allzu Menschlichen den breitesten Raum
gewährt, entspricht auch noch heute dem Standpunkte des Durch-
schnittholländers, trotz den drei Jahrhunderten kalvinistischer
Herrschaft. „Aeles komt te recht“, alles kommt wieder in Ord-
nung, ein typisch holländisches Sprichwort (das die größte hol-
iändische Verlagsfirma zu ihrem Motto gewählt hat), ist auch Jan
Steens Grundsatz gewesen; man muß die Schwächen — und
Laster des Menschen nur nicht tragisch nehmen, sie entspringen
nun einmal der menschlichen Natur; lasse man die Menschen
„ihren Qang gehen“, wie man im Holländischen zutreffend sagt.
Aber nicht nur ftir das große Publikum war die Ausstellung
ein Ereignis; auch ftir den Kunstfreund und -Forscher bot dieselbe
eine Fiiile des Interessanten, vor allem wegen der großen Menge
von Werken aus schwer zugänglichem Privatbesitz, die hier ver-
einigt waren. Von den 79 Bildern waren 62, also weitaus die
meisten, von Privatsammlern, einschließlich einiger Kunsthändler,
zur Verfügung gestellt, in erster Linie natürlich von holländischen
und dann von englischen Sammlern; aber auch Deutschland,
Oesterreich, Dänemark und die Schweiz waren mit wertvollem
Kunstbesitz vertreten.
Zu den Glanzstticken der Ausstellung gehörten vor allem
die kleinen intimen Kompositionen mit wenigen Figuren; hier wett-
eifert Jan Steen mit den anderen holländischen Genremalern, mit
Motsu, de Hooch, Mieris und Terborch, und er übertrifft sie darin
nicht nur durch seine Gabe der Beseelung, durch seine Meister-
schaft der Charakteristik — bei den genannten Malern mangelt
meistens dieses persönliche Leben, und der Ausdruck bleibt daher
fahl — sondern auch durch seine rein malerischen Qnalitäten, durch
Feinheiten in der Farbengebung, durch seine glänzende Wieder-
gabe des Stofflichen (sei es nun ein irdener Topf, ein Messlnggefäß
oder eine orientalische Tischdecke) und durch die Kraft und
Wärme der farblichen Substanz selbst. Verschiedene der klei-
neren Meisterwerke, die aus englischem Besitz stammen, sind
schon einmal auf einer Londoner Ausstellung (1909) bei Dowdes-
well zu sehen gewesen, und bei dieser Gelegenheit in einem
außerordentlich gründlicben und reichillustrierten Aufsatz von Prof.
Martin in Onze-Kunst veröffentlicht worden, wie z. B. die beiden
kleinen Bilder aus der Sammlung Stephenson Clarke: der Besuch,
ein Innenraum mit einem älteren Herrn mit zu kleinem Kopf, der
ehrerbietig seinen Hut abnimmt vor einer mit Näharbeit beschäf-
tigten Schönen (Hofstede de Groot 333), und die Visite des Doktors
(H. d. G. 135), der bei seiner hübschen Patientin auch ohne Puls-
fühler und Uringlas die Diagnose „Liebeskrank“ stellen würde
(iin Gegensatz zu der Darsteliung des gleichen Gegenstandes im
Ryksmuseum, wo der Arzt zu einer wirklich Fieberkranken
kommt, weshalb denn auch die dritte Figur, die Frau Gevatterich,
die sich gerne den Kuppelpeiz verdienen möchte, fehlt). Ein Mei-
sterwerk ist auch der Besuch aus der Sammlung Lord Swaytling
(H. d. G. 421) mit dem alten Courmacher, der sich mit einer
grotesken Verbeugung, wie sie Mephistopheles bei Frau Schwert-
24
Seite bildet er nach außen hin einen dekorativ wirk-
samen Abschluß der Marke.
Fassen wir das Qesagte zusammen:
Bei der Prüfung der Vorschläge für die Bildidee
wurde festgestellt, daß für den gedachten Zweck die
Symbolisierung der Arbeitsvermittlung die beste Lösung
sein würde. Bei der Untersuchung der künstlerischen
Entwürfe ergab sich, daß die beste künstlerische Arbeit
gerade diesen Gedanken als Grundlage hat.
Damit beantwortet sich leicht die Frage nach der
besten Gesamtlösung der gestellten Aufgabe. Sie ist
enthalten in den beiden Entwürfen „Corty“. Deshalb
seien sie nachdrücklich als einheitliches Sinnbild und
Werbezeichen des öffentlichen Arbeitsnachweises für das
Reich empfohlen.
J. Rosenberg
Neuer Markt mit der
Marienkirche in Berlin
1785
Ausstellung
bei
Amsler und Ruthardt
in Berlin
Dtc lari Steeri r Ausfeltung in teiden.
6in 6t?eignts des bolländiicbzn Kunfttebens.
Wohl noch nie hat eine Ausstellung alter Kunst in Holland
so viel Erfolg gehabt und so viel Besucher gezählt als die in den
Sommermonaten in Leiden, Jan Steens Heimat, veranstaltete
Schau seiner Werke. Aus ganz Holland sind die Menschen dahin-
geströmt, aus Stadt und Land, und zu Bürger und Bauer, dem
Qebildeten und zum Volk haben seine Bilder, wie stes, ihre be-
redte Sprache gesprochen; denn kein Maler steht dem Herzen
des Volkes so nahe als gerade Jan Steen, und seine Demokritus-
Philosophie, die des lächelnden Zuschauers des Lebens, der von
der Tugend keine Tugend verlangt, oft nicht einmal vom Alter,
und dem Menschlichen, allzu Menschlichen den breitesten Raum
gewährt, entspricht auch noch heute dem Standpunkte des Durch-
schnittholländers, trotz den drei Jahrhunderten kalvinistischer
Herrschaft. „Aeles komt te recht“, alles kommt wieder in Ord-
nung, ein typisch holländisches Sprichwort (das die größte hol-
iändische Verlagsfirma zu ihrem Motto gewählt hat), ist auch Jan
Steens Grundsatz gewesen; man muß die Schwächen — und
Laster des Menschen nur nicht tragisch nehmen, sie entspringen
nun einmal der menschlichen Natur; lasse man die Menschen
„ihren Qang gehen“, wie man im Holländischen zutreffend sagt.
Aber nicht nur ftir das große Publikum war die Ausstellung
ein Ereignis; auch ftir den Kunstfreund und -Forscher bot dieselbe
eine Fiiile des Interessanten, vor allem wegen der großen Menge
von Werken aus schwer zugänglichem Privatbesitz, die hier ver-
einigt waren. Von den 79 Bildern waren 62, also weitaus die
meisten, von Privatsammlern, einschließlich einiger Kunsthändler,
zur Verfügung gestellt, in erster Linie natürlich von holländischen
und dann von englischen Sammlern; aber auch Deutschland,
Oesterreich, Dänemark und die Schweiz waren mit wertvollem
Kunstbesitz vertreten.
Zu den Glanzstticken der Ausstellung gehörten vor allem
die kleinen intimen Kompositionen mit wenigen Figuren; hier wett-
eifert Jan Steen mit den anderen holländischen Genremalern, mit
Motsu, de Hooch, Mieris und Terborch, und er übertrifft sie darin
nicht nur durch seine Gabe der Beseelung, durch seine Meister-
schaft der Charakteristik — bei den genannten Malern mangelt
meistens dieses persönliche Leben, und der Ausdruck bleibt daher
fahl — sondern auch durch seine rein malerischen Qnalitäten, durch
Feinheiten in der Farbengebung, durch seine glänzende Wieder-
gabe des Stofflichen (sei es nun ein irdener Topf, ein Messlnggefäß
oder eine orientalische Tischdecke) und durch die Kraft und
Wärme der farblichen Substanz selbst. Verschiedene der klei-
neren Meisterwerke, die aus englischem Besitz stammen, sind
schon einmal auf einer Londoner Ausstellung (1909) bei Dowdes-
well zu sehen gewesen, und bei dieser Gelegenheit in einem
außerordentlich gründlicben und reichillustrierten Aufsatz von Prof.
Martin in Onze-Kunst veröffentlicht worden, wie z. B. die beiden
kleinen Bilder aus der Sammlung Stephenson Clarke: der Besuch,
ein Innenraum mit einem älteren Herrn mit zu kleinem Kopf, der
ehrerbietig seinen Hut abnimmt vor einer mit Näharbeit beschäf-
tigten Schönen (Hofstede de Groot 333), und die Visite des Doktors
(H. d. G. 135), der bei seiner hübschen Patientin auch ohne Puls-
fühler und Uringlas die Diagnose „Liebeskrank“ stellen würde
(iin Gegensatz zu der Darsteliung des gleichen Gegenstandes im
Ryksmuseum, wo der Arzt zu einer wirklich Fieberkranken
kommt, weshalb denn auch die dritte Figur, die Frau Gevatterich,
die sich gerne den Kuppelpeiz verdienen möchte, fehlt). Ein Mei-
sterwerk ist auch der Besuch aus der Sammlung Lord Swaytling
(H. d. G. 421) mit dem alten Courmacher, der sich mit einer
grotesken Verbeugung, wie sie Mephistopheles bei Frau Schwert-
24