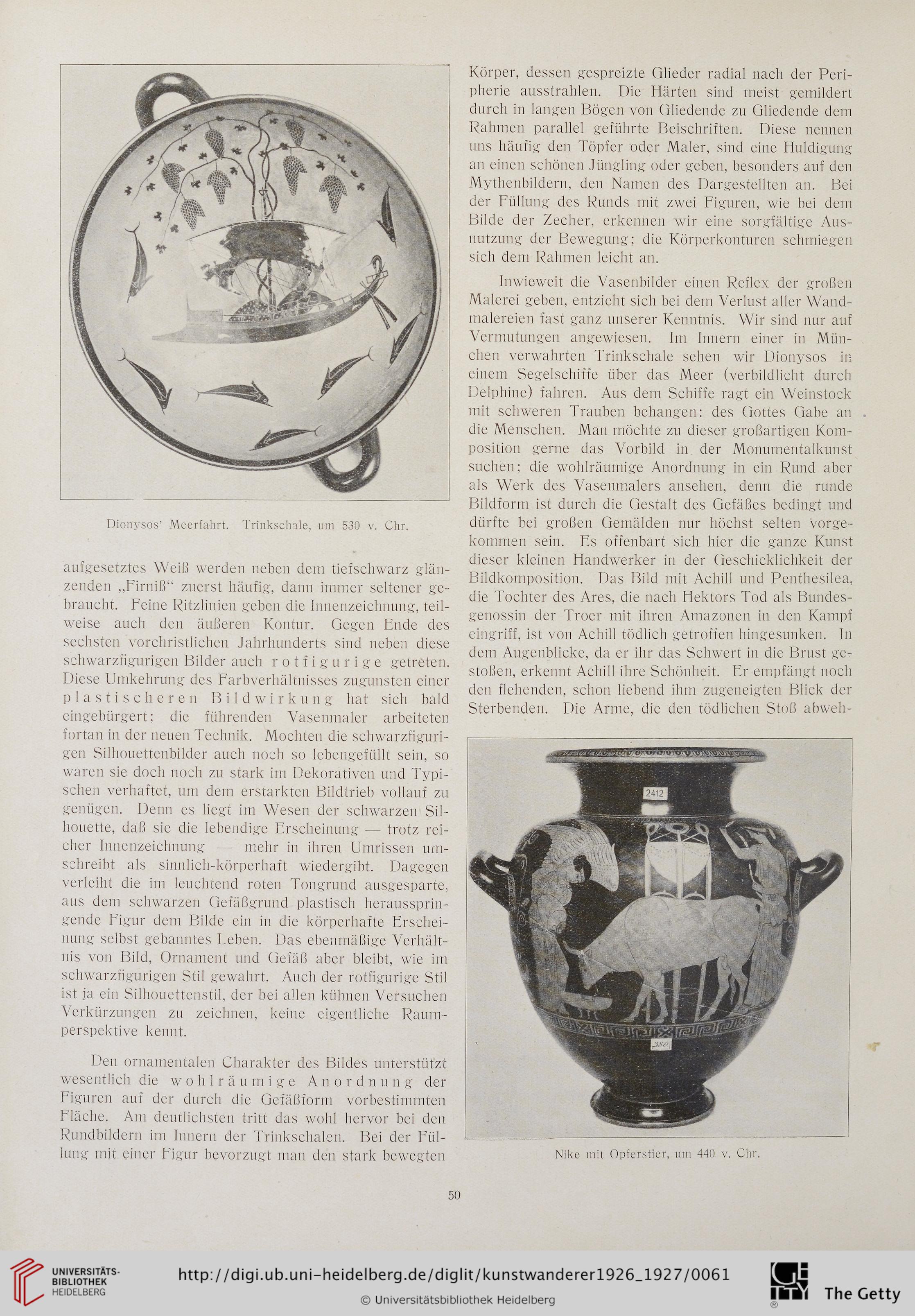Dionysos’ Meerfahrt. Trinkschale, um 530 v. Chr.
aufgesetztes Weiß werden neben dem tiefschwarz glän-
zenden „Firniß“ zuerst häufig, dann immcr seltener ge-
braucht. Fcine Ritzlinien geben die Innenzeichnung, teil-
weise auch den äußeren Kontur. Gegen Ende des
sechsten vorchristlichen Jahrhunderts sind nebcn diese
schwarzfigurigen Bilder auch r o t f i g u r i g c getreten.
Diese Umkehrung des Farbverhältnisses zugunsten einer
p 1 a s t i s c h e r e n Bildwirkung hat sich bald
eingebürgert; die führenden Vasenmaler arbeiteten
fortan in der neuen Technik. Mochten die schwarzfiguri-
gen Silhouettenbilder auch noch so lebengeftillt sein, so
waren sie doch noch zu stark im Dekorativen und Typi-
schen vcrhaftet, um dem erstarkten Bildtrieb vollauf zu
genügen. Denn es liegt im Wesen der schwarzen Sil-
houette, daß sie die lebendige Erscheinung — trotz rei-
cher Innenzeichnung ■—- mclir in ihren Umrisscn um-
schreibt als sinnlich-körperhaft wiedergibt. Dagegen
verleiht die im leuchtend roten Tongrund ausgesparte,
aus dem schwarzen Gefäßgrund plastisch heraussprin-
gende Figur dem Bilde ein in die körperhafte Erschei-
nung selbst gebanntes Leben. Das ebenmäßige Verhält-
nis von Bild, Grnament und Gefäß aber blcibt, wie im
schwarzfigurigen Stil gcwahrt. Auch der rotfigurige Stil
ist ja ein Silhouettenstil, der bei allen kühnen Versuchen
Verkürzungen zu zeichnen, keine eigentliche Raum-
perspektive kennt.
Den ornamentalcn Charakter des Bildes unterstützt
wesentlich die w o h 1 r ä u m i g e A n o r d n u n g der
Figuren auf der durch die Gefäßform vorbestimmten
Fläche. Am deutlichsten tritt das wohl hervor bei den
Rundbildern im Innern dcr Trinkschalen. Bei der Fiil-
lung mit einer Figur bevorzugt man den stark bewcgteu
Körper, dcssen gespreizte Glieder radial nacli der Peri-
pherie ausstrahlen. Die Härten sind mcist gemildert
durch in langen Bögen von Gliedende zu Glicdende dem
Rahrnen parallcl geführte Beischriften. Diese nennen
uns liäufig den Töpfer odcr Maler, sind eine Huldigung
an einen schönen Jüngling oder geben, besonders auf den
Mythenbildern, den Namen dcs Dargestellten an. Bei
der Füllung des Runds mit zwei Figuren, wie bei dem
Bilde der Zecher, erkennen wir eiue sorgfältige Aus-
nutzung der Bewegung; die Körperkonturen schmiegen
sich dem Rahmen leidit an.
Imvieweit die Vasenbilder einen Reflex der großen
Malerci geben, entzieht sich bei dem Verlust aller Wand-
malereien fast ganz unserer Kenntnis. Wir sind nur auf
Vermutungen angewiesen. Im Innern einer in Mün-
chen verwahrten Trinkschale sehen wir Dionysos in
eincm Segelschiffe über das Meer (verbildlicht durch
Delphine) fahren. Aus dem Schiffe ragt ein Weinstock
mit schweren Trauben behangen: des Gottes Gabe an
die Menschen. Man möchte zu dieser großartigen Kom-
position gerne das Vorbild in der Monumentalkunst
suchen; die wohlräumige Anordnung in ein Rund aber
als Werk des Vasenmalers ansehen, denn die runde
Bildform ist durch dic Gestalt des Gefäßes bedingt und
diirfte bei großen Gemälden nur höchst selten vorge-
kommen sein. Es offenbart sich hier die ganze Kunst
dieser kleinen Handwerker in der Geschicldichkeit der
Bildkomposition. Das Bild mit Achill und Penthesilea,
die Tochter des Ares, die nach Hektors Tod als Bundes-
genossin der Troer mit ihren Amazonen in den Kampf
eingriff, ist von Achill tödlich getroffen hingesunken. In
dem Augenblicke, da er ihr das Schwert in die Brust ge-
stoßen, erkennt Achill ilirc Schönhcit. Er empfängt noch
den flehenden, sclion liebend ihm zugeneigten Blick der
Sterbenden. Die Arme, die den tödlichen Stoß abweh-
Nike mit Opferstier, um 440 v. C11r.
50
aufgesetztes Weiß werden neben dem tiefschwarz glän-
zenden „Firniß“ zuerst häufig, dann immcr seltener ge-
braucht. Fcine Ritzlinien geben die Innenzeichnung, teil-
weise auch den äußeren Kontur. Gegen Ende des
sechsten vorchristlichen Jahrhunderts sind nebcn diese
schwarzfigurigen Bilder auch r o t f i g u r i g c getreten.
Diese Umkehrung des Farbverhältnisses zugunsten einer
p 1 a s t i s c h e r e n Bildwirkung hat sich bald
eingebürgert; die führenden Vasenmaler arbeiteten
fortan in der neuen Technik. Mochten die schwarzfiguri-
gen Silhouettenbilder auch noch so lebengeftillt sein, so
waren sie doch noch zu stark im Dekorativen und Typi-
schen vcrhaftet, um dem erstarkten Bildtrieb vollauf zu
genügen. Denn es liegt im Wesen der schwarzen Sil-
houette, daß sie die lebendige Erscheinung — trotz rei-
cher Innenzeichnung ■—- mclir in ihren Umrisscn um-
schreibt als sinnlich-körperhaft wiedergibt. Dagegen
verleiht die im leuchtend roten Tongrund ausgesparte,
aus dem schwarzen Gefäßgrund plastisch heraussprin-
gende Figur dem Bilde ein in die körperhafte Erschei-
nung selbst gebanntes Leben. Das ebenmäßige Verhält-
nis von Bild, Grnament und Gefäß aber blcibt, wie im
schwarzfigurigen Stil gcwahrt. Auch der rotfigurige Stil
ist ja ein Silhouettenstil, der bei allen kühnen Versuchen
Verkürzungen zu zeichnen, keine eigentliche Raum-
perspektive kennt.
Den ornamentalcn Charakter des Bildes unterstützt
wesentlich die w o h 1 r ä u m i g e A n o r d n u n g der
Figuren auf der durch die Gefäßform vorbestimmten
Fläche. Am deutlichsten tritt das wohl hervor bei den
Rundbildern im Innern dcr Trinkschalen. Bei der Fiil-
lung mit einer Figur bevorzugt man den stark bewcgteu
Körper, dcssen gespreizte Glieder radial nacli der Peri-
pherie ausstrahlen. Die Härten sind mcist gemildert
durch in langen Bögen von Gliedende zu Glicdende dem
Rahrnen parallcl geführte Beischriften. Diese nennen
uns liäufig den Töpfer odcr Maler, sind eine Huldigung
an einen schönen Jüngling oder geben, besonders auf den
Mythenbildern, den Namen dcs Dargestellten an. Bei
der Füllung des Runds mit zwei Figuren, wie bei dem
Bilde der Zecher, erkennen wir eiue sorgfältige Aus-
nutzung der Bewegung; die Körperkonturen schmiegen
sich dem Rahmen leidit an.
Imvieweit die Vasenbilder einen Reflex der großen
Malerci geben, entzieht sich bei dem Verlust aller Wand-
malereien fast ganz unserer Kenntnis. Wir sind nur auf
Vermutungen angewiesen. Im Innern einer in Mün-
chen verwahrten Trinkschale sehen wir Dionysos in
eincm Segelschiffe über das Meer (verbildlicht durch
Delphine) fahren. Aus dem Schiffe ragt ein Weinstock
mit schweren Trauben behangen: des Gottes Gabe an
die Menschen. Man möchte zu dieser großartigen Kom-
position gerne das Vorbild in der Monumentalkunst
suchen; die wohlräumige Anordnung in ein Rund aber
als Werk des Vasenmalers ansehen, denn die runde
Bildform ist durch dic Gestalt des Gefäßes bedingt und
diirfte bei großen Gemälden nur höchst selten vorge-
kommen sein. Es offenbart sich hier die ganze Kunst
dieser kleinen Handwerker in der Geschicldichkeit der
Bildkomposition. Das Bild mit Achill und Penthesilea,
die Tochter des Ares, die nach Hektors Tod als Bundes-
genossin der Troer mit ihren Amazonen in den Kampf
eingriff, ist von Achill tödlich getroffen hingesunken. In
dem Augenblicke, da er ihr das Schwert in die Brust ge-
stoßen, erkennt Achill ilirc Schönhcit. Er empfängt noch
den flehenden, sclion liebend ihm zugeneigten Blick der
Sterbenden. Die Arme, die den tödlichen Stoß abweh-
Nike mit Opferstier, um 440 v. C11r.
50