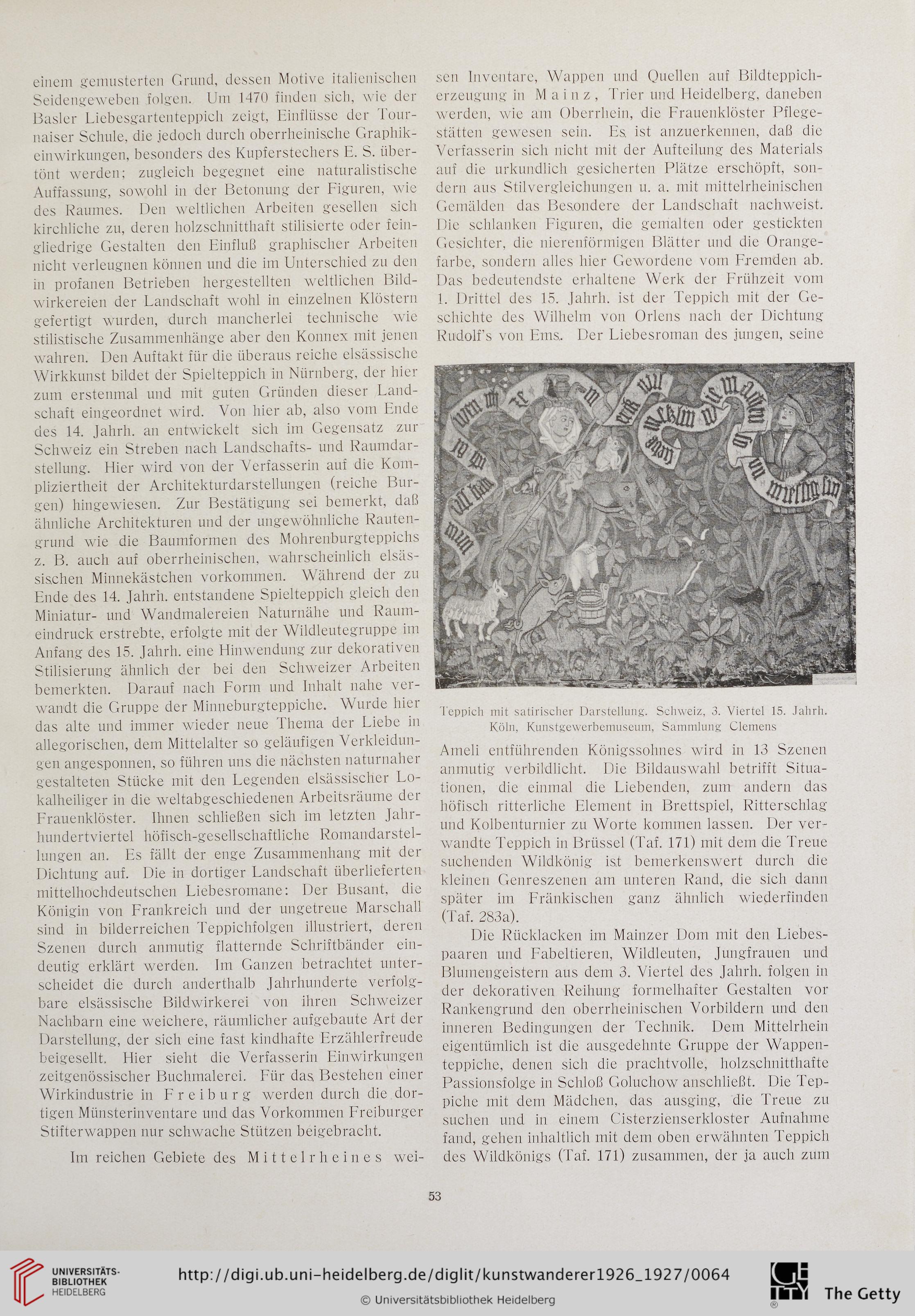einem gemusterten Grund, dessen Motivc italienisclien
Seidengeweben folgen. Um 1470 finden sich, wie der
Basler Liebesgartenteppicli zeigt, Einfliisse der Tour-
naiser Schule, die jedocli durch oberrheinische Graphik-
einwirkungen, besonders des Kupferstechers E. S. iiber-
tönt werden; zugleich begegnet eine naturalistische
Auffassung, sowohl in der Betonung der Figuren, wie
des Raumes. Den weltlichen Arbeiten gesellen sich
kirchliche zu, deren holzschnitthaft stilisierte oder fein-
gliedrige Gestalten den Einfluß graphischer Arbeiten
nicht verleugnen können und die im Unterschied zu den
in profanen Betrieben hergestellten weltlichen Bild-
wirkereien der Landsehaft wohl in einzelnen Klöstern
gefertigt wurden, durch mancherlei technische wie
stilis.tische Zusammenhänge aber den Konnex mit jenen
waliren. Den Auftakt für die überaus reiclie elsässische
Wirkkunst bildet der Spielteppich in Nürnberg, der hier
zum erstenmal und mit guten Gründen dieser Land-
schaft eingeordnet wird. Von hier ab, also vom Ende
des 14. Jahrh. an entwickelt sich im Gegensatz zur
Schweiz ein Streben nach Landsehafts- und Raumdar-
stellung. Hier wird von der 'Verfasserin auf die Kom-
pliziertheit der Architekturdarstellungen (reiclie Bur-
gen) hingewiesen. Zur Bestätigung sei bemerkt, daß
ähnliche Architekturen und der ungewöhnliche Rauten-
grund wie die Baumformen des Mohrenburgteppichs
z. B. auch auf oberrheinischen, wahrscheinlich elsäs-
sischen Minnekästchen vorkommen. Während der zu
Ende des 14. Jahrh. entstandene Spielteppich gleich den
Miniatur- und Wandmalereien Naturnähe und Raum-
eindruck erstrebte, erfolgte mit der Wildleutegruppe im
Anfang des 15. Jahrh. eine Hinwendung zur dekorativen
Stilisierung ähnlich der bei den Schweizer Arbeiten
bemerkten. Darauf nach Form und Inhalt nahe ver-
wandt die Gruppe der Minpeburgteppiche. Wurde hier
das alte und immer wieder neue Thema der Liebe in
allegorischen, dem Mittelalter so geläufigen Verkleidun-
gen angesponnen, so führen uns die nächsten naturnaher
gestalteten Stücke mit den Legenden elsässischer Lo-
kalheiliger in die weltabgeschiedenen Arbeitsräume der
Frauenklöster. Ihnen schließen sich im letzten Jahr-
hundertviertel hÖfisch-gesellschaftliche Romandarstel-
lungen an. Es fällt der enge Zusammenhang mit der
Dichtung auf. Die in dortiger Landschaft überlieferten
mittelhochdeutschen Liebesromane: Der Busant, die
Königin von Frankreich und der ungetreue Marschall
sind in bilderreichen Teppichfolgen illustriert, deren
Szenen durch anmutig flatternde Schriftbänder ein-
deutig erklärt werden. Im Ganzen betrachtet unter-
scheidet die durch anderthalb Jahrhunderte verfolg-
bare elsässische Bildwirkerei von ihren Schweizer
Nachbarn eine weichere, räumlicher aufgebaute Art der
Darstellung, der sich eine fas.t kindhafte Erzählerfreude
beigesellt. Hier sieht die Verfasserin Einwirkungen
zeitgenössischer Buchmalerei. Für das. Bestehen einer
Wirkindustrie in F r e i b u r g werden durch die dor-
tigen Münsterinventare und das Vorkommen Freiburger
Stifterwappen nur schwache Stützen beigebracht.
Im reichen Gebiete des M i 11 c 1 r h e i n e s wei-
sen Inventare, Wappen und Oucllen auf Bildteppich-
erzeugung in M a i n z , Trier und Heidelberg, daneben
werden, wie am Oberrhein, die Frauenklöster Pflege-
stätten gewesen sein. Es. ist anzuerkennen, daß die
Verfasserin sich nicht mit der Aufteilung des Materials
auf die urkundlich gesicherten Plätze erschöpft, son-
dern aus Stilvergleichungen u. a. mit mittelrheinischen
Gemälden das Beaondere der Landschaft nachweist.
Die schlanken Figuren, die gemalten oder gestickten
Gesichter, die nierenförmigen Blätter und die Orange-
farbe, sondern alles hier Gewordenc vom Fremden ab.
Das bedeutendste erhaltene Werk der Frühzeit vom
1. Drittel des 15. Jalirli. ist der Teppich mit der Ge-
schichtc des Wilhelm von Orlens nach der Dichtung
Rudolf’s von Ems, Der Liebesroman des jungen, seine
Teppich mit satirischer Darstellung. Schweiz, 3. Viertel 15. Jahrh.
Koln, Kunstgewerbemuseum, Sammlung Clemens
Ameli entführenden Königssolmes wird in 13 Szcnen
anmutig verbildlicht. Die Bildauswahl betrifft Situa-
tionen, die einmal die Liebenden, zum andern das
höfisch ritterliche Element in Brettspiel, Ritterschlag
und Kolbenturnier zu Worte kommen lassen. Der ver-
wandte Teppich in Brüssel (Taf. 171) mit dem die Treue
suchenden Wildkönig is.t bemerkenswert durch die
kleinen Genreszenen am unteren Rand, die sicli dann
später im Fränkischen ganz ähnlich wiederfinden
(Taf. 283a).
Die Rücklacken im Mainzer Dom mit den Liebes-
paaren und Fabeltieren, Wildleuten, Jungfrauen und
Blumengeistern aus dem 3. Viertel des Jalirh. folgen in
der dekorativen Reihung formelhafter Gestalten vor
Rankengrund den oberrheinischen Vorbildern und den
inneren Bedingungen der Technik. Dem Mittelrhein
eigentümlich ist die ausgedehnte Gruppe der Wappen-
teppichc, denen sich die prachtvolle, holzs.chnitthafte
Passionsfolge in Schloß Golucliow anschließt. Die Tep-
piche mit dem Mädchen, das ausging, die Treue zu
suclien und in einem Cistcrzienserkloster Aufnahme
fand, gehen inhaltlich mit dem oben erwähnten Teppich
des Wildkönigs (Taf. 171) zusammen, der ja auch zum
53
Seidengeweben folgen. Um 1470 finden sich, wie der
Basler Liebesgartenteppicli zeigt, Einfliisse der Tour-
naiser Schule, die jedocli durch oberrheinische Graphik-
einwirkungen, besonders des Kupferstechers E. S. iiber-
tönt werden; zugleich begegnet eine naturalistische
Auffassung, sowohl in der Betonung der Figuren, wie
des Raumes. Den weltlichen Arbeiten gesellen sich
kirchliche zu, deren holzschnitthaft stilisierte oder fein-
gliedrige Gestalten den Einfluß graphischer Arbeiten
nicht verleugnen können und die im Unterschied zu den
in profanen Betrieben hergestellten weltlichen Bild-
wirkereien der Landsehaft wohl in einzelnen Klöstern
gefertigt wurden, durch mancherlei technische wie
stilis.tische Zusammenhänge aber den Konnex mit jenen
waliren. Den Auftakt für die überaus reiclie elsässische
Wirkkunst bildet der Spielteppich in Nürnberg, der hier
zum erstenmal und mit guten Gründen dieser Land-
schaft eingeordnet wird. Von hier ab, also vom Ende
des 14. Jahrh. an entwickelt sich im Gegensatz zur
Schweiz ein Streben nach Landsehafts- und Raumdar-
stellung. Hier wird von der 'Verfasserin auf die Kom-
pliziertheit der Architekturdarstellungen (reiclie Bur-
gen) hingewiesen. Zur Bestätigung sei bemerkt, daß
ähnliche Architekturen und der ungewöhnliche Rauten-
grund wie die Baumformen des Mohrenburgteppichs
z. B. auch auf oberrheinischen, wahrscheinlich elsäs-
sischen Minnekästchen vorkommen. Während der zu
Ende des 14. Jahrh. entstandene Spielteppich gleich den
Miniatur- und Wandmalereien Naturnähe und Raum-
eindruck erstrebte, erfolgte mit der Wildleutegruppe im
Anfang des 15. Jahrh. eine Hinwendung zur dekorativen
Stilisierung ähnlich der bei den Schweizer Arbeiten
bemerkten. Darauf nach Form und Inhalt nahe ver-
wandt die Gruppe der Minpeburgteppiche. Wurde hier
das alte und immer wieder neue Thema der Liebe in
allegorischen, dem Mittelalter so geläufigen Verkleidun-
gen angesponnen, so führen uns die nächsten naturnaher
gestalteten Stücke mit den Legenden elsässischer Lo-
kalheiliger in die weltabgeschiedenen Arbeitsräume der
Frauenklöster. Ihnen schließen sich im letzten Jahr-
hundertviertel hÖfisch-gesellschaftliche Romandarstel-
lungen an. Es fällt der enge Zusammenhang mit der
Dichtung auf. Die in dortiger Landschaft überlieferten
mittelhochdeutschen Liebesromane: Der Busant, die
Königin von Frankreich und der ungetreue Marschall
sind in bilderreichen Teppichfolgen illustriert, deren
Szenen durch anmutig flatternde Schriftbänder ein-
deutig erklärt werden. Im Ganzen betrachtet unter-
scheidet die durch anderthalb Jahrhunderte verfolg-
bare elsässische Bildwirkerei von ihren Schweizer
Nachbarn eine weichere, räumlicher aufgebaute Art der
Darstellung, der sich eine fas.t kindhafte Erzählerfreude
beigesellt. Hier sieht die Verfasserin Einwirkungen
zeitgenössischer Buchmalerei. Für das. Bestehen einer
Wirkindustrie in F r e i b u r g werden durch die dor-
tigen Münsterinventare und das Vorkommen Freiburger
Stifterwappen nur schwache Stützen beigebracht.
Im reichen Gebiete des M i 11 c 1 r h e i n e s wei-
sen Inventare, Wappen und Oucllen auf Bildteppich-
erzeugung in M a i n z , Trier und Heidelberg, daneben
werden, wie am Oberrhein, die Frauenklöster Pflege-
stätten gewesen sein. Es. ist anzuerkennen, daß die
Verfasserin sich nicht mit der Aufteilung des Materials
auf die urkundlich gesicherten Plätze erschöpft, son-
dern aus Stilvergleichungen u. a. mit mittelrheinischen
Gemälden das Beaondere der Landschaft nachweist.
Die schlanken Figuren, die gemalten oder gestickten
Gesichter, die nierenförmigen Blätter und die Orange-
farbe, sondern alles hier Gewordenc vom Fremden ab.
Das bedeutendste erhaltene Werk der Frühzeit vom
1. Drittel des 15. Jalirli. ist der Teppich mit der Ge-
schichtc des Wilhelm von Orlens nach der Dichtung
Rudolf’s von Ems, Der Liebesroman des jungen, seine
Teppich mit satirischer Darstellung. Schweiz, 3. Viertel 15. Jahrh.
Koln, Kunstgewerbemuseum, Sammlung Clemens
Ameli entführenden Königssolmes wird in 13 Szcnen
anmutig verbildlicht. Die Bildauswahl betrifft Situa-
tionen, die einmal die Liebenden, zum andern das
höfisch ritterliche Element in Brettspiel, Ritterschlag
und Kolbenturnier zu Worte kommen lassen. Der ver-
wandte Teppich in Brüssel (Taf. 171) mit dem die Treue
suchenden Wildkönig is.t bemerkenswert durch die
kleinen Genreszenen am unteren Rand, die sicli dann
später im Fränkischen ganz ähnlich wiederfinden
(Taf. 283a).
Die Rücklacken im Mainzer Dom mit den Liebes-
paaren und Fabeltieren, Wildleuten, Jungfrauen und
Blumengeistern aus dem 3. Viertel des Jalirh. folgen in
der dekorativen Reihung formelhafter Gestalten vor
Rankengrund den oberrheinischen Vorbildern und den
inneren Bedingungen der Technik. Dem Mittelrhein
eigentümlich ist die ausgedehnte Gruppe der Wappen-
teppichc, denen sich die prachtvolle, holzs.chnitthafte
Passionsfolge in Schloß Golucliow anschließt. Die Tep-
piche mit dem Mädchen, das ausging, die Treue zu
suclien und in einem Cistcrzienserkloster Aufnahme
fand, gehen inhaltlich mit dem oben erwähnten Teppich
des Wildkönigs (Taf. 171) zusammen, der ja auch zum
53