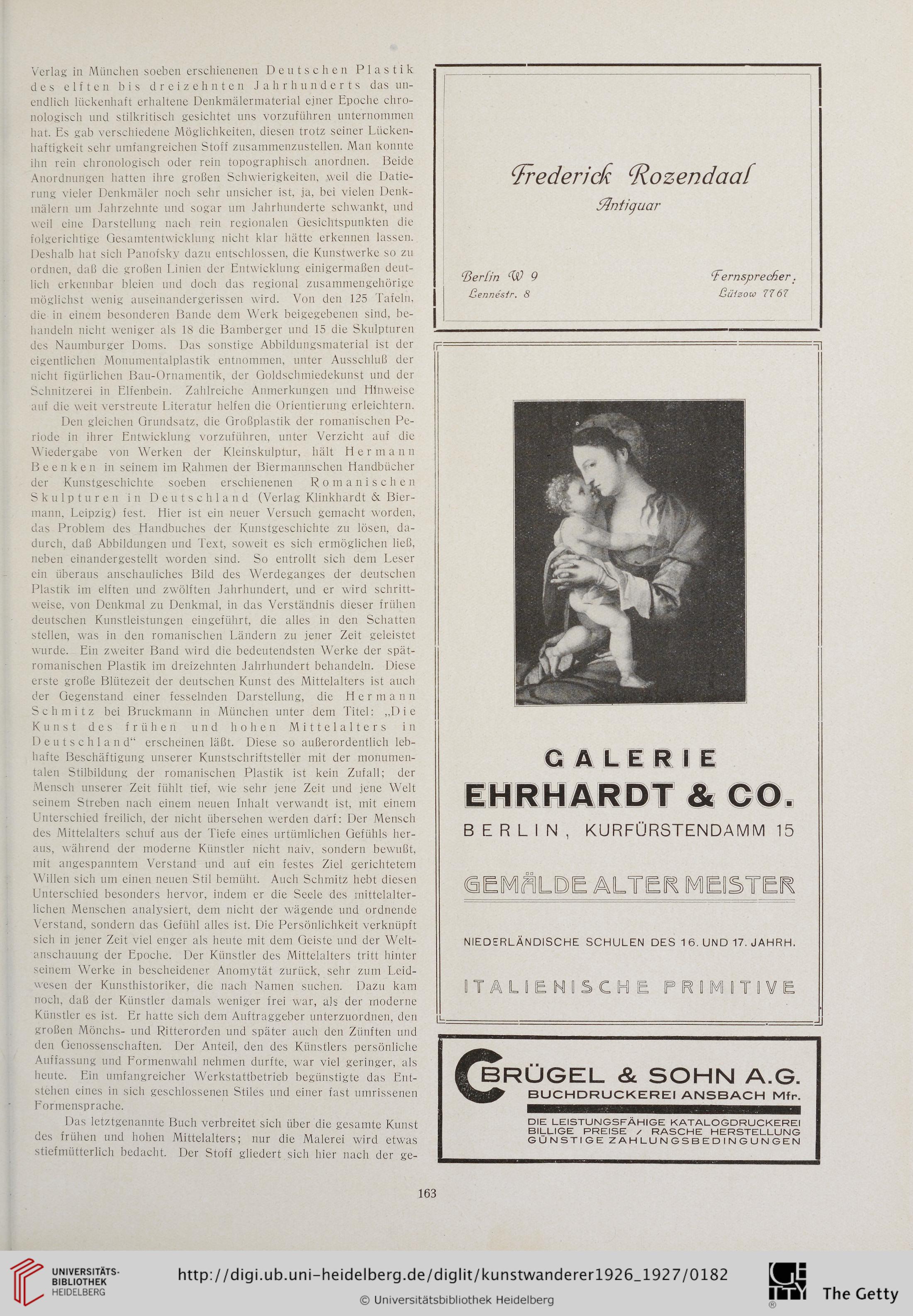Verlag in München soeben erschienenen Deutschen P 1 a s t i k
d e s e 1 f t e n b i s dreizehnten J a h r h u n d e r t s das un-
endlich lückenhaft erhaltene Denkmälermaterial ejner Epoche chro-
nologiscli und stilkritisch gesichtet uns vorzufiihren unternommen
liat. Es gab versciiiedcne Möglichkeiten, diesen trotz seiner Liicken-
haftigkeit sehr umfangreichen Stoff zusammenzustcllen. Man konnte
ihn rein chronologisch oder rein topographisch anordnen. Beide
Anordnungen hatten ihre großen Schwierigkeiten, weil die Datie-
rung vieler Denkmäler nocli sehr unsicher ist, ja, bei vielen Denk-
mälern um Jahrzehnte und sogar um Jahrhunderte schwankt, und
weil cine Darstellung nach rein regionalen Qesichtspunkten die
folgerichtige Gesamtentwicklung nicht klar hätte erkennen lassen.
Deshalb hat sicli Panofsky dazu entschlossen, die Kunstwerkc so zu
ordnen, daß die großen Linien der Entwicklung einigermaßen deut-
licli erkennbar bleien und doch das regional zusammengehörige
möglichst wenig auseinandergerissen wird. Von den 125 Tafeln,
die in einetn besonderen Bande dem Werk beigegebenen sind, be-
handeln nicht weniger als 18 die Bamberger und 15 die Skulpturen
des Naumburger Doms. Das sonstige Abbildungsmaterial ist der
eigentlichen Monumentalplastik entnommen, unter Ausschluß der
nicht figürlichen Bau-Ornamentik, dcr Goldschmiedekunst und der
Schnitzerei in Elfenbein. Zahlreiche Anmerkungeu und Hinweise
auf die weit verstreute Literatur helfen die Orientierung erleichtern.
Den gleichen Grundsatz, die Großplastik der romanischen Pe-
riode in ihrer Entwicklung vorzuführen, unter Verzicht auf dic
Wiedergabe von Werken der Kleinskulptur, liält Hermann
Beenken in seinem im Ralimen der Biermannschen Handbücher
der Kunstgeschichte soeben erschienenen Romanischen
Skulpturen in Deutschland (Verlag Klinkhardt & Bier-
mann, Leipzig) fest. Hier ist ein neuer Versuch gemacht worden,
das Problem des Handbuches der Kunstgeschichte zu lösen, da-
durch, daß Abbildungen und Text, soweit es sich ermöglichen ließ,
neben einandergestellt worden sind. So entrollt sich dem Leser
ein überaus anschauliches Bild des Werdeganges der deutschen
Plastik im elften und zwölften Jahrhundert, und er wird schritt-
weise, von Denkmal zu Denkmal, in das Verständnis dieser frülien
deutschen Kunstleistungen eingeführt, die alles in den Schatten
stellen, was in den romanischen Ländern zu jener Zeit geleistet
wurde. Ein zweiter Band wird die bedeutendsten Werke der spät-
romanischen Plastik im dreizehnten Jahrhundert behandeln. Diese
erste große Blütezeit der deutschen Kunst des Mittelalters ist auch
der Gegenstand einer fesselnden Darstellung, die H e r m a n n
Schmitz bei Bruckmann in München unter dem Titel: „D i c
Kunst des frühen und hohen Mittelalters in
D e u t s c h 1 a n d“ erscheinen läßt. Diese so außerordentlich leb-
hafte Beschäftigung unserer Kunstschriftsteller mit der monumen-
talen Stilbildung der romanischen Plastik ist kein Zufall; der
Mensch unserer Zeit fühlt tief, wie sehr jene Zeit und jene Welt
seinem Streben nach einem neuen Inhalt verwandt ist, mit einem
Unterschied freilich, der nicht übersehen werden darf: Der Menscli
des Mittelalters schuf aus der Tiefe eines urtümlichen Gefühls her-
aus, während der moderne Künstler nicht naiv, sondern bewußt,
mit angespanntem Verstand und auf ein festes Ziel gerichtetem
Willen sich um einen neuen Stil bemüht. Auch Schmitz hebt diesen
Unterschied besonders hervor, indem er die Seele des rnittelalter-
lichen Menschen analysiert, dem nicht der wägende und ordnende
Verstand, sondern das Gefiihl alles ist. Die Persönlichkeit verkniipft
sich in jener Zeit viel enger als heute mit dem Geiste und der Wclt-
anschauung der Epoche. Der Künstler des Mittelalters tritt hinter
scinem Werke in bescheidener Anomytät zurück, sehr zum Lcid-
wesen der Kunsthistoriker, die nach Namen snchen. Dazu kam
noch, daß der Kiinstler damals weniger frei war, als der moderne
Künstler es ist. Er hatte sich dem Auftraggeber unterzuordnen, den
großen Mönchs- und Ritterorden und später auch den Zünften und
den Genossenschaften. Der Anteil, den des Künstlers persönliche
Auffassung und Formenwahl nehmen durfte, war viel geringer, als
heute. Ein umfangreicher Werkstattbetrieb begiinstigte das Ent-
stehen eines in sich geschlossenen Stiles und einer fast umrissenen
Formensprache.
Das letztgenannte Buch verbreitet sich über die gesamte Kunst
des frühen und hohen Mittelalters; nur die Malerei wird etwas
stiefmütterlich bedacht. Der Stoff gliedert sich hier nach der ge-
cFrederiefc <Rozendaa[
fflntig*
uar
cBerlin ‘W 9
Gennestr. 8
‘Ternsjjrecüer.
ßützow 7767
NIEDERLÄNDISCHE SCHULEN DES 16. UND 17. JAHRH.
ITÄLIENISCHE primitive
II- — .. -J
CA LERIE
nHARDT & CO.
BERLIN, KURFÜRSTENDAMM 15
IflLDEÄLTI
BRUGEL & SOHN A.G.
BUCHDRUCKEREI ANSBACH Mfr.
DIE LEISTUNGSFÄHIGE KATALOGDRUCKEREI
BILLIGE PREISE / RASCHE HERSTELLUNG
GÜNSTIGE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
163
d e s e 1 f t e n b i s dreizehnten J a h r h u n d e r t s das un-
endlich lückenhaft erhaltene Denkmälermaterial ejner Epoche chro-
nologiscli und stilkritisch gesichtet uns vorzufiihren unternommen
liat. Es gab versciiiedcne Möglichkeiten, diesen trotz seiner Liicken-
haftigkeit sehr umfangreichen Stoff zusammenzustcllen. Man konnte
ihn rein chronologisch oder rein topographisch anordnen. Beide
Anordnungen hatten ihre großen Schwierigkeiten, weil die Datie-
rung vieler Denkmäler nocli sehr unsicher ist, ja, bei vielen Denk-
mälern um Jahrzehnte und sogar um Jahrhunderte schwankt, und
weil cine Darstellung nach rein regionalen Qesichtspunkten die
folgerichtige Gesamtentwicklung nicht klar hätte erkennen lassen.
Deshalb hat sicli Panofsky dazu entschlossen, die Kunstwerkc so zu
ordnen, daß die großen Linien der Entwicklung einigermaßen deut-
licli erkennbar bleien und doch das regional zusammengehörige
möglichst wenig auseinandergerissen wird. Von den 125 Tafeln,
die in einetn besonderen Bande dem Werk beigegebenen sind, be-
handeln nicht weniger als 18 die Bamberger und 15 die Skulpturen
des Naumburger Doms. Das sonstige Abbildungsmaterial ist der
eigentlichen Monumentalplastik entnommen, unter Ausschluß der
nicht figürlichen Bau-Ornamentik, dcr Goldschmiedekunst und der
Schnitzerei in Elfenbein. Zahlreiche Anmerkungeu und Hinweise
auf die weit verstreute Literatur helfen die Orientierung erleichtern.
Den gleichen Grundsatz, die Großplastik der romanischen Pe-
riode in ihrer Entwicklung vorzuführen, unter Verzicht auf dic
Wiedergabe von Werken der Kleinskulptur, liält Hermann
Beenken in seinem im Ralimen der Biermannschen Handbücher
der Kunstgeschichte soeben erschienenen Romanischen
Skulpturen in Deutschland (Verlag Klinkhardt & Bier-
mann, Leipzig) fest. Hier ist ein neuer Versuch gemacht worden,
das Problem des Handbuches der Kunstgeschichte zu lösen, da-
durch, daß Abbildungen und Text, soweit es sich ermöglichen ließ,
neben einandergestellt worden sind. So entrollt sich dem Leser
ein überaus anschauliches Bild des Werdeganges der deutschen
Plastik im elften und zwölften Jahrhundert, und er wird schritt-
weise, von Denkmal zu Denkmal, in das Verständnis dieser frülien
deutschen Kunstleistungen eingeführt, die alles in den Schatten
stellen, was in den romanischen Ländern zu jener Zeit geleistet
wurde. Ein zweiter Band wird die bedeutendsten Werke der spät-
romanischen Plastik im dreizehnten Jahrhundert behandeln. Diese
erste große Blütezeit der deutschen Kunst des Mittelalters ist auch
der Gegenstand einer fesselnden Darstellung, die H e r m a n n
Schmitz bei Bruckmann in München unter dem Titel: „D i c
Kunst des frühen und hohen Mittelalters in
D e u t s c h 1 a n d“ erscheinen läßt. Diese so außerordentlich leb-
hafte Beschäftigung unserer Kunstschriftsteller mit der monumen-
talen Stilbildung der romanischen Plastik ist kein Zufall; der
Mensch unserer Zeit fühlt tief, wie sehr jene Zeit und jene Welt
seinem Streben nach einem neuen Inhalt verwandt ist, mit einem
Unterschied freilich, der nicht übersehen werden darf: Der Menscli
des Mittelalters schuf aus der Tiefe eines urtümlichen Gefühls her-
aus, während der moderne Künstler nicht naiv, sondern bewußt,
mit angespanntem Verstand und auf ein festes Ziel gerichtetem
Willen sich um einen neuen Stil bemüht. Auch Schmitz hebt diesen
Unterschied besonders hervor, indem er die Seele des rnittelalter-
lichen Menschen analysiert, dem nicht der wägende und ordnende
Verstand, sondern das Gefiihl alles ist. Die Persönlichkeit verkniipft
sich in jener Zeit viel enger als heute mit dem Geiste und der Wclt-
anschauung der Epoche. Der Künstler des Mittelalters tritt hinter
scinem Werke in bescheidener Anomytät zurück, sehr zum Lcid-
wesen der Kunsthistoriker, die nach Namen snchen. Dazu kam
noch, daß der Kiinstler damals weniger frei war, als der moderne
Künstler es ist. Er hatte sich dem Auftraggeber unterzuordnen, den
großen Mönchs- und Ritterorden und später auch den Zünften und
den Genossenschaften. Der Anteil, den des Künstlers persönliche
Auffassung und Formenwahl nehmen durfte, war viel geringer, als
heute. Ein umfangreicher Werkstattbetrieb begiinstigte das Ent-
stehen eines in sich geschlossenen Stiles und einer fast umrissenen
Formensprache.
Das letztgenannte Buch verbreitet sich über die gesamte Kunst
des frühen und hohen Mittelalters; nur die Malerei wird etwas
stiefmütterlich bedacht. Der Stoff gliedert sich hier nach der ge-
cFrederiefc <Rozendaa[
fflntig*
uar
cBerlin ‘W 9
Gennestr. 8
‘Ternsjjrecüer.
ßützow 7767
NIEDERLÄNDISCHE SCHULEN DES 16. UND 17. JAHRH.
ITÄLIENISCHE primitive
II- — .. -J
CA LERIE
nHARDT & CO.
BERLIN, KURFÜRSTENDAMM 15
IflLDEÄLTI
BRUGEL & SOHN A.G.
BUCHDRUCKEREI ANSBACH Mfr.
DIE LEISTUNGSFÄHIGE KATALOGDRUCKEREI
BILLIGE PREISE / RASCHE HERSTELLUNG
GÜNSTIGE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
163