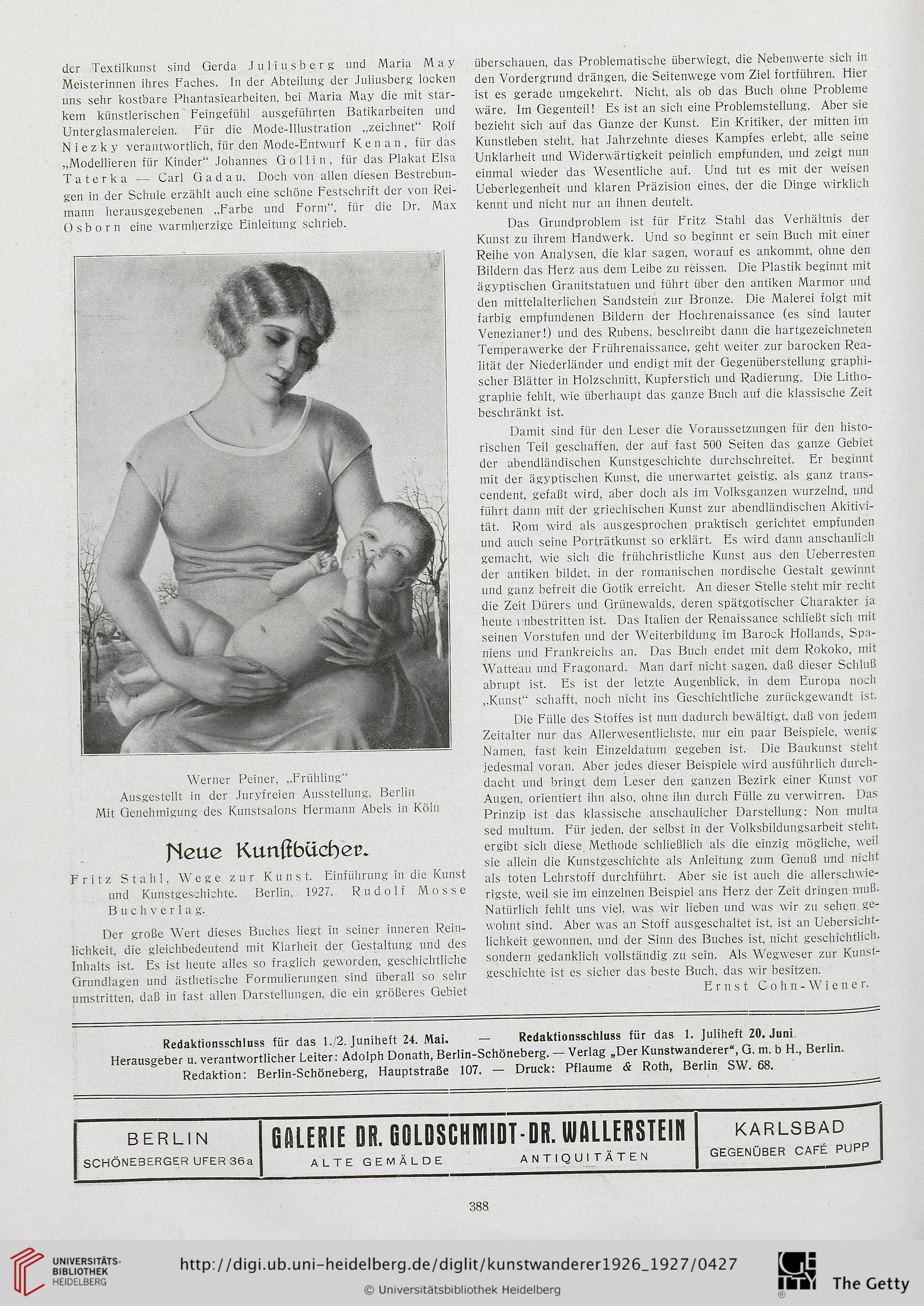cier Textilkunst sind Gerda J u 1 i u s b e r g und Maria M a y
Meisterinnen ihres Faches. In der Abteilung der Juliusberg locken
uns sehr kostbare Phantasiearbeiten, bei Maria May die mit star-
kem künstlerischen Feingefiihl ausgeführten Batikarbeiten und
Unterglasmalereien. Fiir die Mode-Illustration „zeichnet“ Rolf
N i e z k y verantwortlich, für den Mode-Entwurf K e n a n , für das
„Modellieren fiir Kinder“ Johannes Gollin, für das Plakat Elsa
T a t e r k a -— Carl G a d a u. Doch von allen diesen Bestrebun-
gen in der Schule erzählt auch eine schöne Festschrift der von Rei-
mann herausgegebenen „Farbe und Form“, fiir die Dr. Max
Qsborn eine warmherzige Einleitung schrieb.
Werner Peiner, „Friihling“
Ausgestellt in dcr Juryfreien Ausstellung, Berlin
Mit Genehmigung des Kunstsalons Hermann Abels in Köln
JScue Kunffbücbcr.
F r i t z S t a h 1, W e g e z u r K u n s t. Einführung in die Kunst
und Kunstgeschichte. Berlin, 1927. Rudolf Mosse
Buchverlag.
Der große Wert dieses Buches liegt in seiner inneren Rein-
lichkeit, die gleichbedeutend mit Klarheit der Gestaltung nnd des
Inhalts ist. Es ist heute alles so fraglich geworden, geschichtliche
Grundlagen und ästhetische Formulierungen sind iiberall so sehr
umstritten, daß in fast allen Darstellungen, die ein größeres Gebiet
überschauen, das Problematische überwiegt, die Nebenwerte sicli in
den Vordergrund drängen, die Seitenwege vom Ziel fortführen. Hier
ist es gerade umgekehrt. Nicht, als ob das Buch ohne Probleme
wäre. Im Gegenteil! Es ist an sich eine Problemstellung. Aber sie
bezieht sicli auf das Ganze der Kunst. Ein Kritiker, der mitten im
Kunstleben stelit, hat Jahrzehnte dieses Kampfes erlebt, alle seine
Unklarheit und Widerwärtigkeit peinlich empfunden, und zeigt nun
einmal wieder das Wesentliche auf. Und tut es mit der weisen
Ueberlegenheit und klaren Präzision eines, der die Dinge wirklich
kennt und nicht nur an ihnen deutelt.
Das Grundproblem ist fiir Fritz Stahl das Verhältnis der
Kunst zu ihrem Handwerk. Und so beginnt er sein Buch mit einer
Reihe von Analysen, die klar sagen, worauf es ankommt, ohne den
Bildern das Herz aus dem Leibe zu reissen. Die Plastik beginnt mit
ägyptischen Granitstatuen und führt über den antiken Marrnor und
den mittelalterlichen Sandstein zur Bronze. Die Malerei folgt mit
farbig empfundenen Bildern der Hochrenaissance (es sind lauter
Venezianer!) und des Rubens, beschreibt dann die hartgezeichneten
Temperawerke der Frührenaissance, geht weiter zur barocken Rea-
lität der Niederländer und endigt mit der Gegeniiberstellung graphi-
scher Blätter in Holzsclmitt, Kupferstich und Radierung. Die Litho-
graphie fehlt, wie tiberhaupt das ganze Buch auf die klassische Zeit
beschränkt ist.
Damit sind für den Leser die Voraussetzungen fiir den liisto-
rischen Teil geschaffen, der auf fast 500 Seiten das ganze Gebiet
der abendländischen Kunstgeschichte durchschreitet. Er beginnt
mit der ägyptischen Kunst, die unerwartet geistig, als ganz trans-
cendent, gefaßt wird, äber doch als im Volksganzen wurzelnd, und
führt dann mit der griechischen Kunst zur abendländischen Akitivi-
tät. Rom wird als ausgesprochen praktisch gerichtet empfunden
und aucli seine Porträtkunst so erklärt. Es wird dann anschaulich
gemacht, wie sich die friihchristliche Kunst aus den Ueberresten
der antiken bildet, in der romanischen nordische Gestalt gewinnt
und ganz befreit die Gotik erreicht. An dieser Stelle stelit mir recht
die Zeit Diirers und Grünewalds, deren spätgotischer Charakter ja
heute i ubestritten ist. Das Italien der Renaissance schließt sicli mit
seinen Vorstufen und der Weiterbildung im Barock Hollands, Spa-
niens und Frankreichs an. Das Buch endet mit dem Rokoko, mit
W^atteau und Fragonard. Man darf nicht sagen, daß dieser Scliluß
abrupt ist. Es ist der letzte Augenblick, in dem Europa noch
„Kunst“ schafft, nocli nicht ins Geschichtliche zuriickgewandt ist.
Die Fiille des Stoffes ist nun dadurch bewältigt, daß von jedem
Zeitalter nur das Allerwesentlichste, nur ein paar Beispiele, wenig
Namen, fast kein Einzeldatum gegeben ist. Die Baukunst steht
jedesmal voran. Aber jedes dieser Beispiele wird ausführlich durch-
dacht und bringt dem Leser den ganzen Bezirk einer Kunst vor
Augen, orientiert ihn also, ohne ihn durch Fiille zu verwirren. Das
Prinzip ist das klassische anschaulicher Darstellung: Non multa
sed multum. Für jeden, der selbst in der Volksbildungsarbeit steht,
ergibt sicli diese Methode schließlich als die einzig mögliche, weil
sie allein die Kunstgeschichte als Anleitung zum Genuß und niclit
als toten Lehrstoff durchfiihrt. Aber sie ist auch die allerschwie-
rigste, weil sie im einzelnen Beispiel ans Herz der Zeit dringen muß-
Natürlich fehlt uns viel, was wir lieben und was wir zu sehen ge-
wohnt sind. Aber was an Stoff ausgeschaltet ist, ist an Uebersicht-
lichkeit gewonnen, und der Sinn des Buches ist, niclit geschichtlich,
sondern gedanklich vollständig zu sein. Als Wegweser zur Kunst-
geschichte ist es siclier das beste Bucli, das wir besitzen.
E r n s t C o li n - W i e n e r.
Redaktionsschluss für das 1./2. Juniheft 24. Mai. — Redaktionsschluss für das 1. Juliheft 20. Juni
Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H., Berlin.
Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.
BERLIN
GALERIE DR. GOLDSGHIYIIDT-DR. UIALLERSTEIH
KARLSBAD
SCHÖNEBERGER UFER36a
ALTE GEMÄLDE ANTIQUITÄTEN
GEGENÜBER CAFE PUPP
388
Meisterinnen ihres Faches. In der Abteilung der Juliusberg locken
uns sehr kostbare Phantasiearbeiten, bei Maria May die mit star-
kem künstlerischen Feingefiihl ausgeführten Batikarbeiten und
Unterglasmalereien. Fiir die Mode-Illustration „zeichnet“ Rolf
N i e z k y verantwortlich, für den Mode-Entwurf K e n a n , für das
„Modellieren fiir Kinder“ Johannes Gollin, für das Plakat Elsa
T a t e r k a -— Carl G a d a u. Doch von allen diesen Bestrebun-
gen in der Schule erzählt auch eine schöne Festschrift der von Rei-
mann herausgegebenen „Farbe und Form“, fiir die Dr. Max
Qsborn eine warmherzige Einleitung schrieb.
Werner Peiner, „Friihling“
Ausgestellt in dcr Juryfreien Ausstellung, Berlin
Mit Genehmigung des Kunstsalons Hermann Abels in Köln
JScue Kunffbücbcr.
F r i t z S t a h 1, W e g e z u r K u n s t. Einführung in die Kunst
und Kunstgeschichte. Berlin, 1927. Rudolf Mosse
Buchverlag.
Der große Wert dieses Buches liegt in seiner inneren Rein-
lichkeit, die gleichbedeutend mit Klarheit der Gestaltung nnd des
Inhalts ist. Es ist heute alles so fraglich geworden, geschichtliche
Grundlagen und ästhetische Formulierungen sind iiberall so sehr
umstritten, daß in fast allen Darstellungen, die ein größeres Gebiet
überschauen, das Problematische überwiegt, die Nebenwerte sicli in
den Vordergrund drängen, die Seitenwege vom Ziel fortführen. Hier
ist es gerade umgekehrt. Nicht, als ob das Buch ohne Probleme
wäre. Im Gegenteil! Es ist an sich eine Problemstellung. Aber sie
bezieht sicli auf das Ganze der Kunst. Ein Kritiker, der mitten im
Kunstleben stelit, hat Jahrzehnte dieses Kampfes erlebt, alle seine
Unklarheit und Widerwärtigkeit peinlich empfunden, und zeigt nun
einmal wieder das Wesentliche auf. Und tut es mit der weisen
Ueberlegenheit und klaren Präzision eines, der die Dinge wirklich
kennt und nicht nur an ihnen deutelt.
Das Grundproblem ist fiir Fritz Stahl das Verhältnis der
Kunst zu ihrem Handwerk. Und so beginnt er sein Buch mit einer
Reihe von Analysen, die klar sagen, worauf es ankommt, ohne den
Bildern das Herz aus dem Leibe zu reissen. Die Plastik beginnt mit
ägyptischen Granitstatuen und führt über den antiken Marrnor und
den mittelalterlichen Sandstein zur Bronze. Die Malerei folgt mit
farbig empfundenen Bildern der Hochrenaissance (es sind lauter
Venezianer!) und des Rubens, beschreibt dann die hartgezeichneten
Temperawerke der Frührenaissance, geht weiter zur barocken Rea-
lität der Niederländer und endigt mit der Gegeniiberstellung graphi-
scher Blätter in Holzsclmitt, Kupferstich und Radierung. Die Litho-
graphie fehlt, wie tiberhaupt das ganze Buch auf die klassische Zeit
beschränkt ist.
Damit sind für den Leser die Voraussetzungen fiir den liisto-
rischen Teil geschaffen, der auf fast 500 Seiten das ganze Gebiet
der abendländischen Kunstgeschichte durchschreitet. Er beginnt
mit der ägyptischen Kunst, die unerwartet geistig, als ganz trans-
cendent, gefaßt wird, äber doch als im Volksganzen wurzelnd, und
führt dann mit der griechischen Kunst zur abendländischen Akitivi-
tät. Rom wird als ausgesprochen praktisch gerichtet empfunden
und aucli seine Porträtkunst so erklärt. Es wird dann anschaulich
gemacht, wie sich die friihchristliche Kunst aus den Ueberresten
der antiken bildet, in der romanischen nordische Gestalt gewinnt
und ganz befreit die Gotik erreicht. An dieser Stelle stelit mir recht
die Zeit Diirers und Grünewalds, deren spätgotischer Charakter ja
heute i ubestritten ist. Das Italien der Renaissance schließt sicli mit
seinen Vorstufen und der Weiterbildung im Barock Hollands, Spa-
niens und Frankreichs an. Das Buch endet mit dem Rokoko, mit
W^atteau und Fragonard. Man darf nicht sagen, daß dieser Scliluß
abrupt ist. Es ist der letzte Augenblick, in dem Europa noch
„Kunst“ schafft, nocli nicht ins Geschichtliche zuriickgewandt ist.
Die Fiille des Stoffes ist nun dadurch bewältigt, daß von jedem
Zeitalter nur das Allerwesentlichste, nur ein paar Beispiele, wenig
Namen, fast kein Einzeldatum gegeben ist. Die Baukunst steht
jedesmal voran. Aber jedes dieser Beispiele wird ausführlich durch-
dacht und bringt dem Leser den ganzen Bezirk einer Kunst vor
Augen, orientiert ihn also, ohne ihn durch Fiille zu verwirren. Das
Prinzip ist das klassische anschaulicher Darstellung: Non multa
sed multum. Für jeden, der selbst in der Volksbildungsarbeit steht,
ergibt sicli diese Methode schließlich als die einzig mögliche, weil
sie allein die Kunstgeschichte als Anleitung zum Genuß und niclit
als toten Lehrstoff durchfiihrt. Aber sie ist auch die allerschwie-
rigste, weil sie im einzelnen Beispiel ans Herz der Zeit dringen muß-
Natürlich fehlt uns viel, was wir lieben und was wir zu sehen ge-
wohnt sind. Aber was an Stoff ausgeschaltet ist, ist an Uebersicht-
lichkeit gewonnen, und der Sinn des Buches ist, niclit geschichtlich,
sondern gedanklich vollständig zu sein. Als Wegweser zur Kunst-
geschichte ist es siclier das beste Bucli, das wir besitzen.
E r n s t C o li n - W i e n e r.
Redaktionsschluss für das 1./2. Juniheft 24. Mai. — Redaktionsschluss für das 1. Juliheft 20. Juni
Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H., Berlin.
Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.
BERLIN
GALERIE DR. GOLDSGHIYIIDT-DR. UIALLERSTEIH
KARLSBAD
SCHÖNEBERGER UFER36a
ALTE GEMÄLDE ANTIQUITÄTEN
GEGENÜBER CAFE PUPP
388