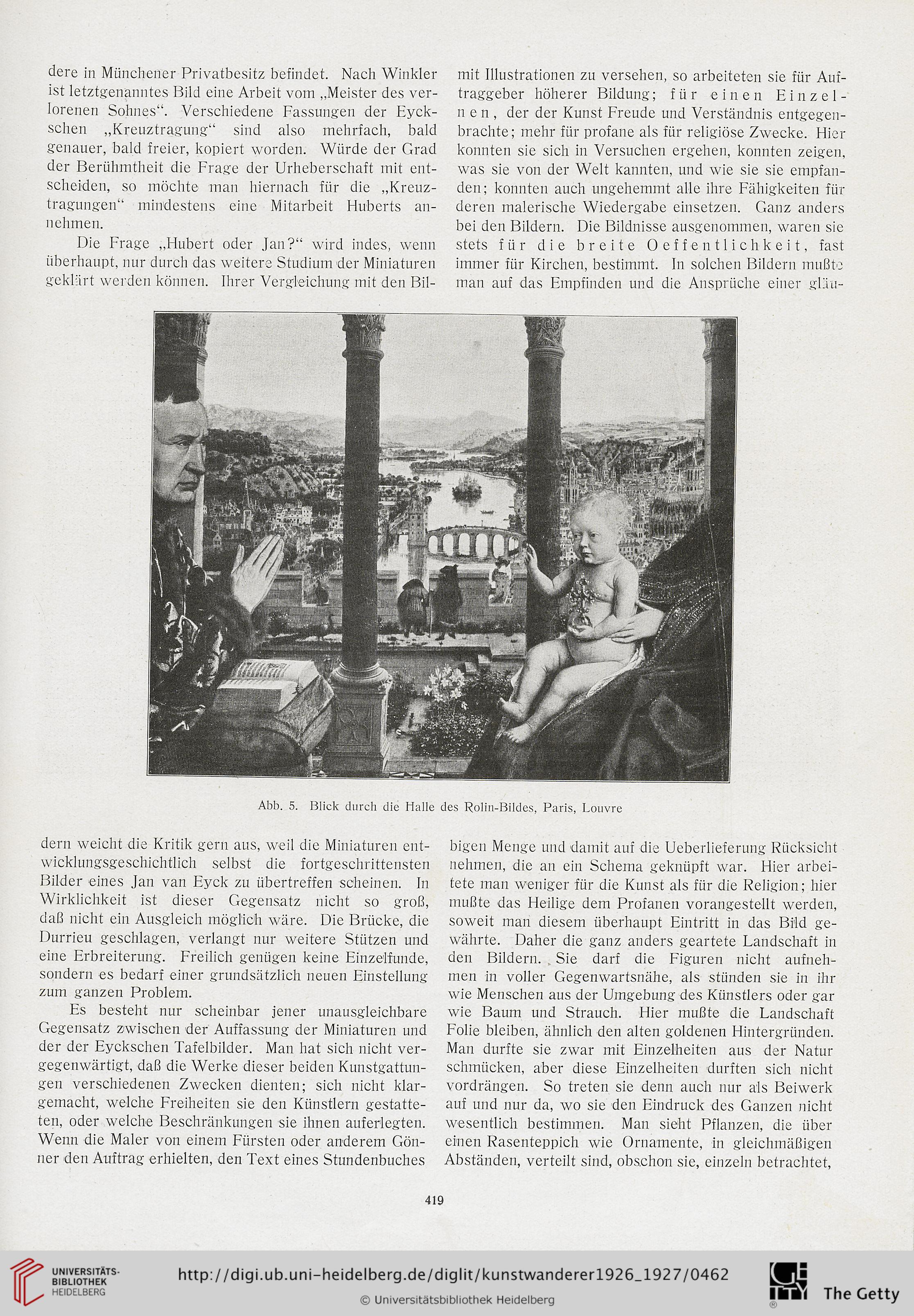Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0462
DOI Heft:
1./2. Juniheft
DOI Artikel:Kern, Guido Josef: Die verschollene "Kreuztragung" des Hubert oder Jan van Eyck, [3]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0462
dere in Münchener Privatbesitz befindet. Nach Winkler
ist letztgenanntes Bild cine Arbeit vom „Meister des ver-
lorenen Sohnes“. Verschiedene Fassungen der Eyck-
schen „Kreuztragung“ sind also mehrfach, bald
genauer, bald freier, kopiert worden. Würde der Grad
der Berühmtheit die Frage der Urheberschaft mit ent-
scheiden, so möchte man hiernach fiir die „Kreuz-
tragungen“ mindestens eine Mitarbeit Hubcrts an-
nehmen.
Die Frage „Hubert oder Jan?“ wird indes, wenn
überhaupt, nur durch das weitere Studium der Miniaturen
gekliirt werden können. Ihrer Vergteichung mit den Bil-
dern weicht die Kritik gern aus, weil die Miniaturen ent-
wicklungsgeschichtlich selbst die fortgeschrittensten
Bilder eines Jan van Eyck zu übertreffen scheinen. In
Wirklichkeit ist dieser Gegen&atz nicht so groß,
daß nicht ein Ausgleich möglich wäre. Die Brücke, die
Durrieu geschlagen, verlangt nur weitere Stützen und
eine Erbreiterung. Freilich genügen keine Einzelfunde,
sondern es bedarf einer grundsätzlich neuen Einstellung
zum ganzen Problem.
Es besteht nur scheinbar jener unausgleichbare
Gegensatz zwischen der Auffassung der Miniaturen und
der der Eyckschen Tafelbilder. Man hat sich nicht ver-
gegenwärtigt, daß die Werke dieser beiden Kunstgattun-
gen verschiedenen Zwecken dienten; sich nicht klar-
gemacht, welche Freiheiten sie den Künstlern gestatte-
ten, oder welche Beschränkungen sie ihnen auferlegten.
Wenn die Maler von einem Fürsten oder anderem Gön-
ner den Auftrag erhielten, den Text eines Stundenbuches
mit Illustrationen zu versehen, so arbeiteten sie für Auf-
traggeber höherer Bildung; f ü r einen E i n z e 1 -
n e n , der der Kunst Freude und Verständnis entgegen-
brachte; mehr für profane als für religiöse Zwecke. Hier
konnten sie sich in Versuchen ergehen, konnten zeigen,
was sie von der Welt kannten, und wie sie sie empfan-
den; konnten auch ungehemmt alle ihre Fähigkeiten für
deren malerische Wiedergabe einsetzen. Ganz anders
bei den Bildern. Die Bildnisse ausgenommen, waren sie
stets f ü r d i e b r e i t e Oeffentlichkeit, fast
immer für Kirchen, bestimmt. In solchen Bildern mußte
man auf das Empfinden und die Ansprüche einer gläu-
bigen Menge und damit auf die Ueberlieferung Rücksicht
nehmen, die an ein Schema geknüpft war. Hier arbei-
tete man weniger für die Kunst als für die Religion; hier
mußte das Heilige dem Profanen vorangestellt werden,
soweit man diesem überhaupt Eintritt in das Bi'ld ge-
währte. Daher die ganz anders geartete Landschaft in
den Bildern. . Sie darf die Figuren nicht aufneh-
men in voller Gegenwartsnähe, als stünden sie in ihr
wie Menschen aus der Umgebung des Künstlers oder gar
wie Baum und Strauch. Hier mußte die Landschaft
Folie bleiben, ähnlich den alten goldenen Hintergründen.
Man durfte sie zwar mit Einzelheiten aus der Natur
schmücken, aber diese Einzelheiten durften sich nicht
vordrängen. So treten sie denn auch nur als Beiwerk
auf und nur da, wo sie den Eindruck des Ganzen nicht
wesentlich bestimmen. Man sieht Pflanzen, die iiber
einen Rasenteppich wie Ornamente, in gleichmäßigen
Abständen, verteilt sind, ob&chon sie, einzeln betrachtet,
Abb. 5. Blick durch die Halle des Rolin-Bildes, Paris, Louvre
419
ist letztgenanntes Bild cine Arbeit vom „Meister des ver-
lorenen Sohnes“. Verschiedene Fassungen der Eyck-
schen „Kreuztragung“ sind also mehrfach, bald
genauer, bald freier, kopiert worden. Würde der Grad
der Berühmtheit die Frage der Urheberschaft mit ent-
scheiden, so möchte man hiernach fiir die „Kreuz-
tragungen“ mindestens eine Mitarbeit Hubcrts an-
nehmen.
Die Frage „Hubert oder Jan?“ wird indes, wenn
überhaupt, nur durch das weitere Studium der Miniaturen
gekliirt werden können. Ihrer Vergteichung mit den Bil-
dern weicht die Kritik gern aus, weil die Miniaturen ent-
wicklungsgeschichtlich selbst die fortgeschrittensten
Bilder eines Jan van Eyck zu übertreffen scheinen. In
Wirklichkeit ist dieser Gegen&atz nicht so groß,
daß nicht ein Ausgleich möglich wäre. Die Brücke, die
Durrieu geschlagen, verlangt nur weitere Stützen und
eine Erbreiterung. Freilich genügen keine Einzelfunde,
sondern es bedarf einer grundsätzlich neuen Einstellung
zum ganzen Problem.
Es besteht nur scheinbar jener unausgleichbare
Gegensatz zwischen der Auffassung der Miniaturen und
der der Eyckschen Tafelbilder. Man hat sich nicht ver-
gegenwärtigt, daß die Werke dieser beiden Kunstgattun-
gen verschiedenen Zwecken dienten; sich nicht klar-
gemacht, welche Freiheiten sie den Künstlern gestatte-
ten, oder welche Beschränkungen sie ihnen auferlegten.
Wenn die Maler von einem Fürsten oder anderem Gön-
ner den Auftrag erhielten, den Text eines Stundenbuches
mit Illustrationen zu versehen, so arbeiteten sie für Auf-
traggeber höherer Bildung; f ü r einen E i n z e 1 -
n e n , der der Kunst Freude und Verständnis entgegen-
brachte; mehr für profane als für religiöse Zwecke. Hier
konnten sie sich in Versuchen ergehen, konnten zeigen,
was sie von der Welt kannten, und wie sie sie empfan-
den; konnten auch ungehemmt alle ihre Fähigkeiten für
deren malerische Wiedergabe einsetzen. Ganz anders
bei den Bildern. Die Bildnisse ausgenommen, waren sie
stets f ü r d i e b r e i t e Oeffentlichkeit, fast
immer für Kirchen, bestimmt. In solchen Bildern mußte
man auf das Empfinden und die Ansprüche einer gläu-
bigen Menge und damit auf die Ueberlieferung Rücksicht
nehmen, die an ein Schema geknüpft war. Hier arbei-
tete man weniger für die Kunst als für die Religion; hier
mußte das Heilige dem Profanen vorangestellt werden,
soweit man diesem überhaupt Eintritt in das Bi'ld ge-
währte. Daher die ganz anders geartete Landschaft in
den Bildern. . Sie darf die Figuren nicht aufneh-
men in voller Gegenwartsnähe, als stünden sie in ihr
wie Menschen aus der Umgebung des Künstlers oder gar
wie Baum und Strauch. Hier mußte die Landschaft
Folie bleiben, ähnlich den alten goldenen Hintergründen.
Man durfte sie zwar mit Einzelheiten aus der Natur
schmücken, aber diese Einzelheiten durften sich nicht
vordrängen. So treten sie denn auch nur als Beiwerk
auf und nur da, wo sie den Eindruck des Ganzen nicht
wesentlich bestimmen. Man sieht Pflanzen, die iiber
einen Rasenteppich wie Ornamente, in gleichmäßigen
Abständen, verteilt sind, ob&chon sie, einzeln betrachtet,
Abb. 5. Blick durch die Halle des Rolin-Bildes, Paris, Louvre
419