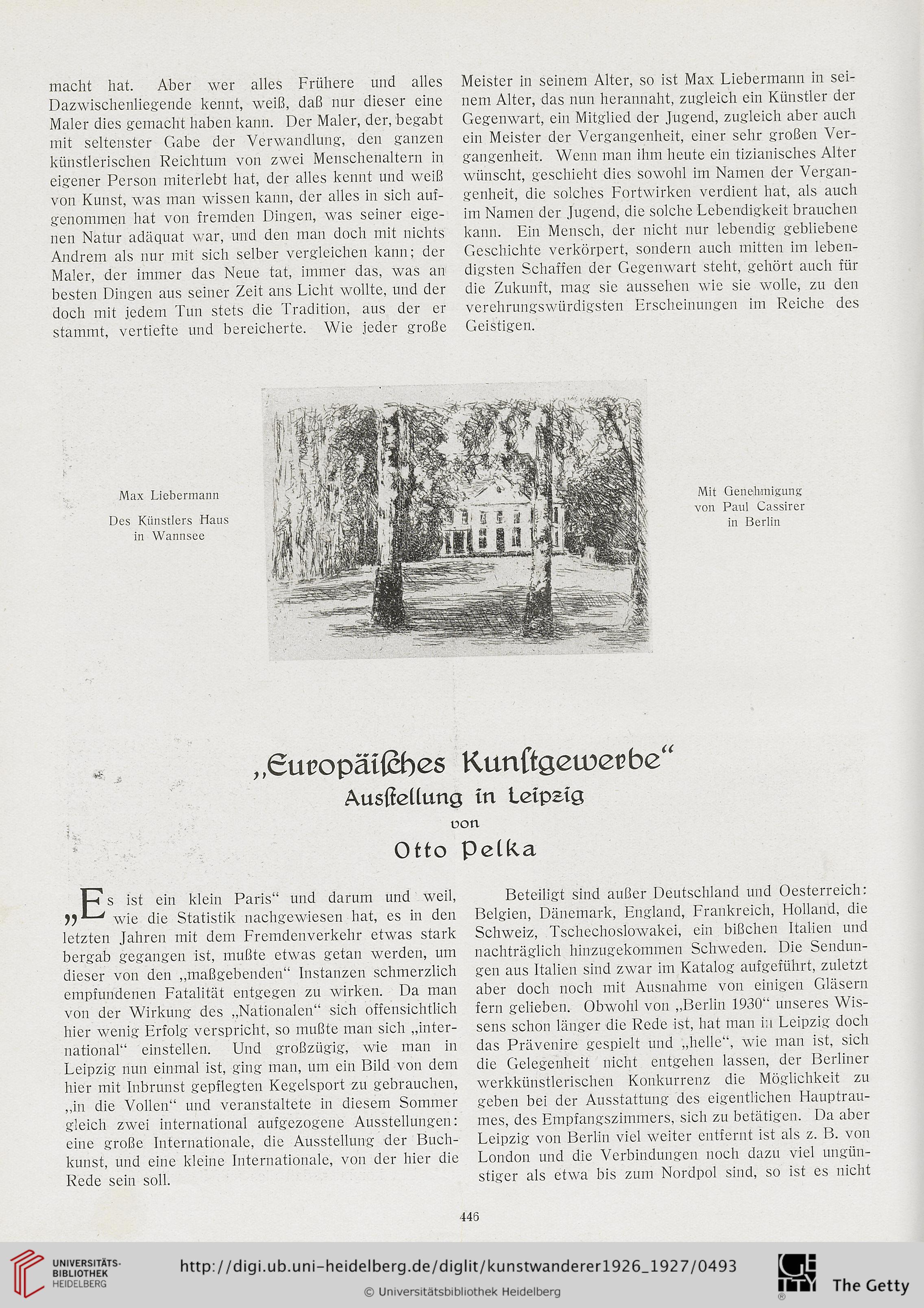Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0493
DOI Heft:
1./2. Juliheft
DOI Artikel:Waldmann, Emil: Max Liebermann: Zum 80. Geburtstage am 20. Juli
DOI Artikel:Pelka, Otto: "Europäisches Kunstgewerbe": Ausstellung in Leipzig
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0493
macht hat. Aber wer alles Frühere und alles
Dazwischenliegende kennt, weiß, daß nur dieser eine
Maler dies gemacht haben kann. Der Maler, der, begabt
mit seltenster Gabe der Verwandlung, den ganzen
künstlerischen Reichtum von zwei Menschenaltern in
eigener Person miterlebt hat, der alles kennt und weiß
von Kunst, Avas man wissen kann, der alles in sich auf-
genommen hat von fremden Dingen, was seiner eige-
nen Natur adäquat war, und den man doch mit nichts
Andrem als nur mit sich selber verglcichen kann; der
Maler, der immer das Neue tat, immer das, Avas an
besten Dingen aus seiner Zeit ans Licht wollte, und der
doch mit jedem Tun stets die Tradition, aus der er
stammt, vertiefte und bereicherte. Wie jeder große
Meister in seinem Alter, so ist Max Liebermann in sei-
nem Alter, das nun herannaht, zugleich ein Künstler der
Gegenwart, ein Mitglied der Jugend, zugleich aber auch
ein Meister der Vergangenheit, einer sehr großen Ver-
gangenheit. Wenn man ihm heute ein tizianisches Alter
wünscht, geschieht dies sowohl im Namen der Vergan-
genheit, die solches Fortwirken verdient hat, als auch
im Namen der Jugend, die solche Lebendigkeit brauchen
kann. Ein Mensch, der nicht nur lebendig gebliebene
Gescbichte verkörpert, sondern auch mitten im leben-
digsten Schaffen der Gegenwart steht, gehört auch für
die Zukunft, mag sie aussehen wie sie wolle, zu den
verehrungswürdigsten Erscheinungen im Reiche des
Geistigen.
Max Liebermann
Des Kiinstlcrs Haus
in Wannsee
Mit Genehmigung
von Paul Cassirer
in Berlin
„6ut?opät{cbes Kunftgetüecbe“
Ausffcttung tn lcipsig
oon
Otto PctKa
l-< s ist ein klein Paris“ und darum und weil,
wie die Statistik nachgewiesen hat, es in den
letzten Jahren mit dem Fremdenverkehr etwas stark
bergab gegangen ist, mußte etwas getan werden, um
dieser von den ,,maßgebenden“ Instanzen schmerzlich
empfundenen Fatalität entgegen zu wirken. Da man
von der Wirkung des „Nationalen“ sich offensichtlich
hier wenig Erfolg verspricht, so mußte man sich „inter-
national“ einstellen. Und großzügig, wie man in
Leipzig nun einmal ist, ging man, um ein Bild von dem
hier mit Inbrunst gepflegten Kegelsport zu gebrauchen,
,,in die Vollen“ und veranstaltete in diesem Sommer
gleich zwei international aufgezogene Ausstellungen:
eine große Internationale, die Ausstellung der Buch-
kunst, und eine kleine Internationale, von der hier die
Rede sein soll.
Beteiligt sind außer Deutschland und Oesterreich:
Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Holland, die
Schweiz, Tschechoslowakei, ein bißchen Italien und
nachträglich hinzugekommen Schweden. Die Sendun-
gen aus Italien sind zwar im Katalog aufgeführt, zuletzt
aber doch noch mit Ausnahme von einigen Gläsern
fern gelieben. Obwohl von „Berlin 1930“ unseres Wis-
sens schon länger die Rede ist, hat man in Leipzig doch
das Prävenire gespielt und „helle“, wie man ist, sich
die Gelegenheit nicht entgehen lassen, der Berliner
werkkünstlerischen Konkurrenz die Möglichkeit zu
geben bei der Ausstattung des eigentlichen Hauptrau-
mes, des Empfangszimmers, sicli zu betätigen. Da aber
Leipzig von Berlin viel weiter entfernt ist als z. B. von
London und die Verbindungen noch dazu viel ungün-
stiger als etwa bis zum Nordpol sind, so ist es nicht
446
Dazwischenliegende kennt, weiß, daß nur dieser eine
Maler dies gemacht haben kann. Der Maler, der, begabt
mit seltenster Gabe der Verwandlung, den ganzen
künstlerischen Reichtum von zwei Menschenaltern in
eigener Person miterlebt hat, der alles kennt und weiß
von Kunst, Avas man wissen kann, der alles in sich auf-
genommen hat von fremden Dingen, was seiner eige-
nen Natur adäquat war, und den man doch mit nichts
Andrem als nur mit sich selber verglcichen kann; der
Maler, der immer das Neue tat, immer das, Avas an
besten Dingen aus seiner Zeit ans Licht wollte, und der
doch mit jedem Tun stets die Tradition, aus der er
stammt, vertiefte und bereicherte. Wie jeder große
Meister in seinem Alter, so ist Max Liebermann in sei-
nem Alter, das nun herannaht, zugleich ein Künstler der
Gegenwart, ein Mitglied der Jugend, zugleich aber auch
ein Meister der Vergangenheit, einer sehr großen Ver-
gangenheit. Wenn man ihm heute ein tizianisches Alter
wünscht, geschieht dies sowohl im Namen der Vergan-
genheit, die solches Fortwirken verdient hat, als auch
im Namen der Jugend, die solche Lebendigkeit brauchen
kann. Ein Mensch, der nicht nur lebendig gebliebene
Gescbichte verkörpert, sondern auch mitten im leben-
digsten Schaffen der Gegenwart steht, gehört auch für
die Zukunft, mag sie aussehen wie sie wolle, zu den
verehrungswürdigsten Erscheinungen im Reiche des
Geistigen.
Max Liebermann
Des Kiinstlcrs Haus
in Wannsee
Mit Genehmigung
von Paul Cassirer
in Berlin
„6ut?opät{cbes Kunftgetüecbe“
Ausffcttung tn lcipsig
oon
Otto PctKa
l-< s ist ein klein Paris“ und darum und weil,
wie die Statistik nachgewiesen hat, es in den
letzten Jahren mit dem Fremdenverkehr etwas stark
bergab gegangen ist, mußte etwas getan werden, um
dieser von den ,,maßgebenden“ Instanzen schmerzlich
empfundenen Fatalität entgegen zu wirken. Da man
von der Wirkung des „Nationalen“ sich offensichtlich
hier wenig Erfolg verspricht, so mußte man sich „inter-
national“ einstellen. Und großzügig, wie man in
Leipzig nun einmal ist, ging man, um ein Bild von dem
hier mit Inbrunst gepflegten Kegelsport zu gebrauchen,
,,in die Vollen“ und veranstaltete in diesem Sommer
gleich zwei international aufgezogene Ausstellungen:
eine große Internationale, die Ausstellung der Buch-
kunst, und eine kleine Internationale, von der hier die
Rede sein soll.
Beteiligt sind außer Deutschland und Oesterreich:
Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Holland, die
Schweiz, Tschechoslowakei, ein bißchen Italien und
nachträglich hinzugekommen Schweden. Die Sendun-
gen aus Italien sind zwar im Katalog aufgeführt, zuletzt
aber doch noch mit Ausnahme von einigen Gläsern
fern gelieben. Obwohl von „Berlin 1930“ unseres Wis-
sens schon länger die Rede ist, hat man in Leipzig doch
das Prävenire gespielt und „helle“, wie man ist, sich
die Gelegenheit nicht entgehen lassen, der Berliner
werkkünstlerischen Konkurrenz die Möglichkeit zu
geben bei der Ausstattung des eigentlichen Hauptrau-
mes, des Empfangszimmers, sicli zu betätigen. Da aber
Leipzig von Berlin viel weiter entfernt ist als z. B. von
London und die Verbindungen noch dazu viel ungün-
stiger als etwa bis zum Nordpol sind, so ist es nicht
446