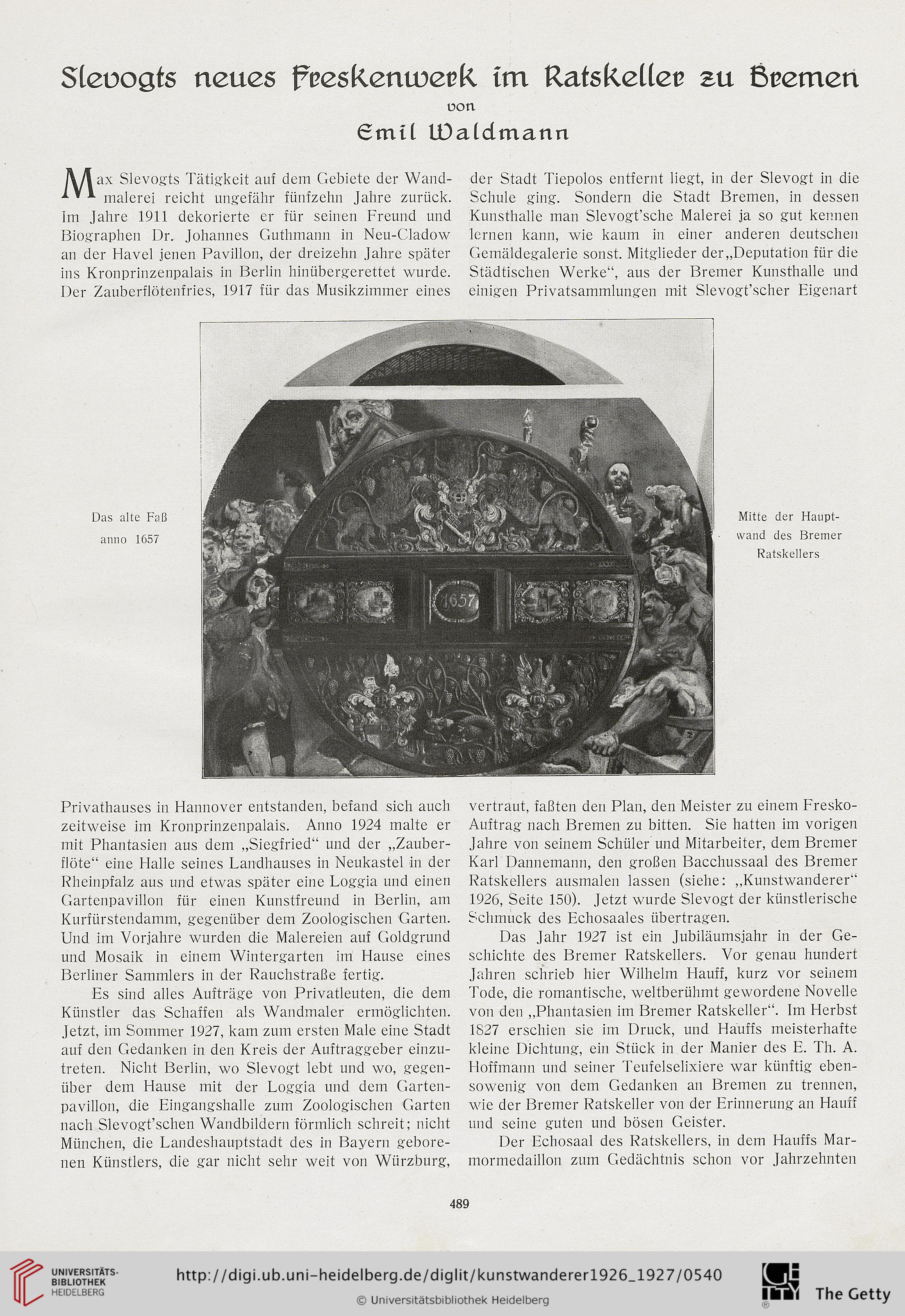Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0540
DOI Heft:
1./2. Augustheft
DOI Artikel:Waldmann, Emil: Slevogts neues Freskenwerk im Ratskeller zu Bremen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0540
Sleoogts rieues fveskenwevk tm Ratskeltei? eu Bremen
oon
Smit tDaldmann
/\/\ax Slevogts Tätigkeit auf dem Gebiete der Wand-
** * malerei reicht ungefähr fünfzehn Jahre zurück.
Jm Jahre 1911 dekorierte er für seinen Freund und
Biographen Dr. Johannes Guthmann in Neu-Cladow
an der Havel jenen Pavillon, der dreizehn Jahre später
ins Kronprinzenpalais in Berlin hinübergerettet wurde.
Der Zauberflötenfries, 1917 für das Musikzimmer eines
der Stadt Tiepolos entfernt liegt, in der Slevogt in die
Schule ging. Sondern die Stadt Bremen, in dessen
Kunsthalle man Slevogt’sche Malerei ja so gut kennen
lernen kann, wie kaum in einer anderen deutschen
Gemäldegalerie sonst. Mitglieder der„Deputation für die
Städtischen Werke“, aus der Bremer Kunsthalle und
einigen Privatsammlungen mit Slevogt’scher Eigenart
Das alte Faß
anno 1657
Mitte der Haupt-
wand des Bremer
Ratskellers
Privathauses in Hannover entstanden, befand sich auch
zeitweise im Kronprinzenpalais. Anno 1924 malte er
mit Phantasien aus dem „Siegfried“ und der „Zauber-
flöte“ eine Halle seines Landhauses in Neukastel in der
Rheinpfalz aus und etwas später eine Loggia und einen
Gartenpavillon für einen Kunstfreund in Berlin, am
Kurfürstendamm, gegenüber dem Zoologischen ’Garten.
Und im Vorjahre wurden die Malereien auf Goldgrund
und Mosaik in einem Wintergarten im Hause eines
Berliner Sammlers in der Rauchstraße fertig.
Es sind alles Aufträge von Privatleuten, die dem
Künstler das Schaffen a!s Wandmaler ermöglichten.
Jetzt, im Sommer 1927, kam zum ersten Male eine Stadt
auf den Gedanken in den Kreis der Auftraggeber einzu-
treten. Nicht Berlin, wo Slevogt lebt und wo, gegen-
über dem Hause mit der Loggia und dem Garten-
pavillon, die Eingangshalle zum Zoologischcn Garten
nach Slevogt’schen Wandbildern förmlich schreit; nicht
Miinchen, die Landeshauptstadt des in Bayern gebore-
nen Künstlers, die gar nicht selir weit von Würzburg,
vertraut, faßten den Plan, den Meister zu einem Fresko-
Auftrag nach Bremen zu bitten. Sie hatten im vorigen
Jahre von seinem Schüler und Mitarbeiter, dem Bremer
Karl Dannemann, den großen Bacchussaal des Bremer
Ratskellers ausmalen lassen (siehe: „Kunstwanderer“
1926, Seite 150). Jetzt wurde Slevogt der künstlerische
Schmuck des Echosaales übertragen.
Das Jahr 1927 ist ein Jubiläumsjahr in der Ge-
schichte des Bremer Ratskellers. Vor genau hundert
Jahren schrieb hier Wilhelm Hauff, kurz vor seinem
Tode, die romantische, weltberühmt gewordene Novelle
von den „Phantasien im Bremer Ratskeller“. Im Herbst
1827 erschien sie im Druck, und Hauffs meisterhafte
kleine Dichtung, ein Stiick in der Manier des E. Th. A.
Hoffmann und seiner Teufelselixiere war künftig eben-
sowenig von dem Gedanken an Bremen zu trennen,
wie der Bremer Ratskeller von der Erinnerung an Hauff
und seine guten und bösen Geister.
Der Echosaal des Ratskellers, in dem Hauffs Mar-
mormedaillon zum Gedächtnis schon vor Jahrzehnten
489
oon
Smit tDaldmann
/\/\ax Slevogts Tätigkeit auf dem Gebiete der Wand-
** * malerei reicht ungefähr fünfzehn Jahre zurück.
Jm Jahre 1911 dekorierte er für seinen Freund und
Biographen Dr. Johannes Guthmann in Neu-Cladow
an der Havel jenen Pavillon, der dreizehn Jahre später
ins Kronprinzenpalais in Berlin hinübergerettet wurde.
Der Zauberflötenfries, 1917 für das Musikzimmer eines
der Stadt Tiepolos entfernt liegt, in der Slevogt in die
Schule ging. Sondern die Stadt Bremen, in dessen
Kunsthalle man Slevogt’sche Malerei ja so gut kennen
lernen kann, wie kaum in einer anderen deutschen
Gemäldegalerie sonst. Mitglieder der„Deputation für die
Städtischen Werke“, aus der Bremer Kunsthalle und
einigen Privatsammlungen mit Slevogt’scher Eigenart
Das alte Faß
anno 1657
Mitte der Haupt-
wand des Bremer
Ratskellers
Privathauses in Hannover entstanden, befand sich auch
zeitweise im Kronprinzenpalais. Anno 1924 malte er
mit Phantasien aus dem „Siegfried“ und der „Zauber-
flöte“ eine Halle seines Landhauses in Neukastel in der
Rheinpfalz aus und etwas später eine Loggia und einen
Gartenpavillon für einen Kunstfreund in Berlin, am
Kurfürstendamm, gegenüber dem Zoologischen ’Garten.
Und im Vorjahre wurden die Malereien auf Goldgrund
und Mosaik in einem Wintergarten im Hause eines
Berliner Sammlers in der Rauchstraße fertig.
Es sind alles Aufträge von Privatleuten, die dem
Künstler das Schaffen a!s Wandmaler ermöglichten.
Jetzt, im Sommer 1927, kam zum ersten Male eine Stadt
auf den Gedanken in den Kreis der Auftraggeber einzu-
treten. Nicht Berlin, wo Slevogt lebt und wo, gegen-
über dem Hause mit der Loggia und dem Garten-
pavillon, die Eingangshalle zum Zoologischcn Garten
nach Slevogt’schen Wandbildern förmlich schreit; nicht
Miinchen, die Landeshauptstadt des in Bayern gebore-
nen Künstlers, die gar nicht selir weit von Würzburg,
vertraut, faßten den Plan, den Meister zu einem Fresko-
Auftrag nach Bremen zu bitten. Sie hatten im vorigen
Jahre von seinem Schüler und Mitarbeiter, dem Bremer
Karl Dannemann, den großen Bacchussaal des Bremer
Ratskellers ausmalen lassen (siehe: „Kunstwanderer“
1926, Seite 150). Jetzt wurde Slevogt der künstlerische
Schmuck des Echosaales übertragen.
Das Jahr 1927 ist ein Jubiläumsjahr in der Ge-
schichte des Bremer Ratskellers. Vor genau hundert
Jahren schrieb hier Wilhelm Hauff, kurz vor seinem
Tode, die romantische, weltberühmt gewordene Novelle
von den „Phantasien im Bremer Ratskeller“. Im Herbst
1827 erschien sie im Druck, und Hauffs meisterhafte
kleine Dichtung, ein Stiick in der Manier des E. Th. A.
Hoffmann und seiner Teufelselixiere war künftig eben-
sowenig von dem Gedanken an Bremen zu trennen,
wie der Bremer Ratskeller von der Erinnerung an Hauff
und seine guten und bösen Geister.
Der Echosaal des Ratskellers, in dem Hauffs Mar-
mormedaillon zum Gedächtnis schon vor Jahrzehnten
489