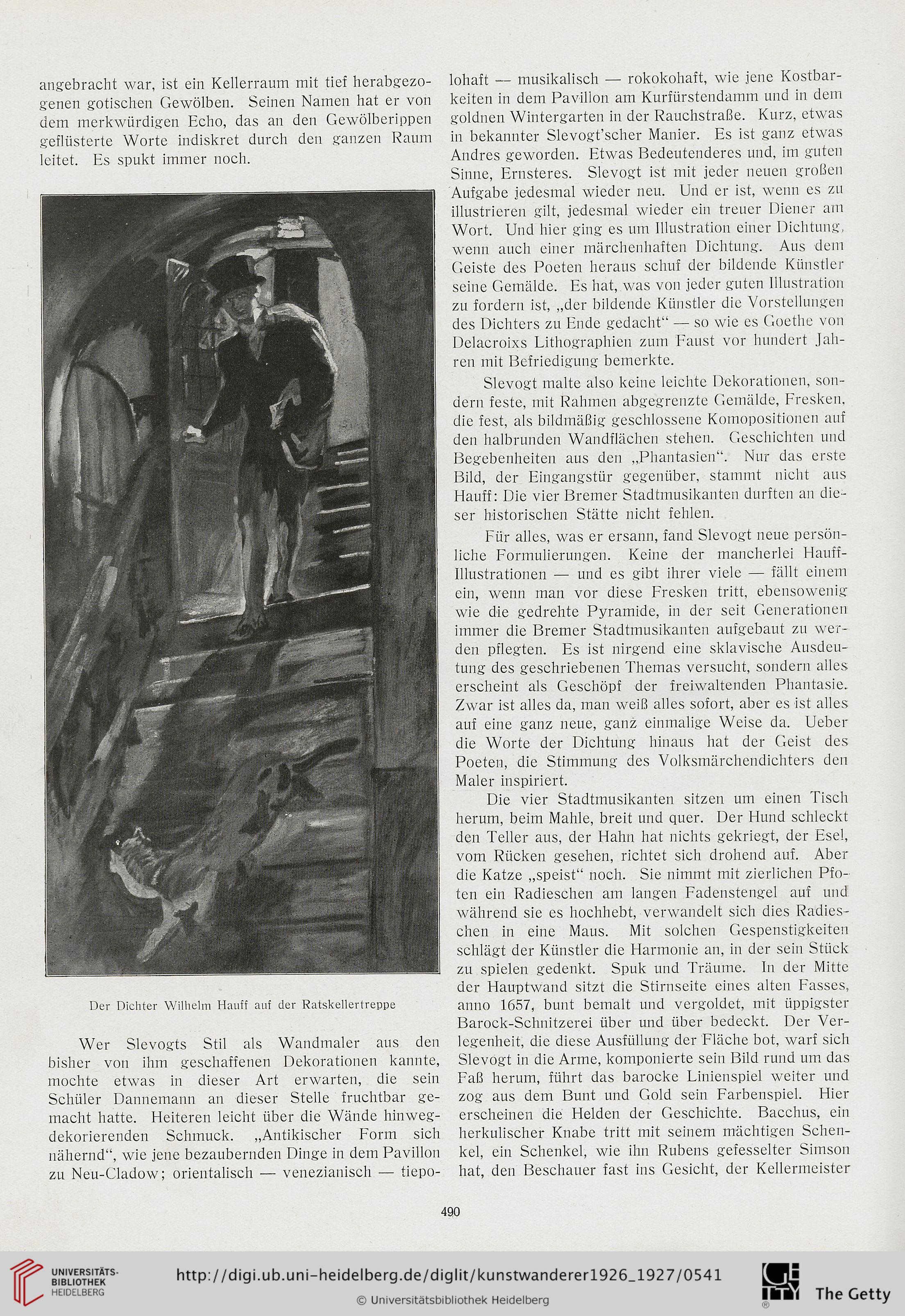angebracht war, ist ein Kellerraum mit tief herabgezo-
genen gotischen Gewölben. Seinen Namen hat er von
dem merkwürdigen Echo, das an den Gewölberippen
geflüsterte Worte indiskret durch den ganzen Raum
leitet. Es spukt immer noch.
Der Dichter Wilhelm Hauff auf der Ratskellertreppe
Wer Slevogts Stil als Wandmaler aus den
bisher von ihm geschaffenen Dekorationen kannte,
mochte etwas in dieser Art erwarten, die sein
Schüler Dannemann an dieser Stelle fruchtbar ge-
macht hatte. Heiteren leicht über die Wände hinweg-
dekorierenden Schmuck. „Antikischer Form sich
nähernd“, wie jene bezaubernden Dinge in dem Pavillon
zu Neu-Gladow; orientalisch — venezianisch — tiepo-
lohaft — musikalisch — rokokohaft, wie jene Kostbar-
keiten in dem Pavillon am Kurfürstendamm und in dem
goldnen Wintergarten in der Rauchstraße. Kurz, etwas
in bekannter Slevogt’scher Manier. Es ist ganz etwas
Andres geworden. Etwas Bedeutenderes und, im guten
Sinne, Ernsteres. Slevogt ist mit jeder neuen großen
Aufgabe jedesmal wieder neu. Und er ist, wenn es zu
illustrieren gilt, jedesmal wieder ein treuer Diener am
Wort. Und hier ging es um Illustration einer Dichtung,
wenn auch einer märchenhaften Dichtung. Aus dem
Geiste des Poeten heraus schuf der bildende Künstler
seine Gemälde. Es hat, was von jeder guten Ulustration
zu fordern ist, „der bildende Künstler die Vorstellungen
des Dichters zu Ende gedacht“ — so wie es Goethe von
Delacroixs Lithographien zum Eaust vor hundert Jah-
ren mit Befriedigung bemerkte.
Slevogt malte also keine leichte Dekorationen, son-
dern feste, mit Rahmen abgegrenztc Gemälde, Fresken,
die fest, als bildrnäßig geschlossene Komopositioncn auf
den halbrunden Wandflächen stehen. Geschichten und
Begebenheiten aus den „Phantasien“. Nur das erste
Bild, der Eingangstür gegenüber, stammt nicht aus
Hauff: Die vier Bremer Stadtmusikanten durften an die-
ser historischen Stätte nicht fehlen.
Für alles, was er ersann, fand Slevogt neue persön-
liche Formulierungen. Keine der mancherlei Hauff-
Illustrationen — und es gibt ihrer viele — fällt einem
ein, wenn man vor diese Fresken tritt, ebensowenig
wie die gedrehte Pyramide, in der seit Generationen
immer die Bremer Stadtmusikanten aufgebaut zu wer-
den pflegten. Es ist nirgend eine sklavische Ausdeu-
tung des geschriebenen Themas versucht, soudern alles
erscheint als Geschöpf der freiwaltenden Phantasie..
Zwar ist alles da, man weiß alles sofort, aber es ist alles
auf eine ganz neue, ganz einmalige Weise da. Ueber
die Worte der Dichtung hinaus hat der Geist des
Poeten, die Stimmung des Volksmärchendichters den
Maler inspiriert.
Die vier Stadtmusikanten sitzen um einen Tisch
herum, beim Mahle, breit und quer. Der Hund schleckt
den Teller aus, der Hahn hat nichts gekriegt, der Esel,
vom Rücken gesehen, richtet sich drohend auf. Aber
die Katze „speist“ noch. Sie nimmt mit zierlichen Pfo-
ten ein Radieschen am langen Fadenstengel auf und
während sie es hochhebt, verwandelt sich dies Radies-
chen in eine Maus. Mit solchen Gespenstigkeiten
schlägt der Künstler die Harmonie an, in der sein Stück
zu spielen gedenkt. Spuk und Träume. In der Mitte
der Hauptwand sitzt die Stirnseite eines alten Fasses,
anno 1657, bunt bemalt und vergoldet, mit üppigster
Barock-Schnitzerei über und über bedeckt. Der Ver-
legenheit, die diese Ausfüllung der Fläche bot, warf sich
Slevogt in die Arme, komponierte sein Bild rund um das
Faß herum, führt das barocke Linienspiel weiter und
zog aus dem Bunt und Gold sein Farbenspiel. Hier
erscheinen die Helden der Geschichte. Bacchus, ein
herkulischer Knabe tritt mit seinem mächtigen Schen-
kel, ein Schenkel, wie ihn Rubens gefesselter Simson
hat, den Beschauer fast ins Gesicht, der Kellermeister
490
genen gotischen Gewölben. Seinen Namen hat er von
dem merkwürdigen Echo, das an den Gewölberippen
geflüsterte Worte indiskret durch den ganzen Raum
leitet. Es spukt immer noch.
Der Dichter Wilhelm Hauff auf der Ratskellertreppe
Wer Slevogts Stil als Wandmaler aus den
bisher von ihm geschaffenen Dekorationen kannte,
mochte etwas in dieser Art erwarten, die sein
Schüler Dannemann an dieser Stelle fruchtbar ge-
macht hatte. Heiteren leicht über die Wände hinweg-
dekorierenden Schmuck. „Antikischer Form sich
nähernd“, wie jene bezaubernden Dinge in dem Pavillon
zu Neu-Gladow; orientalisch — venezianisch — tiepo-
lohaft — musikalisch — rokokohaft, wie jene Kostbar-
keiten in dem Pavillon am Kurfürstendamm und in dem
goldnen Wintergarten in der Rauchstraße. Kurz, etwas
in bekannter Slevogt’scher Manier. Es ist ganz etwas
Andres geworden. Etwas Bedeutenderes und, im guten
Sinne, Ernsteres. Slevogt ist mit jeder neuen großen
Aufgabe jedesmal wieder neu. Und er ist, wenn es zu
illustrieren gilt, jedesmal wieder ein treuer Diener am
Wort. Und hier ging es um Illustration einer Dichtung,
wenn auch einer märchenhaften Dichtung. Aus dem
Geiste des Poeten heraus schuf der bildende Künstler
seine Gemälde. Es hat, was von jeder guten Ulustration
zu fordern ist, „der bildende Künstler die Vorstellungen
des Dichters zu Ende gedacht“ — so wie es Goethe von
Delacroixs Lithographien zum Eaust vor hundert Jah-
ren mit Befriedigung bemerkte.
Slevogt malte also keine leichte Dekorationen, son-
dern feste, mit Rahmen abgegrenztc Gemälde, Fresken,
die fest, als bildrnäßig geschlossene Komopositioncn auf
den halbrunden Wandflächen stehen. Geschichten und
Begebenheiten aus den „Phantasien“. Nur das erste
Bild, der Eingangstür gegenüber, stammt nicht aus
Hauff: Die vier Bremer Stadtmusikanten durften an die-
ser historischen Stätte nicht fehlen.
Für alles, was er ersann, fand Slevogt neue persön-
liche Formulierungen. Keine der mancherlei Hauff-
Illustrationen — und es gibt ihrer viele — fällt einem
ein, wenn man vor diese Fresken tritt, ebensowenig
wie die gedrehte Pyramide, in der seit Generationen
immer die Bremer Stadtmusikanten aufgebaut zu wer-
den pflegten. Es ist nirgend eine sklavische Ausdeu-
tung des geschriebenen Themas versucht, soudern alles
erscheint als Geschöpf der freiwaltenden Phantasie..
Zwar ist alles da, man weiß alles sofort, aber es ist alles
auf eine ganz neue, ganz einmalige Weise da. Ueber
die Worte der Dichtung hinaus hat der Geist des
Poeten, die Stimmung des Volksmärchendichters den
Maler inspiriert.
Die vier Stadtmusikanten sitzen um einen Tisch
herum, beim Mahle, breit und quer. Der Hund schleckt
den Teller aus, der Hahn hat nichts gekriegt, der Esel,
vom Rücken gesehen, richtet sich drohend auf. Aber
die Katze „speist“ noch. Sie nimmt mit zierlichen Pfo-
ten ein Radieschen am langen Fadenstengel auf und
während sie es hochhebt, verwandelt sich dies Radies-
chen in eine Maus. Mit solchen Gespenstigkeiten
schlägt der Künstler die Harmonie an, in der sein Stück
zu spielen gedenkt. Spuk und Träume. In der Mitte
der Hauptwand sitzt die Stirnseite eines alten Fasses,
anno 1657, bunt bemalt und vergoldet, mit üppigster
Barock-Schnitzerei über und über bedeckt. Der Ver-
legenheit, die diese Ausfüllung der Fläche bot, warf sich
Slevogt in die Arme, komponierte sein Bild rund um das
Faß herum, führt das barocke Linienspiel weiter und
zog aus dem Bunt und Gold sein Farbenspiel. Hier
erscheinen die Helden der Geschichte. Bacchus, ein
herkulischer Knabe tritt mit seinem mächtigen Schen-
kel, ein Schenkel, wie ihn Rubens gefesselter Simson
hat, den Beschauer fast ins Gesicht, der Kellermeister
490