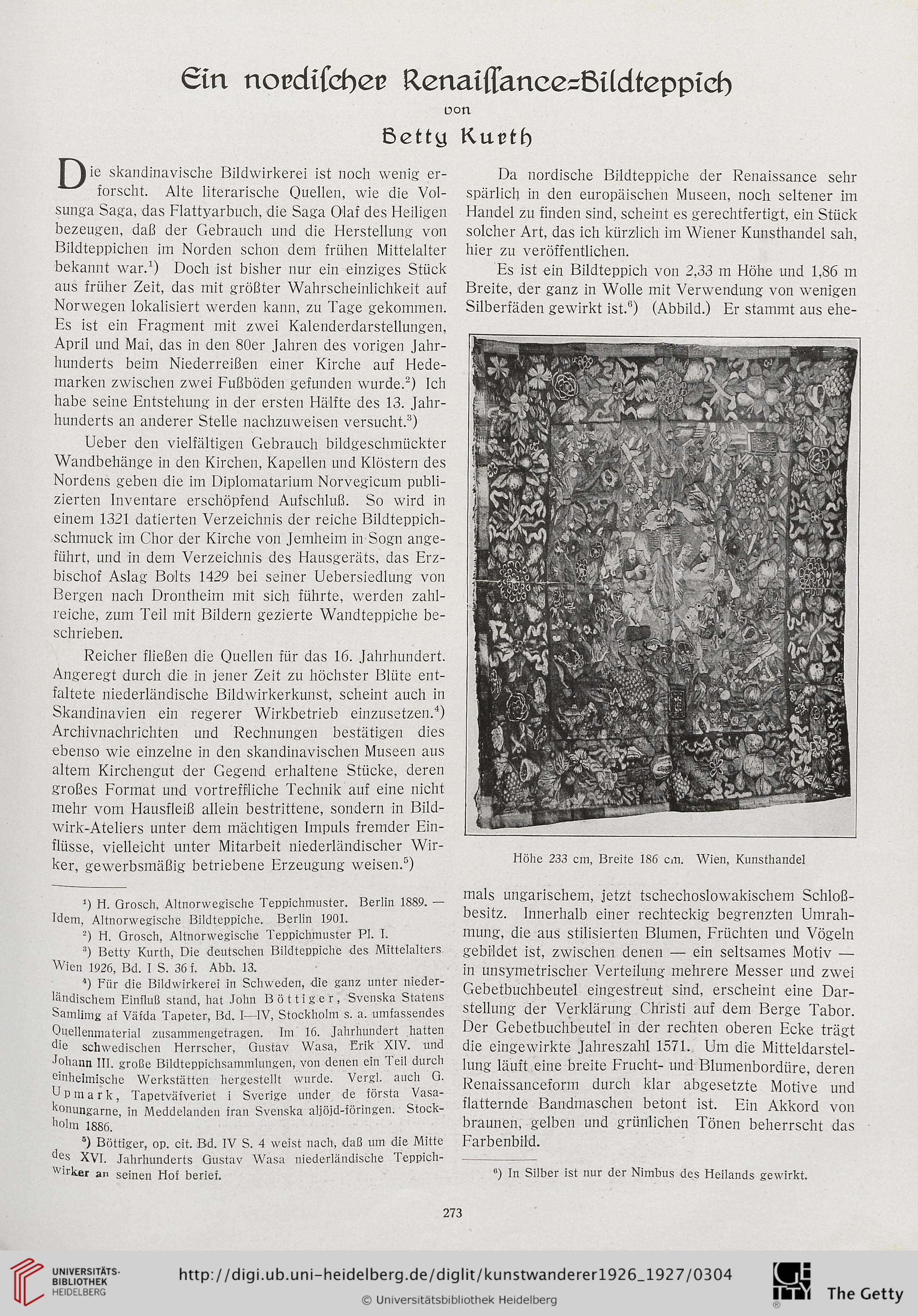6in nocdtfcbec RcnaifTancesBtldtcppicb
oon
Bctty Kuctt)
jie skandinavische Bildwirkerei ist noch wenig er-
forscht. Alte literarische Quellen, wie die Vol-
sunga Saga, das Flattyarbuch, die Saga Olaf des Heiligen
bezeugen, daß der Gebrauch und die Herstellung von
Bildteppichen im Norden schon dem frühen Mittelalter
bekannt war.1) Doch ist bisher nur ein einziges Stück
aus früher Zeit, das mit größter Wahrscheinlichkeit auf
Norwegen lokalisiert werden kann, zu Tage gekommen.
Es ist ein Fragment mit zwei Kalenderdarstellungen,
April und Mai, das in den 80er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts beim Niederreißen einer Kirche auf Hede-
marken zwischen zwei Fußböden gefunden wurde.2) Ich
habe seine Entstehung in der ersten Hä'lfte des 13. Jahr-
hunderts an anderer Stelle nachzuweisen versucht.3)
Ueber den vielfältigen Gebrauch bildgeschmückter
Wandbehänge in den Kirchen, Kapellen und Klöstern des
Nordens geben die im Diplomatarium Norvegicum publi-
zierten Inventare erschöpfend Aufschluß. So wird in
einem 1321 datierten Verzeichnis der reiche Bildteppich-
schmuck im Chor der Kirche von Jemheim in Sogn ange-
führt, und in dem Verzeichnis des Hausgeräts, das Erz-
bischof Aslag Bolts 1429 bei seiner Uebersiedlung von
Bergen nach Drontheim mit sich führte, werden zahl-
reiche, zum Teil mit Bildern gezierte Wandteppiche be-
schrieben.
Reicher fließen die Quellen für das 16. Jahrhundert.
Angeregt durch die in jener Zeit zu höchster Blüte ent-
faltete niederländische Bildwirkerkunst, scheint auch in
Skandinavien ein regerer Wirkbetrieb einzusetzen.4)
Archivnachrichten und Rechnungen bestätigen dies
ebenso wie einzelne in den skandinavischen Museen aus
altem Kirchengut der Gegend erhaltene Stücke, deren
großes Format und vortreffliche Technik auf eine nicht
mehr vom Hausfleiß allein bestrittene, sondern in Bild-
wirk-Ateliers unter dem mächtigen Impuls fremder Ein-
flüsse, vielleicht unter Mitarbeit niederländischer Wir-
ker, gewerbsmäßig betriebene Erzeugung weisen.5)
b H. Qrosch, Altnorwegische Teppichmuster. Berlin 1889. —
Idem, Aitnorwegische Bildteppiche. Berlin 1901.
-) H. Grosch, Altnorwegische Teppichmuster PI. I.
8) Betty Kurth, Die deutschen Bildteppiche des Mittelalters
Wien 1926, Bd. I S. 36 f. Abb. 13.
4) Für die Bildwirkerei in Schweden, die ganz unter nieder-
ländischem Einfluß stand, hat John Böttiger, Svenska Statens
Samlimg af Väfda Tapeter, Bd. I—IV, Stockholm s. a. umfassendes
Ouellenmaterial zusammengetragen. Im 16. Jahrhundert hatten
die schwedischen Herrscher, Gustav Wasa, Erik XIV. und
Johann III. große Bildteppichsammlungen, von denen cin I eil durch
cinhcimische Werkstätten liergestellt wurde. Vergl. auch G.
0 P m a r k, Tapetväfveriet i Sverige under de första Vasa-
^onungarne, in Meddelanden fran Svcnska aljöjd-föringen. Stock-
h°lm 1886.
B) Böttiger, op. cit. Bd. IV S. 4 weist nach, daß um die Mitte
des XVI. Jahrhunderts Gustav Wasa niederländische reppich-
wirker an seinen Hof berief.
Da nordische Bildteppiche der Renaissance sehr
spärlich in den europäischen Museen, noch seltener im
Handel zu finden sind, scheint es gerechtfertigt, ein Stück
solcher Art, das ich kürzlich im Wiener Kunsthandel sah,
hier zu veröffentlichen.
Es ist ein Bildteppich von 2,33 m Höhe und 1,86 m
Breite, der ganz in Wolle mit Verwendung von wenigen
Silberfäden gewirkt ist.G) (Abbild.) Er stammt aus ehe-
Höhe 233 cm, Breite 186 cm. Wien, Kunsthandel
mals ungarischem, jetzt tschechoslowakischem Schloß-
besitz. Innerhalb einer rechteckig begrenzten Umrah-
mung, die aus stilisierten Blumen, Früchten und Vögeln
gebildet ist, zwischen denen — ein seltsames Motiv —
in unsymetrischer Verteilung mehrere Messer und zwei
Gebetbuchbeutel eingestreut sind, erscheint eine Dar-
stellung der Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.
Der Gebetbuchbeutel in der rechten oberen Ecke trägt
die eingewirkte Jahreszahl 1571. Um die Mitteldarstel-
lung läuft eine breite Frucht- und Blumenbordüre, deren
Renaissanceform durch klar abgesetzte Motive und
flatternde Bandmaschen betont ist. Ein Akkord von
braunen, gelben und grünlichen Tönen beherrscht das
Farbenbild.
u) In Silber ist nur der Nimbus des Heilands gewirkt.
273
oon
Bctty Kuctt)
jie skandinavische Bildwirkerei ist noch wenig er-
forscht. Alte literarische Quellen, wie die Vol-
sunga Saga, das Flattyarbuch, die Saga Olaf des Heiligen
bezeugen, daß der Gebrauch und die Herstellung von
Bildteppichen im Norden schon dem frühen Mittelalter
bekannt war.1) Doch ist bisher nur ein einziges Stück
aus früher Zeit, das mit größter Wahrscheinlichkeit auf
Norwegen lokalisiert werden kann, zu Tage gekommen.
Es ist ein Fragment mit zwei Kalenderdarstellungen,
April und Mai, das in den 80er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts beim Niederreißen einer Kirche auf Hede-
marken zwischen zwei Fußböden gefunden wurde.2) Ich
habe seine Entstehung in der ersten Hä'lfte des 13. Jahr-
hunderts an anderer Stelle nachzuweisen versucht.3)
Ueber den vielfältigen Gebrauch bildgeschmückter
Wandbehänge in den Kirchen, Kapellen und Klöstern des
Nordens geben die im Diplomatarium Norvegicum publi-
zierten Inventare erschöpfend Aufschluß. So wird in
einem 1321 datierten Verzeichnis der reiche Bildteppich-
schmuck im Chor der Kirche von Jemheim in Sogn ange-
führt, und in dem Verzeichnis des Hausgeräts, das Erz-
bischof Aslag Bolts 1429 bei seiner Uebersiedlung von
Bergen nach Drontheim mit sich führte, werden zahl-
reiche, zum Teil mit Bildern gezierte Wandteppiche be-
schrieben.
Reicher fließen die Quellen für das 16. Jahrhundert.
Angeregt durch die in jener Zeit zu höchster Blüte ent-
faltete niederländische Bildwirkerkunst, scheint auch in
Skandinavien ein regerer Wirkbetrieb einzusetzen.4)
Archivnachrichten und Rechnungen bestätigen dies
ebenso wie einzelne in den skandinavischen Museen aus
altem Kirchengut der Gegend erhaltene Stücke, deren
großes Format und vortreffliche Technik auf eine nicht
mehr vom Hausfleiß allein bestrittene, sondern in Bild-
wirk-Ateliers unter dem mächtigen Impuls fremder Ein-
flüsse, vielleicht unter Mitarbeit niederländischer Wir-
ker, gewerbsmäßig betriebene Erzeugung weisen.5)
b H. Qrosch, Altnorwegische Teppichmuster. Berlin 1889. —
Idem, Aitnorwegische Bildteppiche. Berlin 1901.
-) H. Grosch, Altnorwegische Teppichmuster PI. I.
8) Betty Kurth, Die deutschen Bildteppiche des Mittelalters
Wien 1926, Bd. I S. 36 f. Abb. 13.
4) Für die Bildwirkerei in Schweden, die ganz unter nieder-
ländischem Einfluß stand, hat John Böttiger, Svenska Statens
Samlimg af Väfda Tapeter, Bd. I—IV, Stockholm s. a. umfassendes
Ouellenmaterial zusammengetragen. Im 16. Jahrhundert hatten
die schwedischen Herrscher, Gustav Wasa, Erik XIV. und
Johann III. große Bildteppichsammlungen, von denen cin I eil durch
cinhcimische Werkstätten liergestellt wurde. Vergl. auch G.
0 P m a r k, Tapetväfveriet i Sverige under de första Vasa-
^onungarne, in Meddelanden fran Svcnska aljöjd-föringen. Stock-
h°lm 1886.
B) Böttiger, op. cit. Bd. IV S. 4 weist nach, daß um die Mitte
des XVI. Jahrhunderts Gustav Wasa niederländische reppich-
wirker an seinen Hof berief.
Da nordische Bildteppiche der Renaissance sehr
spärlich in den europäischen Museen, noch seltener im
Handel zu finden sind, scheint es gerechtfertigt, ein Stück
solcher Art, das ich kürzlich im Wiener Kunsthandel sah,
hier zu veröffentlichen.
Es ist ein Bildteppich von 2,33 m Höhe und 1,86 m
Breite, der ganz in Wolle mit Verwendung von wenigen
Silberfäden gewirkt ist.G) (Abbild.) Er stammt aus ehe-
Höhe 233 cm, Breite 186 cm. Wien, Kunsthandel
mals ungarischem, jetzt tschechoslowakischem Schloß-
besitz. Innerhalb einer rechteckig begrenzten Umrah-
mung, die aus stilisierten Blumen, Früchten und Vögeln
gebildet ist, zwischen denen — ein seltsames Motiv —
in unsymetrischer Verteilung mehrere Messer und zwei
Gebetbuchbeutel eingestreut sind, erscheint eine Dar-
stellung der Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.
Der Gebetbuchbeutel in der rechten oberen Ecke trägt
die eingewirkte Jahreszahl 1571. Um die Mitteldarstel-
lung läuft eine breite Frucht- und Blumenbordüre, deren
Renaissanceform durch klar abgesetzte Motive und
flatternde Bandmaschen betont ist. Ein Akkord von
braunen, gelben und grünlichen Tönen beherrscht das
Farbenbild.
u) In Silber ist nur der Nimbus des Heilands gewirkt.
273