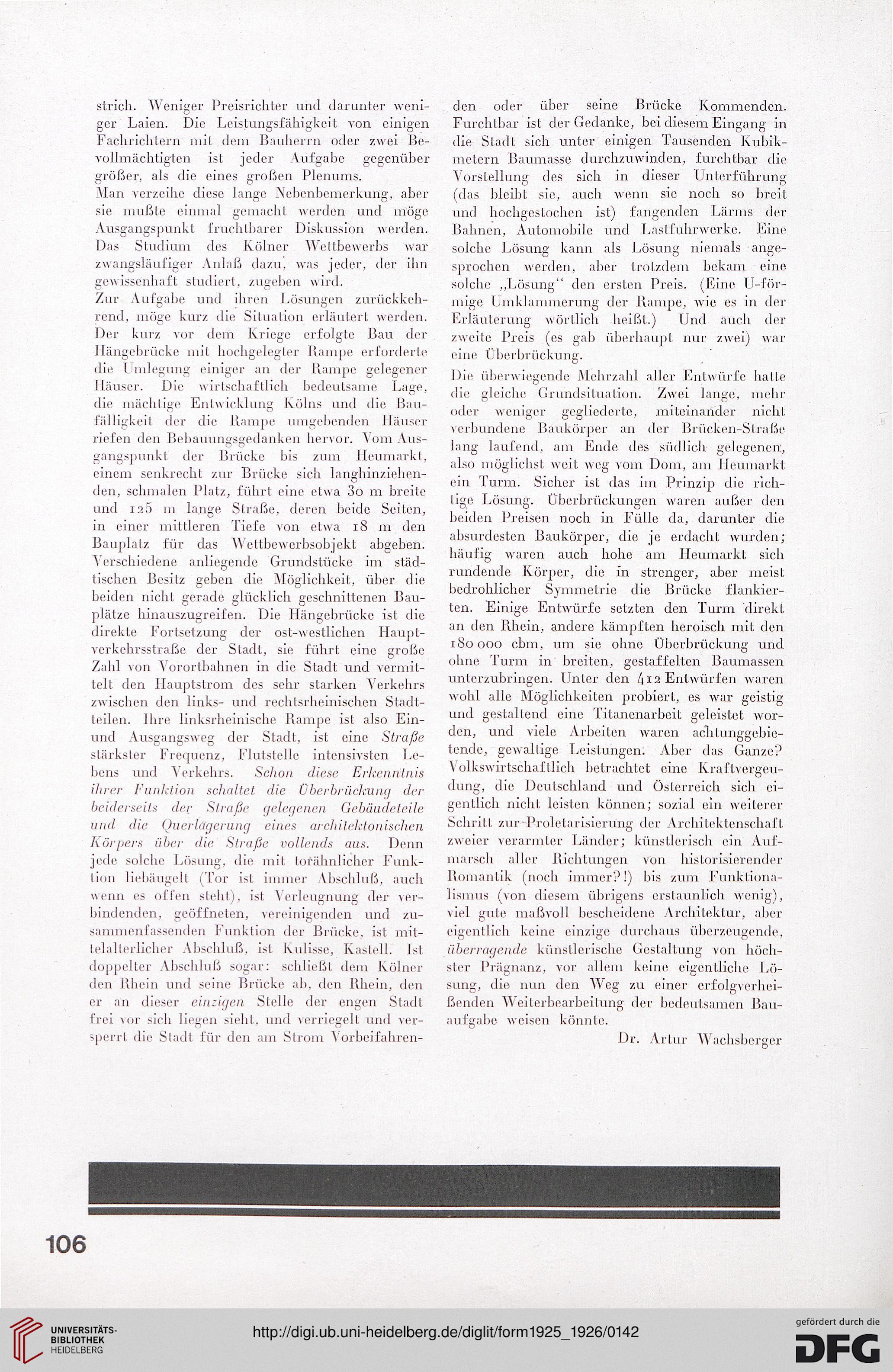strich. Weniger Preisrichter und darunter weni-
ger Laien. Die Leistungsfähigkeit von einigen
Faclirichlern mit dem Bauherrn oder zwei Be-
vollmächtigten ist jeder Aufgabe gegenüber
größer, als die eines großen Plenums.
Man verzeihe diese lange \ehenhemerkung, aber
sie mußte einmal gemacht «eitlen und möge
Ausgangspunkt fruchtbarer Diskussion werden.
Das Studium des kölner Wettbewerbs war
zwangsläufiger Anlaß dazu, was jeder, der ihn
gewissenhaft studiert, zugehen wird.
Zur Aufgabe und ihren Lösungen zurückkeh-
rend, möge kurz die Situation erläutert werden.
Der kurz Mir dem Kriege erfolgte Bau der
Hängebrücke mit hochgelegter Rampe erforderte
die Umlegung einiger an der Kampe gelegener
Häuser. Die wirtschaftlich bedeutsame Lage,
die mächtige Entwicklung Kölns und die Bau-
fälligkeil der die Kampe umgehenden Häuser
riefen den Kehauungsgedanken hervor. Vom Aus-
gangspunkt der Brücke bis zum Heumarkt,
einem senkrecht zur Brücke sich langhinziehen-
den, schmalen Platz, führt eine etwa 3o m breite
und i:?5 m lange Straße, deren beide Seiten,
in einer mittleren Tiefe von etwa 18 m den
Bauplatz für das Wettbewerbsobjekt abgeben.
Verschiedene anliegende Grundslücke im städ-
tischen Besitz geben die Möglichkeit, über die
beiden nicht gerade glücklich geschnittenen Bau-
plätze hinauszugreifen. Die Hängebrücke ist die
direkte Fortsetzung der ost-westlichen Haupt-
verkehrsstraße der Stadt, sie führt eine große
Zahl von Vororthahnen in die Stadt und vermit-
telt den Ilauptslrom des sehr starken A erkehrs
zwischen den links- und rechtsrheinischen Stadt-
teilen. Ihre linksrheinische Kampe ist also Ein-
und Ausgangsweg der Stadt, ist eine Straße
stärkster Frequenz, Flutstelle intensivsten Le-
bens und ^ erkehrs. Schon diese Erkenntnis
ihrer Funktion schallet, die l herhrüclainij der
beiderseits der St ruße gelegenen Gebäudeteile,
und die Querlagerung eines architektonischen
Körpers über die. Straße vollends aus. Denn
jede solche Lösung, die mii tofähnlicher Funk-
tion liebäugelt (Tor ist immer Abschluß, auch
wenn es offen steht), i>l Verleugnung der ver-
bindenden, geöffneten, vereinigenden und zu-
sammenfassenden Funktion der Brücke, ist mit-
telalterlicher Abschluß, ist Kulisse, Kastell. Ist
doppelter Abschluß sogar: schließt dem Kölner
den Rhein und seine Brücke ab, den Rhein, den
er an dieser einzigen Stelle der engen Stadt
frei vor sich liegen sieht, und verriegelt und ver-
sperrt die Sladt für den am Strom Vorbeifahren-
den oder über seine Brücke Kommenden.
Furchtbar ist der Gedanke, bei diesem Eingang in
die Sladt sich unter einigen Tausenden Kubik-
metern Baumasse durchzuwinden, furchtbar die
Vorstellung des sich in dieser Unterführung
(das bleibt sie. auch wenn sie noch so breit
und hochgestochen ist) fangenden Lärms der
Bahnen, Automobile und Lastfuhrwerke. Eine
solche Lösung kann als Lösung niemals ange-
sprochen werden, aber trotzdem bekam eine
solche „Lösung" den ersten Preis. (Eine LI-för-
mige Umklammerung der Rampe, wie es in der
Erläuterung wörtlich heißt.) Und auch der
zweite Preis (es gab überhaupt nur zwei) war
eine l berbrückunu'.
Die überwiegende Mehrzahl aller Entwürfe halle
die gleiche Grundsituation. Zwei lange, mein'
oder weniger gegliederte, miteinander nicht
verbundene Baukörper au der Krücken-Straße
lang laufend, am Ende des südlieh gelegenen,
also möglichst weil weg vom Dom, am Heumarkt
ein Turm. Sicher isL das im Prinzip die rich-
tige Lösung. Überbrückungen waren außer den
beiden Preisen noch in Fülle da, darunter die
absurdesten Baukörper, die je erdacht wurden;
häufig waren auch hohe am Heumarkt sich
rundende Körper, die in strenger, aber meist
bedrohlicher Symmetrie die Brücke flankier-
ten. Einige Entwürfe setzten den Turm direkt
an den Rhein, andere kämpften heroisch mit den
180000 cbm, um sie ohne Überbrückung und
ohne Turm in breiten, gestaffelten Baumassen
unterzubringen. Unter den 4*2 Entwürfen waren
wohl alle Möglichkeilen probiert, es war geistig
und gestaltend eine Titanenarbeit geleistet wor-
den, und viele Arbeilen waren achtunggebie-
tende, gewaltige Leistungen. Aber das Ganze?
Volkswirtschaftlich betrachtet eine Kraftvergeu-
dung, die Deutschland und Österreich sich ei-
gentlich nicht leisten können; sozial ein weiterer
Schrill zur Prolelarisierimg der Architektenschaft
zweier verarmter Länder; künstlerisch ein Auf-
marsch aller Richtungen von historisierender
Romantik (noch immer?!) bis zum Funktiona-
lismus (von diesem übrigens erstaunlich wenig),
viel gute maßvoll bescheidene Architektur, aber
eigentlich keine einzige durchaus überzeugende,
überragende künstlerische Gestaltung von höch-
ster Prägnanz, vor allem keine eigentliche Lö-
sung, die nun den Weg zu einer erfolgverhei-
ßenden Weiterbearbeilung der bedeutsamen Bau-
aufgabe weisen könnte.
Dr. Vrtur Wachsberger
106
ger Laien. Die Leistungsfähigkeit von einigen
Faclirichlern mit dem Bauherrn oder zwei Be-
vollmächtigten ist jeder Aufgabe gegenüber
größer, als die eines großen Plenums.
Man verzeihe diese lange \ehenhemerkung, aber
sie mußte einmal gemacht «eitlen und möge
Ausgangspunkt fruchtbarer Diskussion werden.
Das Studium des kölner Wettbewerbs war
zwangsläufiger Anlaß dazu, was jeder, der ihn
gewissenhaft studiert, zugehen wird.
Zur Aufgabe und ihren Lösungen zurückkeh-
rend, möge kurz die Situation erläutert werden.
Der kurz Mir dem Kriege erfolgte Bau der
Hängebrücke mit hochgelegter Rampe erforderte
die Umlegung einiger an der Kampe gelegener
Häuser. Die wirtschaftlich bedeutsame Lage,
die mächtige Entwicklung Kölns und die Bau-
fälligkeil der die Kampe umgehenden Häuser
riefen den Kehauungsgedanken hervor. Vom Aus-
gangspunkt der Brücke bis zum Heumarkt,
einem senkrecht zur Brücke sich langhinziehen-
den, schmalen Platz, führt eine etwa 3o m breite
und i:?5 m lange Straße, deren beide Seiten,
in einer mittleren Tiefe von etwa 18 m den
Bauplatz für das Wettbewerbsobjekt abgeben.
Verschiedene anliegende Grundslücke im städ-
tischen Besitz geben die Möglichkeit, über die
beiden nicht gerade glücklich geschnittenen Bau-
plätze hinauszugreifen. Die Hängebrücke ist die
direkte Fortsetzung der ost-westlichen Haupt-
verkehrsstraße der Stadt, sie führt eine große
Zahl von Vororthahnen in die Stadt und vermit-
telt den Ilauptslrom des sehr starken A erkehrs
zwischen den links- und rechtsrheinischen Stadt-
teilen. Ihre linksrheinische Kampe ist also Ein-
und Ausgangsweg der Stadt, ist eine Straße
stärkster Frequenz, Flutstelle intensivsten Le-
bens und ^ erkehrs. Schon diese Erkenntnis
ihrer Funktion schallet, die l herhrüclainij der
beiderseits der St ruße gelegenen Gebäudeteile,
und die Querlagerung eines architektonischen
Körpers über die. Straße vollends aus. Denn
jede solche Lösung, die mii tofähnlicher Funk-
tion liebäugelt (Tor ist immer Abschluß, auch
wenn es offen steht), i>l Verleugnung der ver-
bindenden, geöffneten, vereinigenden und zu-
sammenfassenden Funktion der Brücke, ist mit-
telalterlicher Abschluß, ist Kulisse, Kastell. Ist
doppelter Abschluß sogar: schließt dem Kölner
den Rhein und seine Brücke ab, den Rhein, den
er an dieser einzigen Stelle der engen Stadt
frei vor sich liegen sieht, und verriegelt und ver-
sperrt die Sladt für den am Strom Vorbeifahren-
den oder über seine Brücke Kommenden.
Furchtbar ist der Gedanke, bei diesem Eingang in
die Sladt sich unter einigen Tausenden Kubik-
metern Baumasse durchzuwinden, furchtbar die
Vorstellung des sich in dieser Unterführung
(das bleibt sie. auch wenn sie noch so breit
und hochgestochen ist) fangenden Lärms der
Bahnen, Automobile und Lastfuhrwerke. Eine
solche Lösung kann als Lösung niemals ange-
sprochen werden, aber trotzdem bekam eine
solche „Lösung" den ersten Preis. (Eine LI-för-
mige Umklammerung der Rampe, wie es in der
Erläuterung wörtlich heißt.) Und auch der
zweite Preis (es gab überhaupt nur zwei) war
eine l berbrückunu'.
Die überwiegende Mehrzahl aller Entwürfe halle
die gleiche Grundsituation. Zwei lange, mein'
oder weniger gegliederte, miteinander nicht
verbundene Baukörper au der Krücken-Straße
lang laufend, am Ende des südlieh gelegenen,
also möglichst weil weg vom Dom, am Heumarkt
ein Turm. Sicher isL das im Prinzip die rich-
tige Lösung. Überbrückungen waren außer den
beiden Preisen noch in Fülle da, darunter die
absurdesten Baukörper, die je erdacht wurden;
häufig waren auch hohe am Heumarkt sich
rundende Körper, die in strenger, aber meist
bedrohlicher Symmetrie die Brücke flankier-
ten. Einige Entwürfe setzten den Turm direkt
an den Rhein, andere kämpften heroisch mit den
180000 cbm, um sie ohne Überbrückung und
ohne Turm in breiten, gestaffelten Baumassen
unterzubringen. Unter den 4*2 Entwürfen waren
wohl alle Möglichkeilen probiert, es war geistig
und gestaltend eine Titanenarbeit geleistet wor-
den, und viele Arbeilen waren achtunggebie-
tende, gewaltige Leistungen. Aber das Ganze?
Volkswirtschaftlich betrachtet eine Kraftvergeu-
dung, die Deutschland und Österreich sich ei-
gentlich nicht leisten können; sozial ein weiterer
Schrill zur Prolelarisierimg der Architektenschaft
zweier verarmter Länder; künstlerisch ein Auf-
marsch aller Richtungen von historisierender
Romantik (noch immer?!) bis zum Funktiona-
lismus (von diesem übrigens erstaunlich wenig),
viel gute maßvoll bescheidene Architektur, aber
eigentlich keine einzige durchaus überzeugende,
überragende künstlerische Gestaltung von höch-
ster Prägnanz, vor allem keine eigentliche Lö-
sung, die nun den Weg zu einer erfolgverhei-
ßenden Weiterbearbeilung der bedeutsamen Bau-
aufgabe weisen könnte.
Dr. Vrtur Wachsberger
106