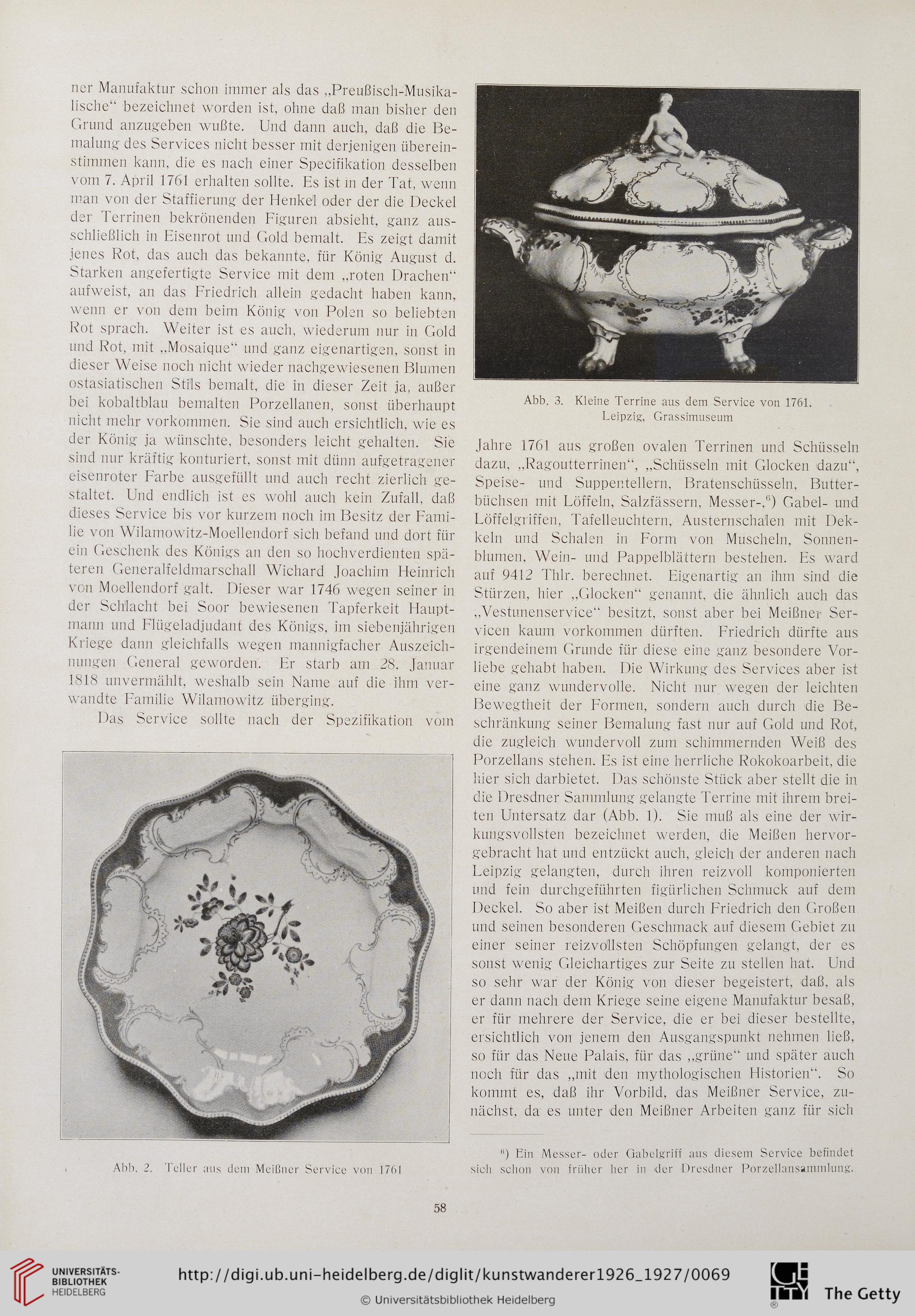ner Manufaktur schon immer als das „Preußisch-Musika-
lische“ bezeichnet worden ist, ohne daß man bisher den
Grund anzugeben wußte. Und dann auch, daß die Be-
malung des Services nicht besser mit derjenigen überein-
stimmen kann, die es nach einer Specifikation desselben
vom 7. April 1761 erhalten sollte. Es ist m der Tat, wenn
man von der Staffierung der Henke'l oder der die Deckel
der Terrinen bekrönenden Figuren absieht, ganz aus-
schließlich in Eisenrot und Gold bemalt. Es zeigt damit
jenes Rot, das auch das bekannte, für König August d.
Starken angefertigte Service mit dem „roten Drachen“
aufweist, an das Friedrich allein gedacht haben kann,
wenn er von dem beim König von Polen so beliebten
Rot sprach. Weiter ist es auch, wiederum nur in Gold
und Rot, mit „Mosaique“ und ganz eigenartigen, sonst in
dieser Weise noch nicht wieder nachgewiesenen Blumen
ostasiatischen Stils bemalt, die in dieser Zeit ja, außer
bei kobaltblau bemalten Porzellanen, sonst iiberhaupt
nicht mehr vorkommen. Sie sind auch ersichtlich, wie es
der König ja wünschte, besonders leicht gehalten. Sie
sind nur kräftig konturiert, sonst mit dünn aufgetragener
eisenroter Farbe ausgefüllt und auch recht zierlich ge-
staltet. Und endlich ist es wohl auch kein Zufall, daß
dieses Service bis vor kurzem nocli im Besitz der Fami-
lie von Wilamowitz-Moellendorf sicli befand und dort fiir
ein Geschenk des Königs an den so hochverdienten spä-
teren Generalfeldmarschall Wichard Joachim Heinrich
von Moellendorf galt. Dieser war 1746 wegen seiner in
der Schlacht bei Soor bewiesenen Tapferkeit Haupt-
mann und Flügeladjudant des Königs, im siebenjährigen
Kriege dann gleichfalls wegen mannigfacher Auszeich-
nungen General gcworden. Er starb am 28. Januar
1818 unvermählt, weshalb sein Name auf die ihm ver-
wandte Familie Wilamowitz überging.
Das Service sollte nach der Spezifikation vom
Ahb. 2. Teger aus dem Meißner Serviee von 17hl
Abb. 3. Kleine Terrine aus dem Service von 1761.
Leipzig, Grassimuseum
Jahre 1761 aus großen ovalen Terrinen und Schüsseln
dazu, „Ragoutterrinen“, „Schüsseln mit Glocken dazu“,
Speise- und Suppentellern, Bratenschüsseln, Butter-
büchsen mit Föffeln, Salzfässern, Messer-,6) Gabel- und
Föffelgriffen, Tafelleuchtern, Austernschalen mit Dek-
keln und Schalen in Form von Muscheln, Sonnen-
blumen, Wein- und Pappelblättern bestehen. Es ward
auf 9412 Thlr. berechnet. Eigenartig an ihm sind die
Stürzen, hier „Glocken“ genannt, die ähnlich auch das
„Vestunenservice“ besitzt, sonst aber bei Meißner Ser-
vicen kaum vorkommen dürften. Friedrich dürfte aus
irgendeinem Grunde l'ür diese eine ganz besondere Vor-
liebe gehabt haben. Die Wirkung des Services aber ist
eine ganz wundervolle. Nicht nur wegeu der leichten
Bewcgtheit der Formen, sondern auch durch die Be-
schränkung seiner Bemalung fast nur auf Gold und Rot,
die zugleich wundervoll zum schimmernden Weiß des
Porzellans stehen. Es ist eine herrliche Rokokoarbeit, die
hier sich darbietet. Das schönste Stück aber stellt die in
die Dresdner Sammlung gelangte Terrine mit ihrem brei-
ten Untersatz dar (Abb. 1). Sie muß als eine der wir-
kungsvollsten bezeichnet werden, die Meißen hervor-
gebracht hat und entzückt auch, gleich der anderen nach
Feipzig gelangten, durch ihren reizvoll komponierten
u.nd fein durchgeführten figürlichen Schmuck auf dem
Deckel. So aber ist Meißen durch Friedrich den Großen
und seinen besonderen Geschmack auf diesem Gebiet zu
einer seiner reizvo'llsten Schöpfungen gelangt, der es
sonst wenig Gleichartiges zur Seite zu stellen hat. Und
so sehr war der König von dieser begeistert, daß, als
er dann nach dem Kriege seine eigene Manufaktur besaß,
er für mehrere der Service, die er bei dieser bestellte,
ersichtlich von jenem den Ausgangspunkt nehmen ließ,
so für das Neue Palais, für das „grüne'“ und später auch
noch für das „mit den mythologischen Historien“. So
kommt es, daß ihr Vorbild, das Meißner Service, zu-
nächst, da es unter den Meißner Arbeiten ganz für sich
l!) Ein Messer- oder Gabelsriff aus diesem Service befindet
sioli sclion von friilier her in >der Dresdner Porzellansammlung.
58
lische“ bezeichnet worden ist, ohne daß man bisher den
Grund anzugeben wußte. Und dann auch, daß die Be-
malung des Services nicht besser mit derjenigen überein-
stimmen kann, die es nach einer Specifikation desselben
vom 7. April 1761 erhalten sollte. Es ist m der Tat, wenn
man von der Staffierung der Henke'l oder der die Deckel
der Terrinen bekrönenden Figuren absieht, ganz aus-
schließlich in Eisenrot und Gold bemalt. Es zeigt damit
jenes Rot, das auch das bekannte, für König August d.
Starken angefertigte Service mit dem „roten Drachen“
aufweist, an das Friedrich allein gedacht haben kann,
wenn er von dem beim König von Polen so beliebten
Rot sprach. Weiter ist es auch, wiederum nur in Gold
und Rot, mit „Mosaique“ und ganz eigenartigen, sonst in
dieser Weise noch nicht wieder nachgewiesenen Blumen
ostasiatischen Stils bemalt, die in dieser Zeit ja, außer
bei kobaltblau bemalten Porzellanen, sonst iiberhaupt
nicht mehr vorkommen. Sie sind auch ersichtlich, wie es
der König ja wünschte, besonders leicht gehalten. Sie
sind nur kräftig konturiert, sonst mit dünn aufgetragener
eisenroter Farbe ausgefüllt und auch recht zierlich ge-
staltet. Und endlich ist es wohl auch kein Zufall, daß
dieses Service bis vor kurzem nocli im Besitz der Fami-
lie von Wilamowitz-Moellendorf sicli befand und dort fiir
ein Geschenk des Königs an den so hochverdienten spä-
teren Generalfeldmarschall Wichard Joachim Heinrich
von Moellendorf galt. Dieser war 1746 wegen seiner in
der Schlacht bei Soor bewiesenen Tapferkeit Haupt-
mann und Flügeladjudant des Königs, im siebenjährigen
Kriege dann gleichfalls wegen mannigfacher Auszeich-
nungen General gcworden. Er starb am 28. Januar
1818 unvermählt, weshalb sein Name auf die ihm ver-
wandte Familie Wilamowitz überging.
Das Service sollte nach der Spezifikation vom
Ahb. 2. Teger aus dem Meißner Serviee von 17hl
Abb. 3. Kleine Terrine aus dem Service von 1761.
Leipzig, Grassimuseum
Jahre 1761 aus großen ovalen Terrinen und Schüsseln
dazu, „Ragoutterrinen“, „Schüsseln mit Glocken dazu“,
Speise- und Suppentellern, Bratenschüsseln, Butter-
büchsen mit Föffeln, Salzfässern, Messer-,6) Gabel- und
Föffelgriffen, Tafelleuchtern, Austernschalen mit Dek-
keln und Schalen in Form von Muscheln, Sonnen-
blumen, Wein- und Pappelblättern bestehen. Es ward
auf 9412 Thlr. berechnet. Eigenartig an ihm sind die
Stürzen, hier „Glocken“ genannt, die ähnlich auch das
„Vestunenservice“ besitzt, sonst aber bei Meißner Ser-
vicen kaum vorkommen dürften. Friedrich dürfte aus
irgendeinem Grunde l'ür diese eine ganz besondere Vor-
liebe gehabt haben. Die Wirkung des Services aber ist
eine ganz wundervolle. Nicht nur wegeu der leichten
Bewcgtheit der Formen, sondern auch durch die Be-
schränkung seiner Bemalung fast nur auf Gold und Rot,
die zugleich wundervoll zum schimmernden Weiß des
Porzellans stehen. Es ist eine herrliche Rokokoarbeit, die
hier sich darbietet. Das schönste Stück aber stellt die in
die Dresdner Sammlung gelangte Terrine mit ihrem brei-
ten Untersatz dar (Abb. 1). Sie muß als eine der wir-
kungsvollsten bezeichnet werden, die Meißen hervor-
gebracht hat und entzückt auch, gleich der anderen nach
Feipzig gelangten, durch ihren reizvoll komponierten
u.nd fein durchgeführten figürlichen Schmuck auf dem
Deckel. So aber ist Meißen durch Friedrich den Großen
und seinen besonderen Geschmack auf diesem Gebiet zu
einer seiner reizvo'llsten Schöpfungen gelangt, der es
sonst wenig Gleichartiges zur Seite zu stellen hat. Und
so sehr war der König von dieser begeistert, daß, als
er dann nach dem Kriege seine eigene Manufaktur besaß,
er für mehrere der Service, die er bei dieser bestellte,
ersichtlich von jenem den Ausgangspunkt nehmen ließ,
so für das Neue Palais, für das „grüne'“ und später auch
noch für das „mit den mythologischen Historien“. So
kommt es, daß ihr Vorbild, das Meißner Service, zu-
nächst, da es unter den Meißner Arbeiten ganz für sich
l!) Ein Messer- oder Gabelsriff aus diesem Service befindet
sioli sclion von friilier her in >der Dresdner Porzellansammlung.
58