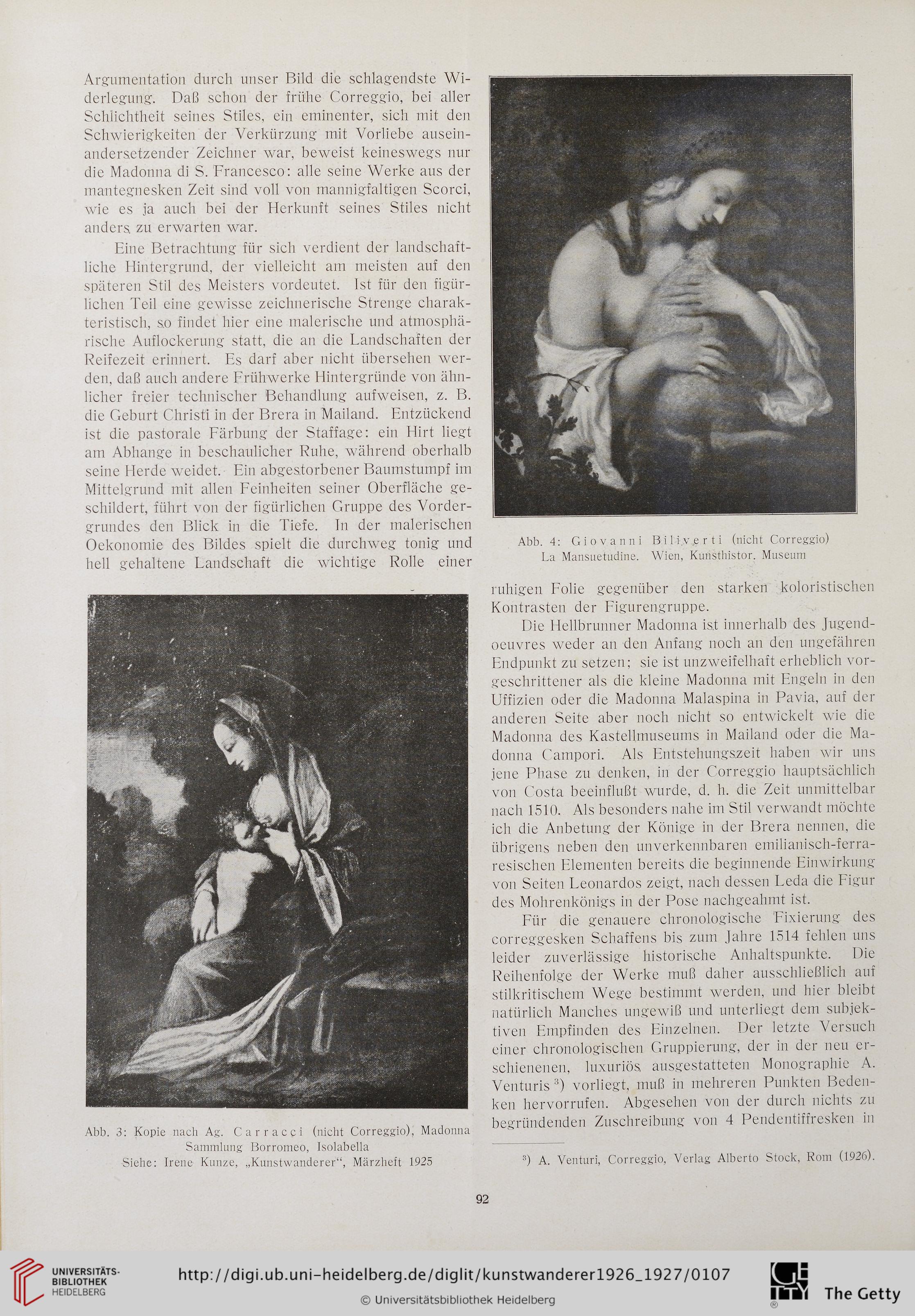Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0107
DOI issue:
1/2. Novemberheft
DOI article:Voss, Hermann: Ein unbekanntes Frühwerk Correggios
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0107
Arg’iimentation durch unser Bild die schlagendste Wi-
derlegung. Daß schon der friihe Correggio, bei aller
Schlichtheit seines Stiles, ein eminenter, sich mit den
Schwierigkeiten der Verkürzung mit Vorliebe ausein-
andersetzender Zeichner war, beweist keineswegs nur
die Madonna di S. 'Francesco: alle seine Werke aus der
mantegnesken Zeit sind voll von mannigfaltigen Scorci,
wie es ja auch bei der Herkunft seines Stiles nicht
anders, zu erwarten war.
Eine Betrachtung für sicli verdient der landschaft-
liclie Hintergrund, der vielleieht am meisten auf den
späteren Stil des Meisters vordeutet. Ist für den figür-
lichen Teil eine gewisse zeichnerische Strenge charak-
teristisch, s.o findet hier eine malerische und atmosphä-
rische Auflockerung statt, die an die Landschaften der
Reifezeit erinnert. Es darf aber nicht übersehen wer-
den, daß auch andere Frühwerke Hintergründe von ähn-
licher freier technischer Behandlung aufweisen, z. B.
die Geburt Christi in der Brera in Mailand. Entzückend
ist die pastorale Färbung der Staffage: ein Hirt liegt
am Abhange in beschaulicher Ruhe, während oberhalb
seine Herde weidet. Ein abges.torbener Baumstumpf im
Mittelgrund mit allen Feinheiten seiner Oberfläche ge-
schildert, führt von der figürlichen Gruppe des Vorder-
grundes den Blick in die Tiefe. In der malerischen
Oekonomie des Bildes spielt die durchweg tonig und
hell gehaltene Landschaft die wichtige Rolle einer
Abb. 3: Kopie nach Ag. Carracci (nicht Correggio), Madonna
Sammlung Borromeo, Isolabella
Siehe: Irene Kunze, „Kunstwanderer“, Märzheft 1925
Abb. 4: Giovanni Bil i.v.,e r t i (nicht Correggio)
La Mansuetudine. Wien, Kunsthistor. Museum
ruhigen Folie gegenüber den starken koloristischen
Kontrasten der Figurengruppe.
Die Hellbrunner Madonna is.t innerhalb des Jugend-
ocuvres weder an den Anfang noch an dcn ungefähren
Endpunkt zu setzen; sie ist unzweifelhaft erheblich vor-
geschrittener als die kleine Madonna mit Engeln in den
Uffizien oder die Madonna Malaspina in Pavia, auf der
anderen Seite aber noch nicht so entwickelt wie die
Madonna des Kastellmuseums in Mailand oder die Ma-
donna Gampori. Als Entstehungszeit haben wir uns
jene Phase zu denken, in der Correggio hauptsächlich
von Costa beeinflußt wurde, d. h. die Zeit uumittelbar
nach 1510. Als besonders nahe im Stil verwandt möchte
ich die Anbetung der Könige in der Brera nennen, die
übrigens neben den unverkennbaren emilianisch-ferra-
resischen Elementen bereits die beginnende Einwirkung
von Seiten Leonardos zeigt, nach des.sen Leda die Figur
des Mohrenkönigs in der Pose nachgeahmt ist.
Für die genauere chronologische Fixierung des
correggesken Schaffens bis zum Jahre 1514 fehlen uns
ieider zuverlässige historis.che Anhaltspunkte. Die
Reihenfolge der Werke muß daher ausschließlich auf
stilkritischem Wege bestimmt werden, und hier bleibt
natürlich Manches ungewiß und unterliegt dem subjek-
tiven Empfinden des Einzelnen. Der letzte Versuch
einer chronologisclien Gruppierung, der in der neu er-
schienenen, luxuriös, ausgestatteten Monographie A.
Venturis 3) vorliegt, muß in mehreren Punkten Beden-
ken hervorrufen. Abgesehen von der durcli nichts zu
begründenden Zuschreibung von 4 Pendentiffresken in
92
J A. Venturi, Correggio, Verlag Alberto Stock, Rom (1926).
derlegung. Daß schon der friihe Correggio, bei aller
Schlichtheit seines Stiles, ein eminenter, sich mit den
Schwierigkeiten der Verkürzung mit Vorliebe ausein-
andersetzender Zeichner war, beweist keineswegs nur
die Madonna di S. 'Francesco: alle seine Werke aus der
mantegnesken Zeit sind voll von mannigfaltigen Scorci,
wie es ja auch bei der Herkunft seines Stiles nicht
anders, zu erwarten war.
Eine Betrachtung für sicli verdient der landschaft-
liclie Hintergrund, der vielleieht am meisten auf den
späteren Stil des Meisters vordeutet. Ist für den figür-
lichen Teil eine gewisse zeichnerische Strenge charak-
teristisch, s.o findet hier eine malerische und atmosphä-
rische Auflockerung statt, die an die Landschaften der
Reifezeit erinnert. Es darf aber nicht übersehen wer-
den, daß auch andere Frühwerke Hintergründe von ähn-
licher freier technischer Behandlung aufweisen, z. B.
die Geburt Christi in der Brera in Mailand. Entzückend
ist die pastorale Färbung der Staffage: ein Hirt liegt
am Abhange in beschaulicher Ruhe, während oberhalb
seine Herde weidet. Ein abges.torbener Baumstumpf im
Mittelgrund mit allen Feinheiten seiner Oberfläche ge-
schildert, führt von der figürlichen Gruppe des Vorder-
grundes den Blick in die Tiefe. In der malerischen
Oekonomie des Bildes spielt die durchweg tonig und
hell gehaltene Landschaft die wichtige Rolle einer
Abb. 3: Kopie nach Ag. Carracci (nicht Correggio), Madonna
Sammlung Borromeo, Isolabella
Siehe: Irene Kunze, „Kunstwanderer“, Märzheft 1925
Abb. 4: Giovanni Bil i.v.,e r t i (nicht Correggio)
La Mansuetudine. Wien, Kunsthistor. Museum
ruhigen Folie gegenüber den starken koloristischen
Kontrasten der Figurengruppe.
Die Hellbrunner Madonna is.t innerhalb des Jugend-
ocuvres weder an den Anfang noch an dcn ungefähren
Endpunkt zu setzen; sie ist unzweifelhaft erheblich vor-
geschrittener als die kleine Madonna mit Engeln in den
Uffizien oder die Madonna Malaspina in Pavia, auf der
anderen Seite aber noch nicht so entwickelt wie die
Madonna des Kastellmuseums in Mailand oder die Ma-
donna Gampori. Als Entstehungszeit haben wir uns
jene Phase zu denken, in der Correggio hauptsächlich
von Costa beeinflußt wurde, d. h. die Zeit uumittelbar
nach 1510. Als besonders nahe im Stil verwandt möchte
ich die Anbetung der Könige in der Brera nennen, die
übrigens neben den unverkennbaren emilianisch-ferra-
resischen Elementen bereits die beginnende Einwirkung
von Seiten Leonardos zeigt, nach des.sen Leda die Figur
des Mohrenkönigs in der Pose nachgeahmt ist.
Für die genauere chronologische Fixierung des
correggesken Schaffens bis zum Jahre 1514 fehlen uns
ieider zuverlässige historis.che Anhaltspunkte. Die
Reihenfolge der Werke muß daher ausschließlich auf
stilkritischem Wege bestimmt werden, und hier bleibt
natürlich Manches ungewiß und unterliegt dem subjek-
tiven Empfinden des Einzelnen. Der letzte Versuch
einer chronologisclien Gruppierung, der in der neu er-
schienenen, luxuriös, ausgestatteten Monographie A.
Venturis 3) vorliegt, muß in mehreren Punkten Beden-
ken hervorrufen. Abgesehen von der durcli nichts zu
begründenden Zuschreibung von 4 Pendentiffresken in
92
J A. Venturi, Correggio, Verlag Alberto Stock, Rom (1926).