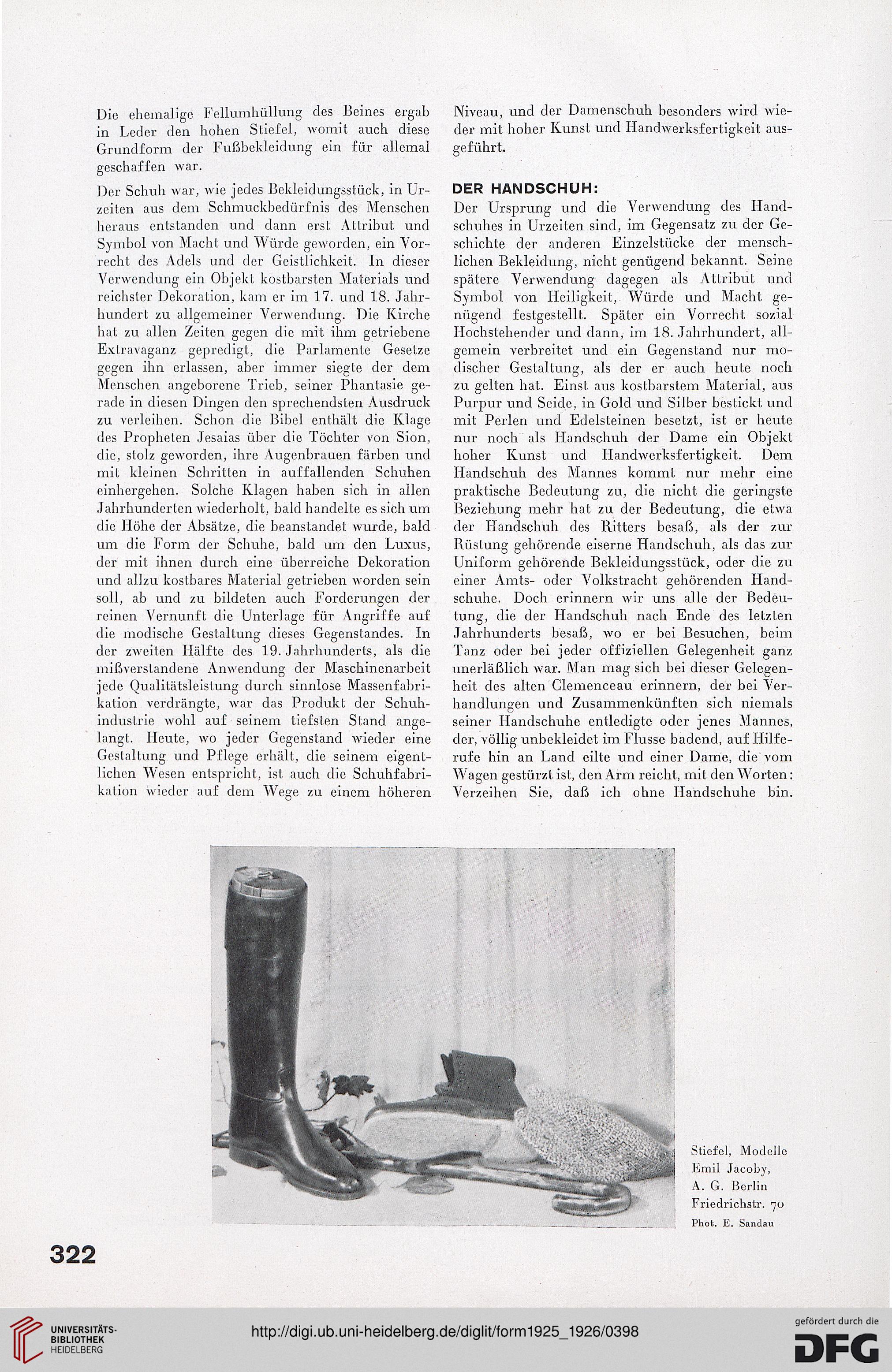Die ehemalige Fellumhüllung des Beines ergab
in Leder den hohen Stiefel., womit auch diese
Grundform der Fußbekleidung ein für allemal
geschaffen war.
Der Schuh war, wie jedes Bekleidungsstück, in Ur-
zeiten aus dem Schmuckbedürfnis des Menschen
heraus entstanden und dann erst Attribut und
Symbol von Macht und Würde geworden, ein Vor-
recht des Adels und der Geistlichkeit. In dieser
Verwendung ein Objekt kostbarsten Materials und
reichster Dekoration, kam er im 17. und 18. Jahr-
hundert zu allgemeiner Verwendung. Die Kirche
hat zu allen Zeiten gegen die mit ihm getriebene
Extravaganz gepredigt, die Parlamente Gesetze
gegen ihn erlassen, aber immer siegte der dem
Menschen angeborene Trieb, seiner Phantasie ge-
rade in diesen Dingen den sprechendsten Ausdruck
zu verleihen. Schon die Bibel enthält die Klage
des Propheten Jesaias über die Töchter von Sion,
die, stolz geworden, ihre Augenbrauen färben und
mit kleinen Schritten in auffallenden Schuhen
einhergehen. Solche Klagen haben sich in allen
Jahrhunderten wiederholt, bald handelte es sich um
die Höhe der Absätze, die beanstandet wurde, bald
um die Form der Schuhe, bald um den Luxus,
der mit ihnen durch eine überreiche Dekoration
und allzu kostbares Material getrieben worden sein
soll, ab und zu bildeten auch Forderungen der
reinen Vernunft die Unterlage für Angriffe auf
die modische Gestaltung dieses Gegenstandes. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die
mißverstandene Anwendung der Maschinenarbeit
jede Qualitätsleislung durch sinnlose Massenfabri-
kation verdrängte, war das Produkt der Schuh-
industrie wohl auf seinem tiefsten Stand ange-
langt. Heute, wo jeder Gegenstand wieder eine
Gestaltung und Pflege erhält, die seinem eigent-
lichen Wesen entspricht, ist auch die Schuhfabri-
kalion wieder auf dem Wege zu einem höheren
Niveau, und der Damenschuh besonders wird wie-
der mit hoher Kunst und Handwerksfertigkeit aus-
geführt.
DER HANDSCHUH:
Der Ursprung und die Verwendung des Hand-
schuhes in Urzeiten sind, im Gegensatz zu der Ge-
schichte der anderen Einzelstücke der mensch-
lichen Bekleidung, nicht genügend bekannt. Seine
spätere Verwendung dagegen als Attribut und
Symbol von Heiligkeit, Würde und Macht ge-
nügend festgestellt. Später ein Vorrecht sozial
Hochstehender und dann, im 18. Jahrhundert, all-
gemein verbreitet und ein Gegenstand nur mo-
discher Gestaltung, als der er auch heule noch
zu gelten hat. Einst aus kostbarstem Material, aus
Purpur und Seide, in Gold und Silber bestickt und
mit Perlen und Edelsteinen besetzt, ist er heute
nur noch als Handschuh der Dame ein Objekt
hoher Kunst und Handwcrksfertigkeit. Dem
Handschuh des Mannes kommt nur mehr eine
praktische Bedeutung zu, die nicht die geringste
Beziehung mehr hat zu der Bedeutung, die etwa
der Handschuh des Bitters besaß, als der zur
Rüstung gehörende eiserne Handschuh, als das zur
Uniform gehörende Bekleidungsstück, oder die zu
einer Amts- oder Volkstracht gehörenden Hand-
schuhe. Doch erinnern wir uns alle der Bedeu-
tung, die der Handschuh nach Ende des letzlen
Jahrhunderls besaß, wo er bei Besuchen, beim
Tanz oder bei jeder offiziellen Gelegenheit ganz
unerläßlich war. Man mag sich bei dieser Gelegen-
heit des alten Clemcnceau erinnern, der bei Ver-
handlungen und Zusammenkünften sich niemals
seiner Handschuhe entledigte oder jenes Mannes,
der, völlig unbekleidet im Flusse badend, auf Hilfe-
rufe hin an Land eilte und einer Dame, die vom
Wagen gestürzt ist, den Arm reicht, mit den Worten:
Verzeihen Sic, daß ich ohne Handschuhe bin.
in Leder den hohen Stiefel., womit auch diese
Grundform der Fußbekleidung ein für allemal
geschaffen war.
Der Schuh war, wie jedes Bekleidungsstück, in Ur-
zeiten aus dem Schmuckbedürfnis des Menschen
heraus entstanden und dann erst Attribut und
Symbol von Macht und Würde geworden, ein Vor-
recht des Adels und der Geistlichkeit. In dieser
Verwendung ein Objekt kostbarsten Materials und
reichster Dekoration, kam er im 17. und 18. Jahr-
hundert zu allgemeiner Verwendung. Die Kirche
hat zu allen Zeiten gegen die mit ihm getriebene
Extravaganz gepredigt, die Parlamente Gesetze
gegen ihn erlassen, aber immer siegte der dem
Menschen angeborene Trieb, seiner Phantasie ge-
rade in diesen Dingen den sprechendsten Ausdruck
zu verleihen. Schon die Bibel enthält die Klage
des Propheten Jesaias über die Töchter von Sion,
die, stolz geworden, ihre Augenbrauen färben und
mit kleinen Schritten in auffallenden Schuhen
einhergehen. Solche Klagen haben sich in allen
Jahrhunderten wiederholt, bald handelte es sich um
die Höhe der Absätze, die beanstandet wurde, bald
um die Form der Schuhe, bald um den Luxus,
der mit ihnen durch eine überreiche Dekoration
und allzu kostbares Material getrieben worden sein
soll, ab und zu bildeten auch Forderungen der
reinen Vernunft die Unterlage für Angriffe auf
die modische Gestaltung dieses Gegenstandes. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die
mißverstandene Anwendung der Maschinenarbeit
jede Qualitätsleislung durch sinnlose Massenfabri-
kation verdrängte, war das Produkt der Schuh-
industrie wohl auf seinem tiefsten Stand ange-
langt. Heute, wo jeder Gegenstand wieder eine
Gestaltung und Pflege erhält, die seinem eigent-
lichen Wesen entspricht, ist auch die Schuhfabri-
kalion wieder auf dem Wege zu einem höheren
Niveau, und der Damenschuh besonders wird wie-
der mit hoher Kunst und Handwerksfertigkeit aus-
geführt.
DER HANDSCHUH:
Der Ursprung und die Verwendung des Hand-
schuhes in Urzeiten sind, im Gegensatz zu der Ge-
schichte der anderen Einzelstücke der mensch-
lichen Bekleidung, nicht genügend bekannt. Seine
spätere Verwendung dagegen als Attribut und
Symbol von Heiligkeit, Würde und Macht ge-
nügend festgestellt. Später ein Vorrecht sozial
Hochstehender und dann, im 18. Jahrhundert, all-
gemein verbreitet und ein Gegenstand nur mo-
discher Gestaltung, als der er auch heule noch
zu gelten hat. Einst aus kostbarstem Material, aus
Purpur und Seide, in Gold und Silber bestickt und
mit Perlen und Edelsteinen besetzt, ist er heute
nur noch als Handschuh der Dame ein Objekt
hoher Kunst und Handwcrksfertigkeit. Dem
Handschuh des Mannes kommt nur mehr eine
praktische Bedeutung zu, die nicht die geringste
Beziehung mehr hat zu der Bedeutung, die etwa
der Handschuh des Bitters besaß, als der zur
Rüstung gehörende eiserne Handschuh, als das zur
Uniform gehörende Bekleidungsstück, oder die zu
einer Amts- oder Volkstracht gehörenden Hand-
schuhe. Doch erinnern wir uns alle der Bedeu-
tung, die der Handschuh nach Ende des letzlen
Jahrhunderls besaß, wo er bei Besuchen, beim
Tanz oder bei jeder offiziellen Gelegenheit ganz
unerläßlich war. Man mag sich bei dieser Gelegen-
heit des alten Clemcnceau erinnern, der bei Ver-
handlungen und Zusammenkünften sich niemals
seiner Handschuhe entledigte oder jenes Mannes,
der, völlig unbekleidet im Flusse badend, auf Hilfe-
rufe hin an Land eilte und einer Dame, die vom
Wagen gestürzt ist, den Arm reicht, mit den Worten:
Verzeihen Sic, daß ich ohne Handschuhe bin.