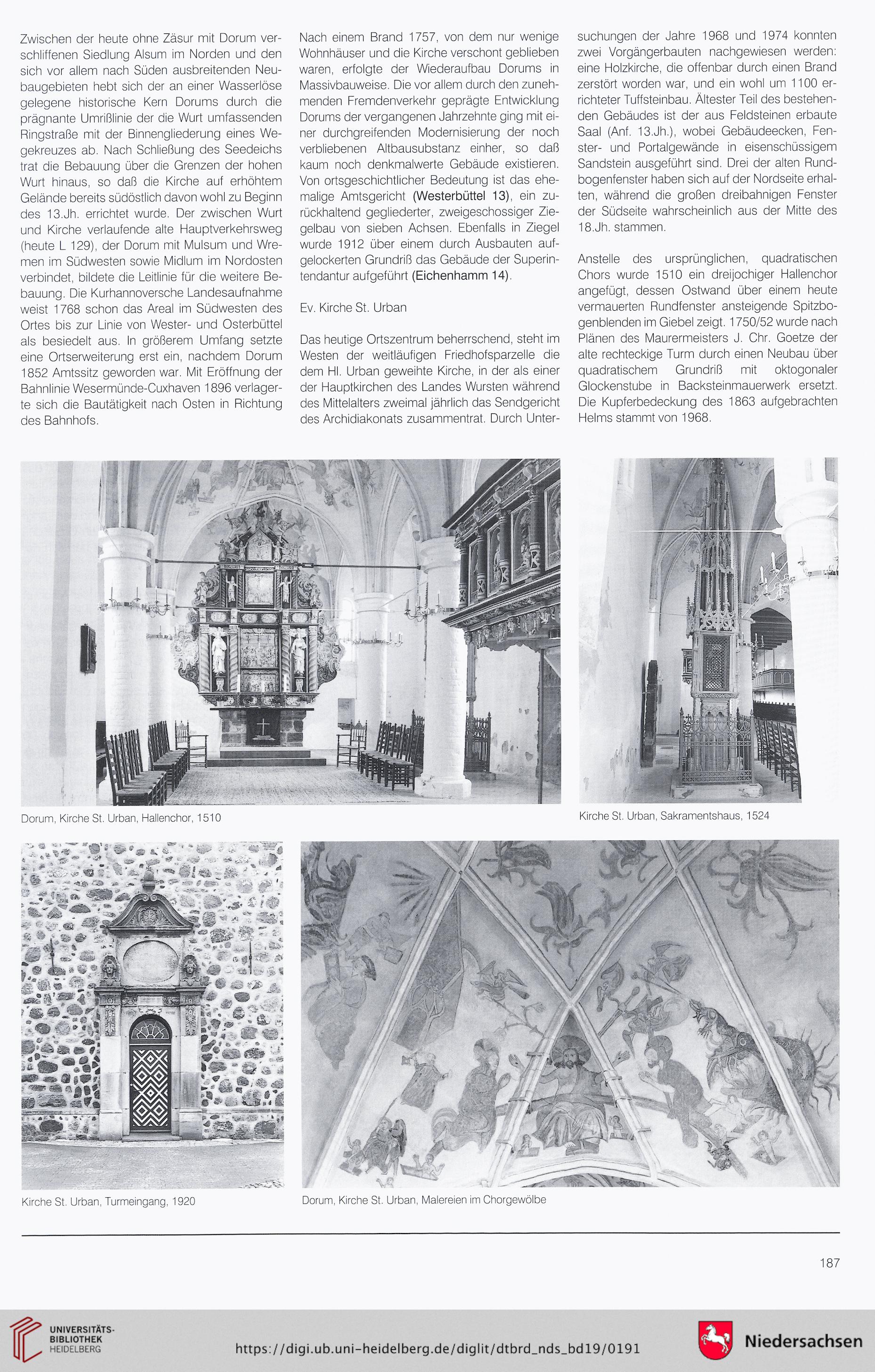Zwischen der heute ohne Zäsur mit Dorum ver-
schliffenen Siedlung Alsum im Norden und den
sich vor allem nach Süden ausbreitenden Neu-
baugebieten hebt sich der an einer Wasserlöse
gelegene historische Kern Dorums durch die
prägnante Umrißlinie der die Wurt umfassenden
Ringstraße mit der Binnengliederung eines We-
gekreuzes ab. Nach Schließung des Seedeichs
trat die Bebauung über die Grenzen der hohen
Wurt hinaus, so daß die Kirche auf erhöhtem
Gelände bereits südöstlich davon wohl zu Beginn
des 13.Jh. errichtet wurde. Der zwischen Wurt
und Kirche verlaufende alte Hauptverkehrsweg
(heute L 129), der Dorum mit Mulsum und Wre-
men im Südwesten sowie Midlum im Nordosten
verbindet, bildete die Leitlinie für die weitere Be-
bauung. Die Kurhannoversche Landesaufnahme
weist 1768 schon das Areal im Südwesten des
Ortes bis zur Linie von Wester- und Osterbüttel
als besiedelt aus. In größerem Umfang setzte
eine Ortserweiterung erst ein, nachdem Dorum
1852 Amtssitz geworden war. Mit Eröffnung der
Bahnlinie Wesermünde-Cuxhaven 1896 verlager-
te sich die Bautätigkeit nach Osten in Richtung
des Bahnhofs.
Nach einem Brand 1757, von dem nur wenige
Wohnhäuser und die Kirche verschont geblieben
waren, erfolgte der Wiederaufbau Dorums in
Massivbauweise. Die vor allem durch den zuneh-
menden Fremdenverkehr geprägte Entwicklung
Dorums der vergangenen Jahrzehnte ging mit ei-
ner durchgreifenden Modernisierung der noch
verbliebenen Altbausubstanz einher, so daß
kaum noch denkmalwerte Gebäude existieren.
Von ortsgeschichtlicher Bedeutung ist das ehe-
malige Amtsgericht (Westerbüttel 13), ein zu-
rückhaltend gegliederter, zweigeschossiger Zie-
gelbau von sieben Achsen. Ebenfalls in Ziegel
wurde 1912 über einem durch Ausbauten auf-
gelockerten Grundri8 das Gebäude der Superin-
tendantur aufgeführt (Eichenhamm 14).
Ev. Kirche St. Urban
Das heutige Ortszentrum beherrschend, steht im
Westen der weitläufigen Friedhofsparzelle die
dem Hl. Urban geweihte Kirche, in der als einer
der Hauptkirchen des Landes Wursten während
des Mittelalters zweimal jährlich das Sendgericht
des Archidiakonats zusammentrat. Durch Unter-
suchungen der Jahre 1968 und 1974 konnten
zwei Vorgängerbauten nachgewiesen werden:
eine Holzkirche, die offenbar durch einen Brand
zerstört worden war, und ein wohl um 1100 er-
richteter Tuffsteinbau. Ältester Teil des bestehen-
den Gebäudes ist der aus Feldsteinen erbaute
Saal (Anf. 13.Jh.), wobei Gebäudeecken, Fen-
ster- und Portalgewände in eisenschüssigem
Sandstein ausgeführt sind. Drei der alten Rund-
bogenfenster haben sich auf der Nordseite erhal-
ten, während die großen dreibahnigen Fenster
der Südseite wahrscheinlich aus der Mitte des
18.Jh. stammen.
Anstelle des ursprünglichen, quadratischen
Chors wurde 1510 ein dreijochiger Hallenchor
angefügt, dessen Ostwand über einem heute
vermauerten Rundfenster ansteigende Spitzbo-
genblenden im Giebel zeigt. 1750/52 wurde nach
Plänen des Maurermeisters J. Chr. Goetze der
alte rechteckige Turm durch einen Neubau über
quadratischem GrundriB8 mit _oktogonaler
Glockenstube in Backsteinmauerwerk ersetzt.
Die Kupferbedeckung des 1863 aufgebrachten
Helms stammt von 1968.
187
schliffenen Siedlung Alsum im Norden und den
sich vor allem nach Süden ausbreitenden Neu-
baugebieten hebt sich der an einer Wasserlöse
gelegene historische Kern Dorums durch die
prägnante Umrißlinie der die Wurt umfassenden
Ringstraße mit der Binnengliederung eines We-
gekreuzes ab. Nach Schließung des Seedeichs
trat die Bebauung über die Grenzen der hohen
Wurt hinaus, so daß die Kirche auf erhöhtem
Gelände bereits südöstlich davon wohl zu Beginn
des 13.Jh. errichtet wurde. Der zwischen Wurt
und Kirche verlaufende alte Hauptverkehrsweg
(heute L 129), der Dorum mit Mulsum und Wre-
men im Südwesten sowie Midlum im Nordosten
verbindet, bildete die Leitlinie für die weitere Be-
bauung. Die Kurhannoversche Landesaufnahme
weist 1768 schon das Areal im Südwesten des
Ortes bis zur Linie von Wester- und Osterbüttel
als besiedelt aus. In größerem Umfang setzte
eine Ortserweiterung erst ein, nachdem Dorum
1852 Amtssitz geworden war. Mit Eröffnung der
Bahnlinie Wesermünde-Cuxhaven 1896 verlager-
te sich die Bautätigkeit nach Osten in Richtung
des Bahnhofs.
Nach einem Brand 1757, von dem nur wenige
Wohnhäuser und die Kirche verschont geblieben
waren, erfolgte der Wiederaufbau Dorums in
Massivbauweise. Die vor allem durch den zuneh-
menden Fremdenverkehr geprägte Entwicklung
Dorums der vergangenen Jahrzehnte ging mit ei-
ner durchgreifenden Modernisierung der noch
verbliebenen Altbausubstanz einher, so daß
kaum noch denkmalwerte Gebäude existieren.
Von ortsgeschichtlicher Bedeutung ist das ehe-
malige Amtsgericht (Westerbüttel 13), ein zu-
rückhaltend gegliederter, zweigeschossiger Zie-
gelbau von sieben Achsen. Ebenfalls in Ziegel
wurde 1912 über einem durch Ausbauten auf-
gelockerten Grundri8 das Gebäude der Superin-
tendantur aufgeführt (Eichenhamm 14).
Ev. Kirche St. Urban
Das heutige Ortszentrum beherrschend, steht im
Westen der weitläufigen Friedhofsparzelle die
dem Hl. Urban geweihte Kirche, in der als einer
der Hauptkirchen des Landes Wursten während
des Mittelalters zweimal jährlich das Sendgericht
des Archidiakonats zusammentrat. Durch Unter-
suchungen der Jahre 1968 und 1974 konnten
zwei Vorgängerbauten nachgewiesen werden:
eine Holzkirche, die offenbar durch einen Brand
zerstört worden war, und ein wohl um 1100 er-
richteter Tuffsteinbau. Ältester Teil des bestehen-
den Gebäudes ist der aus Feldsteinen erbaute
Saal (Anf. 13.Jh.), wobei Gebäudeecken, Fen-
ster- und Portalgewände in eisenschüssigem
Sandstein ausgeführt sind. Drei der alten Rund-
bogenfenster haben sich auf der Nordseite erhal-
ten, während die großen dreibahnigen Fenster
der Südseite wahrscheinlich aus der Mitte des
18.Jh. stammen.
Anstelle des ursprünglichen, quadratischen
Chors wurde 1510 ein dreijochiger Hallenchor
angefügt, dessen Ostwand über einem heute
vermauerten Rundfenster ansteigende Spitzbo-
genblenden im Giebel zeigt. 1750/52 wurde nach
Plänen des Maurermeisters J. Chr. Goetze der
alte rechteckige Turm durch einen Neubau über
quadratischem GrundriB8 mit _oktogonaler
Glockenstube in Backsteinmauerwerk ersetzt.
Die Kupferbedeckung des 1863 aufgebrachten
Helms stammt von 1968.
187