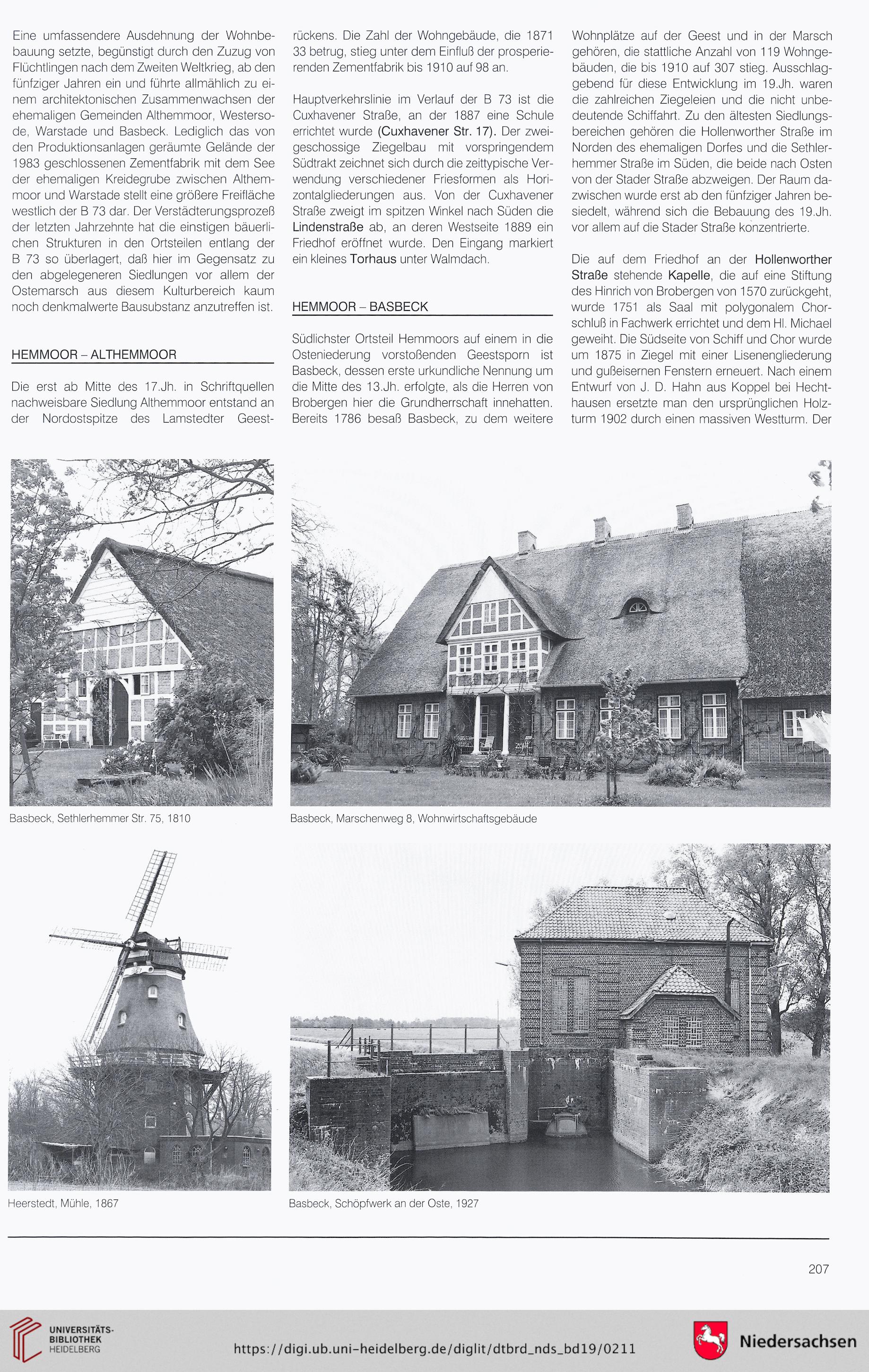Eine umfassendere Ausdehnung der Wohnbe-
bauung setzte, begünstigt durch den Zuzug von
Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den
fünfziger Jahren ein und führte allmählich zu ei-
nem architektonischen Zusammenwachsen der
ehemaligen Gemeinden Althnemmoor, Westerso-
de, Warstade und Basbeck. Lediglich das von
den Produktionsanlagen geräumte Gelände der
1983 geschlossenen Zementfabrik mit dem See
der ehemaligen Kreidegrube zwischen Althem-
moor und Warstade stellt eine größere Freifläche
westlich der B 73 dar. Der Verstädterungsprozeß
der letzten Jahrzehnte hat die einstigen bäuerli-
chen Strukturen in den Ortsteilen entlang der
B 73 so überlagert, daß hier im Gegensatz zu
den abgelegeneren Siedlungen vor allem der
Ostemarsch aus diesem Kulturbereich kaum
noch denkmalwerte Bausubstanz anzutreffen ist.
HEMMOOR - ALTHEMMOOR
Die erst ab Mitte des 17.Jh. in Schriftquellen
nachweisbare Siedlung Althemmoor entstand an
der MNordostspitze des
Lamstedter Geest-
rückens. Die Zahl der Wohngebäude, die 1871
33 betrug, stieg unter dem Einfluß der prosperie-
renden Zementfabrik bis 1910 auf 98 an.
Hauptverkehrslinie im Verlauf der B 73 ist die
Cuxhavener Straße, an der 1887 eine Schule
errichtet wurde (Cuxhavener Str. 17). Der zwei-
geschossige Ziegelbau mit vorspringendem
Südtrakt zeichnet sich durch die zeittypische Ver-
wendung verschiedener Friesformen als Hori-
zontalgliederungen aus. Von der Cuxhavener
Straße zweigt im spitzen Winkel nach Süden die
Lindenstraße ab, an deren Westseite 1889 ein
Friedhof eröffnet wurde. Den Eingang markiert
ein kleines Torhaus unter Walmdach.
HEMMOOR —- BASBECK
Südlichster Ortsteil Hemmoors auf einem in die
Osteniederung vorstoßenden Geestsporn ist
Basbeck, dessen erste urkundliche Nennung um
die Mitte des 13.Jh. erfolgte, als die Herren von
Brobergen hier die Grundherrschaft innehatten.
Bereits 1786 besaß Basbeck, zu dem weitere
Wohnplätze auf der Geest und in der Marsch
gehören, die stattliche Anzahl von 119 Wohnge-
bäuden, die bis 1910 auf 307 stieg. Ausschlag-
gebend für diese Entwicklung im 19.Jh. waren
die zahlreichen Ziegeleien und die nicht unbe-
deutende Schiffahrt. Zu den ältesten Siedlungs-
bereichen gehören die Hollenworther Straße im
Norden des ehemaligen Dorfes und die Sethler-
hemmer Straße im Süden, die beide nach Osten
von der Stader Straße abzweigen. Der Raum da-
zwischen wurde erst ab den fünfziger Jahren be-
siedelt, während sich die Bebauung des 19.Jh.
vor allem auf die Stader Straße konzentrierte.
Die auf dem Friedhof an der Hollenworther
Straße stehende Kapelle, die auf eine Stiftung
des Hinrich von Brobergen von 1570 zurückgeht,
wurde 1751 als Saal mit polygonalem Chor-
schluß in Fachwerk errichtet und dem HI. Michael
geweiht. Die Südseite von Schiff und Chor wurde
um 1875 in Ziegel mit einer Lisenengliederung
und gußeisernen Fenstern erneuert. Nach einem
Entwurf von J. D. Hahn aus Koppel bei Hecht-
hausen ersetzte man den ursprünglichen Holz-
turm 1902 durch einen massiven Westturm. Der
Basbeck, Sethlerhemmer Str. 75, 1810
Heerstedt, Mühle, 1867
Basbeck, Schöpfwerk an der Oste, 1927
Basbeck, Marschenweg 8, Wohnwirtschaftsgebäude
207
bauung setzte, begünstigt durch den Zuzug von
Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den
fünfziger Jahren ein und führte allmählich zu ei-
nem architektonischen Zusammenwachsen der
ehemaligen Gemeinden Althnemmoor, Westerso-
de, Warstade und Basbeck. Lediglich das von
den Produktionsanlagen geräumte Gelände der
1983 geschlossenen Zementfabrik mit dem See
der ehemaligen Kreidegrube zwischen Althem-
moor und Warstade stellt eine größere Freifläche
westlich der B 73 dar. Der Verstädterungsprozeß
der letzten Jahrzehnte hat die einstigen bäuerli-
chen Strukturen in den Ortsteilen entlang der
B 73 so überlagert, daß hier im Gegensatz zu
den abgelegeneren Siedlungen vor allem der
Ostemarsch aus diesem Kulturbereich kaum
noch denkmalwerte Bausubstanz anzutreffen ist.
HEMMOOR - ALTHEMMOOR
Die erst ab Mitte des 17.Jh. in Schriftquellen
nachweisbare Siedlung Althemmoor entstand an
der MNordostspitze des
Lamstedter Geest-
rückens. Die Zahl der Wohngebäude, die 1871
33 betrug, stieg unter dem Einfluß der prosperie-
renden Zementfabrik bis 1910 auf 98 an.
Hauptverkehrslinie im Verlauf der B 73 ist die
Cuxhavener Straße, an der 1887 eine Schule
errichtet wurde (Cuxhavener Str. 17). Der zwei-
geschossige Ziegelbau mit vorspringendem
Südtrakt zeichnet sich durch die zeittypische Ver-
wendung verschiedener Friesformen als Hori-
zontalgliederungen aus. Von der Cuxhavener
Straße zweigt im spitzen Winkel nach Süden die
Lindenstraße ab, an deren Westseite 1889 ein
Friedhof eröffnet wurde. Den Eingang markiert
ein kleines Torhaus unter Walmdach.
HEMMOOR —- BASBECK
Südlichster Ortsteil Hemmoors auf einem in die
Osteniederung vorstoßenden Geestsporn ist
Basbeck, dessen erste urkundliche Nennung um
die Mitte des 13.Jh. erfolgte, als die Herren von
Brobergen hier die Grundherrschaft innehatten.
Bereits 1786 besaß Basbeck, zu dem weitere
Wohnplätze auf der Geest und in der Marsch
gehören, die stattliche Anzahl von 119 Wohnge-
bäuden, die bis 1910 auf 307 stieg. Ausschlag-
gebend für diese Entwicklung im 19.Jh. waren
die zahlreichen Ziegeleien und die nicht unbe-
deutende Schiffahrt. Zu den ältesten Siedlungs-
bereichen gehören die Hollenworther Straße im
Norden des ehemaligen Dorfes und die Sethler-
hemmer Straße im Süden, die beide nach Osten
von der Stader Straße abzweigen. Der Raum da-
zwischen wurde erst ab den fünfziger Jahren be-
siedelt, während sich die Bebauung des 19.Jh.
vor allem auf die Stader Straße konzentrierte.
Die auf dem Friedhof an der Hollenworther
Straße stehende Kapelle, die auf eine Stiftung
des Hinrich von Brobergen von 1570 zurückgeht,
wurde 1751 als Saal mit polygonalem Chor-
schluß in Fachwerk errichtet und dem HI. Michael
geweiht. Die Südseite von Schiff und Chor wurde
um 1875 in Ziegel mit einer Lisenengliederung
und gußeisernen Fenstern erneuert. Nach einem
Entwurf von J. D. Hahn aus Koppel bei Hecht-
hausen ersetzte man den ursprünglichen Holz-
turm 1902 durch einen massiven Westturm. Der
Basbeck, Sethlerhemmer Str. 75, 1810
Heerstedt, Mühle, 1867
Basbeck, Schöpfwerk an der Oste, 1927
Basbeck, Marschenweg 8, Wohnwirtschaftsgebäude
207