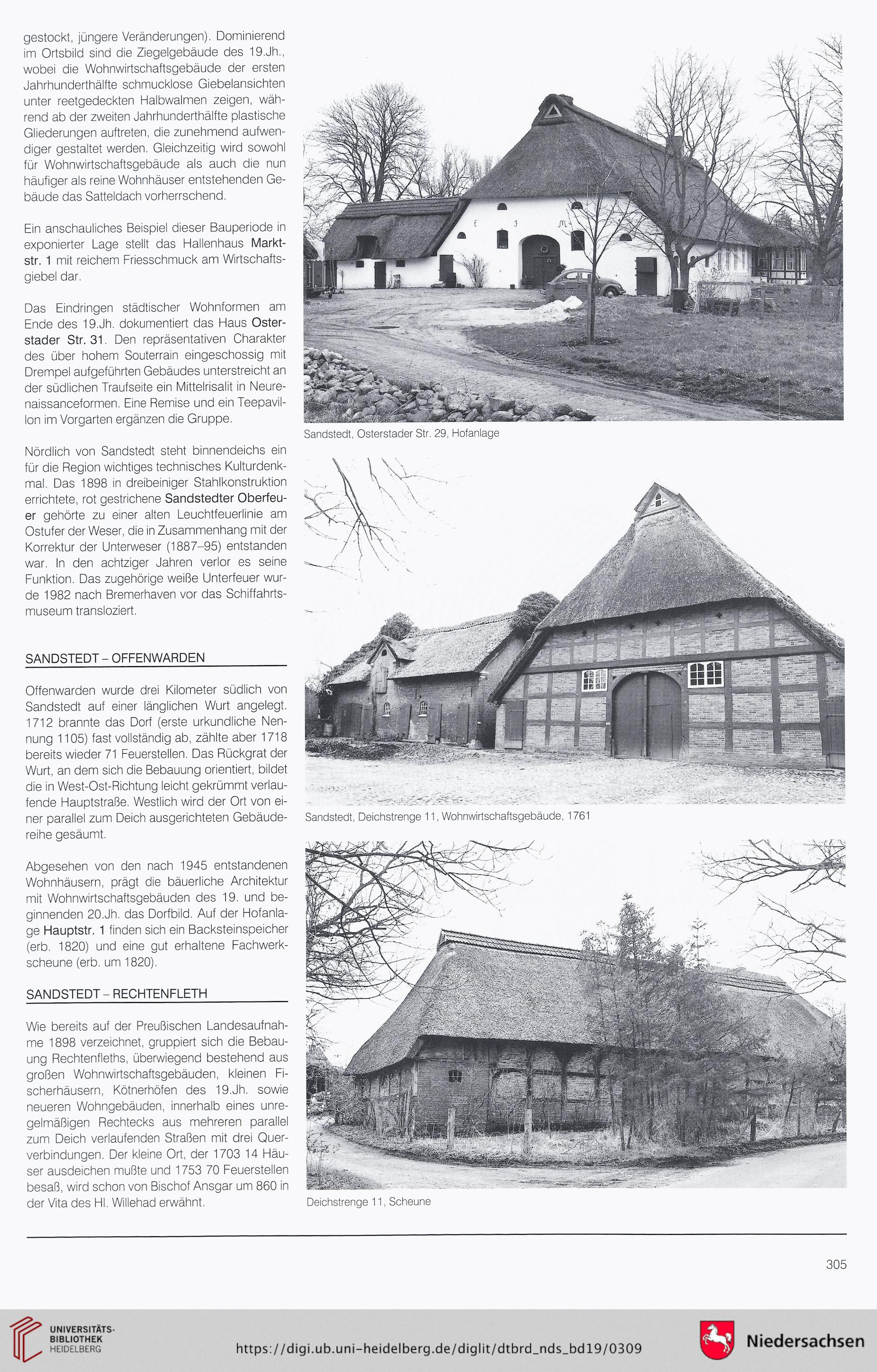Böker, Doris [Editor]
Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland: Baudenkmale in Niedersachsen (Band 19): Landkreis Cuxhaven
— Braunschweig, 1997
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.44259#0309
DOI Page / Citation link:
https://doi.org/10.11588/diglit.44259#0309
- Einband
- Schmutztitel
- Titelblatt
- Impressum
- 5-9 Inhaltsverzeichnis
- 11 Vorwort
- 13 Einführung
- 14-16 Quellen- und Literaturhinweise
- 17-111 Der Landkreis Cuxhaven
-
113-331
[Gemeinden des Landkreises Cuxhaven in alphabetischer Reihenfolge]
- 113 Appeln-Abelhorst
- 113 Armstorf-Dornsode
- 113-118 Bad Bederska
- 118-119 Belum
- 119-124 Beverstedt
- 124 Bokel
- 124-127 Bramstedt
- 127-128 Bülkau
- 128-131 Cadenberge
- 131-132 Cappel
- 133-186 Cuxhaven
- 186-189 Dorum
- 189 Drangstedt
- 189 Driftsethe
- 189-190 Elmlohe
- 190-192 Flögeln
- 192-193 Frelsdorf
- 193-198 Geversdorf
- 198-201 Hagen
- 201-205 Hechthausen
- 206 Heerstedt
- 206-210 Hemmoor
- 210-211 Hollen
- 212-215 Ihlienworth
- 215-217 Kirchwistedt
- 218 Köhlen
- 218 Kührstedt
- 218-222 Lamstedt
- 222-227 Langen
- 228 Lintig
- 228-242 Loxstedt
- 242-244 Lunestedt
- 244-246 Midlum
- 246-248 Misselwarden
- 248-249 Mittelstenahe
- 249-250 Mulsum
- 250-252 Neuenkirchen
- 252-258 Neuhaus
- 258-260 Nordholz
- 260-264 Nordleda
- 264-271 Oberndorf
- 271 Odisheim
- 271-277 Osten
- 277-278 Osterbruch
- 278-299 Otterndorf
- 299-301 Padingbüttel
- 301-303 Ringstedt
- 303-308 Sandstedt
- 308-316 Schiffdorf
- 316 Steinau
- 317 Stinstedt
- 318 Stubben
- 318 Uthlede
- 319-320 Wanna
- 320-326 Wingst
- 326-328 Wremen
- 328-331 Wulsbüttel
- ⟦Hagen im Bremischen⟧
- ⟦Stemmermühlen⟧
- ⟦Uthlede⟧
- 333-345 Straßen- und Objektregister
- 346-347 Register der Künstler und Handwerker
- Einband
- Maßstab/Farbkeil
gestockt, jüngere Veränderungen). Dominierend
im Ortsbild sind die Ziegelgebäude des 19.Jh.,
wobei die Wohnwirtschafts gebäude der ersten
Jahrhunderthälfte schmucklose Giebelansichten
unter reetgedeckten Halbwalmen zeigen, wäh-
rend ab der zweiten Jahrhunderthälfte plastische
Gliederungen auftreten, die zunehmend aufwen-
diger gestaltet werden. Gleichzeitig wird sowohl
für Wohnwirtschaftsgebäude als auch die nun
häufiger als reine Wohnhäuser entstehenden Ge-
bäude das Satteldach vorherrschend.
Ein anschauliches Beispiel dieser Bauperiode in
exponierter Lage stellt das Hallenhaus Markt-
str. 1 mit reichem Friesschmuck am Wirtschafts-
giebel dar.
Das Eindringen städtischer Wohnformen am
Ende des 19.Jh. dokumentiert das Haus Oster-
stader Str. 31. Den repräsentativen Charakter
des über hohem Souterrain eingeschossig mit
Drempel aufgeführten Gebäudes unterstreicht an
der südlichen Traufseite ein Mittelrisalit in Neure-
naissanceformen. Eine Remise und ein Teepavil-
lon im Vorgarten ergänzen die Gruppe.
Nördlich von Sandstedt steht binnendeichs ein
für die Region wichtiges technisches Kulturdenk-
mal. Das 1898 in dreibeiniger Stahlkonstruktion
errichtete, rot gestrichene Sandstedter Oberfeu-
er gehörte zu einer alten Leuchtfeuerlinie am
Ostufer der Weser, die in Zusammenhang mit der
Korrektur der Unterweser (1887-95) entstanden
war. In den achtziger Jahren verlor es seine
Funktion. Das zugehörige weiße Unterfeuer wur-
de 1982 nach Bremerhaven vor das Schiffahrts-
museum transloziert.
SANDSTEDT - OFFENWARDEN
Offenwarden wurde drei Kilometer südlich von
Sandstedt auf einer länglichen Wurt angelegt.
1712 brannte das Dorf (erste urkundliche Nen-
nung 1105) fast vollständig ab, zählte aber 1718
bereits wieder 71 Feuerstellen. Das Rückgrat der
Wurt, an dem sich die Bebauung orientiert, bildet
die in West-Ost-Richtung leicht gekrümmt verlau-
fende Hauptstraße. Westlich wird der Ort von ei-
ner parallel zum Deich ausgerichteten Gebäude-
reihe gesäumt.
Abgesehen von den nach 1945 entstandenen
Wohnhäusern, prägt die bäuerliche Architektur
mit Wohnwirtschaftsgebäuden des 19. und be-
ginnenden 20.Jh. das Dorfbild. Auf der Hofanla-
ge Hauptstr. 1 finden sich ein Backsteinspeicher
(erb. 1820) und eine gut erhaltene Fachwerk-
scheune (erb. um 1820).
SANDSTEDT - RECHTENFLETH
Wie bereits auf der Preußischen Landesaufnah-
me 1898 verzeichnet, gruppiert sich die Bebau-
ung Rechtenfleths, überwiegend bestehend aus
großen Wohnwirtschaftsgebäuden, kleinen Fi-
scherhäusern, Kötnerhöfen des 19.Jh. sowie
neueren Wohngebäuden, innerhalb eines unre-
gelmäßigen Rechtecks aus mehreren parallel
zum Deich verlaufenden Straßen mit drei Quer-
verbindungen. Der kleine Ort, der 1703 14 Häu-
ser ausdeichen mußte und 1753 70 Feuerstellen
besaß, wird schon von Bischof Ansgar um 860 in
der Vita des Hl. Willehad erwähnt.
Deichstrenge 11, Scheune
305
im Ortsbild sind die Ziegelgebäude des 19.Jh.,
wobei die Wohnwirtschafts gebäude der ersten
Jahrhunderthälfte schmucklose Giebelansichten
unter reetgedeckten Halbwalmen zeigen, wäh-
rend ab der zweiten Jahrhunderthälfte plastische
Gliederungen auftreten, die zunehmend aufwen-
diger gestaltet werden. Gleichzeitig wird sowohl
für Wohnwirtschaftsgebäude als auch die nun
häufiger als reine Wohnhäuser entstehenden Ge-
bäude das Satteldach vorherrschend.
Ein anschauliches Beispiel dieser Bauperiode in
exponierter Lage stellt das Hallenhaus Markt-
str. 1 mit reichem Friesschmuck am Wirtschafts-
giebel dar.
Das Eindringen städtischer Wohnformen am
Ende des 19.Jh. dokumentiert das Haus Oster-
stader Str. 31. Den repräsentativen Charakter
des über hohem Souterrain eingeschossig mit
Drempel aufgeführten Gebäudes unterstreicht an
der südlichen Traufseite ein Mittelrisalit in Neure-
naissanceformen. Eine Remise und ein Teepavil-
lon im Vorgarten ergänzen die Gruppe.
Nördlich von Sandstedt steht binnendeichs ein
für die Region wichtiges technisches Kulturdenk-
mal. Das 1898 in dreibeiniger Stahlkonstruktion
errichtete, rot gestrichene Sandstedter Oberfeu-
er gehörte zu einer alten Leuchtfeuerlinie am
Ostufer der Weser, die in Zusammenhang mit der
Korrektur der Unterweser (1887-95) entstanden
war. In den achtziger Jahren verlor es seine
Funktion. Das zugehörige weiße Unterfeuer wur-
de 1982 nach Bremerhaven vor das Schiffahrts-
museum transloziert.
SANDSTEDT - OFFENWARDEN
Offenwarden wurde drei Kilometer südlich von
Sandstedt auf einer länglichen Wurt angelegt.
1712 brannte das Dorf (erste urkundliche Nen-
nung 1105) fast vollständig ab, zählte aber 1718
bereits wieder 71 Feuerstellen. Das Rückgrat der
Wurt, an dem sich die Bebauung orientiert, bildet
die in West-Ost-Richtung leicht gekrümmt verlau-
fende Hauptstraße. Westlich wird der Ort von ei-
ner parallel zum Deich ausgerichteten Gebäude-
reihe gesäumt.
Abgesehen von den nach 1945 entstandenen
Wohnhäusern, prägt die bäuerliche Architektur
mit Wohnwirtschaftsgebäuden des 19. und be-
ginnenden 20.Jh. das Dorfbild. Auf der Hofanla-
ge Hauptstr. 1 finden sich ein Backsteinspeicher
(erb. 1820) und eine gut erhaltene Fachwerk-
scheune (erb. um 1820).
SANDSTEDT - RECHTENFLETH
Wie bereits auf der Preußischen Landesaufnah-
me 1898 verzeichnet, gruppiert sich die Bebau-
ung Rechtenfleths, überwiegend bestehend aus
großen Wohnwirtschaftsgebäuden, kleinen Fi-
scherhäusern, Kötnerhöfen des 19.Jh. sowie
neueren Wohngebäuden, innerhalb eines unre-
gelmäßigen Rechtecks aus mehreren parallel
zum Deich verlaufenden Straßen mit drei Quer-
verbindungen. Der kleine Ort, der 1703 14 Häu-
ser ausdeichen mußte und 1753 70 Feuerstellen
besaß, wird schon von Bischof Ansgar um 860 in
der Vita des Hl. Willehad erwähnt.
Deichstrenge 11, Scheune
305