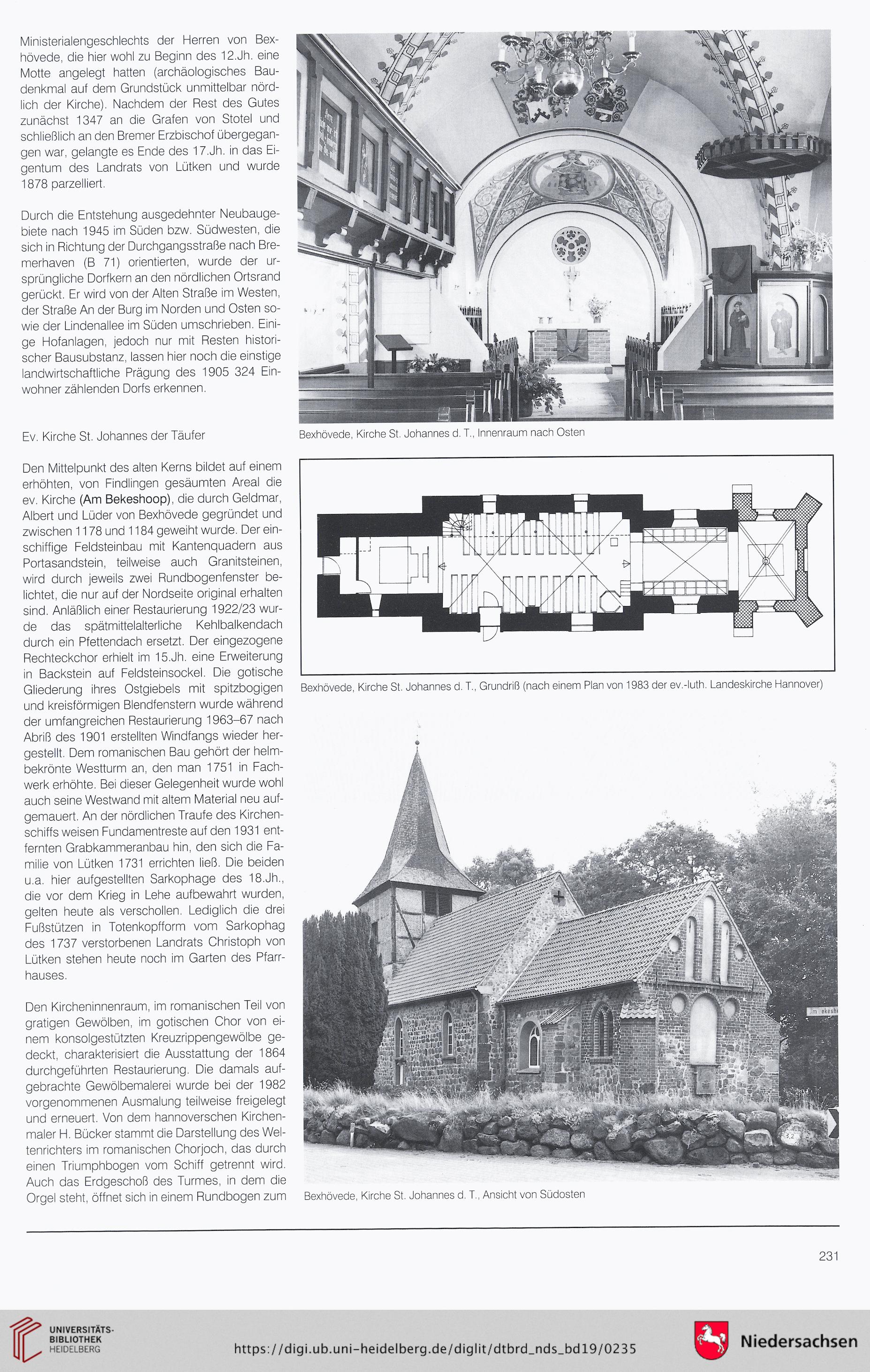Ministerialengeschlechts der Herren von Bex-
hövede, die hier wohl zu Beginn des 12.Jh. eine
Motte angelegt hatten (archäologisches Bau-
denkmal auf dem Grundstück unmittelbar nörd-
lich der Kirche). Nachdem der Rest des Gutes
zunächst 1347 an die Grafen von Stotel und
schließlich an den Bremer Erzbischof übergegan-
gen war, gelangte es Ende des 17.Jh. in das Ei-
gentum des Landrats von Lütken und wurde
1878 parzelliert.
Durch die Entstehung ausgedehnter Neubauge-
biete nach 1945 im Süden bzw. Südwesten, die
sich in Richtung der Durchgangsstraße nach Bre-
merhaven (B 71) orientierten, wurde der ur-
sprüngliche Dorfkern an den nördlichen Ortsrand
gerückt. Er wird von der Alten Straße im Westen,
der Straße An der Burg im Norden und Osten so-
wie der Lindenallee im Süden umschrieben. Eini-
ge Hofanlagen, jedoch nur mit Resten histori-
scher Bausubstanz, lassen hier noch die einstige
landwirtschaftliche Prägung des 1905 324 Ein-
wohner zählenden Dorfs erkennen.
Ev. Kirche St. Johannes der Täufer
Den Mittelpunkt des alten Kerns bildet auf einem
erhöhten, von Findlingen gesäumten Areal die
ev. Kirche (Am Bekeshoop), die durch Geldmar,
Albert und Lüder von Bexhövede gegründet und
zwischen 1178 und 1184 geweiht wurde. Der ein- *
3 . . = 3 In Bat Ft
schiffige Feldsteinbau mit Kantenquadern aus | N |} | In SAAL
. . : . . Sa [2
Portasandstein, teilweise auch Granitsteinen,
wird durch jeweils zwei Rundbogenfenster be- | nn )
lichtet, die nur auf der Nordseite original erhalten N. ) MU HH
sind. Anläßlich einer Restaurierung 1922/23 wur-
de das _ spätmittelalterliche Kehlbalkendach
durch ein Pfettendach ersetzt. Der eingezogene
Rechteckchor erhielt im 15.Jh. eine Erweiterung
in Backstein auf Feldsteinsockel. Die gotische
Gliederung ihres Ostgiebels mit spitzoogigen _Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Grundriß (nach einem Plan von 1983 der ev.-Iluth. Landeskirche Hannover)
und kreisförmigen Blendfenstern wurde während
der umfangreichen Restaurierung 1963-67 nach
Abriß des 1901 erstellten Windfangs wieder her-
gestellt. Dem romanischen Bau gehört der helm-
bekrönte Westturm an, den man 1751 in Fach-
werk erhöhte. Bei dieser Gelegenheit wurde wohl
auch seine Westwand mit altem Material neu auf-
gemauert. An der nördlichen Traufe des Kirchen-
schiffs weisen Fundamentreste auf den 1931 ent-
fernten Grabkammeranbau hin, den sich die Fa-
milie von Lütken 1731 errichten ließ. Die beiden
u.a. hier aufgestellten Sarkophage des 18.Jh.,
die vor dem Krieg in Lehe aufbewahrt wurden,
gelten heute als verschollen. Lediglich die drei
Fußstützen in Totenkopfform vom Sarkophag
des 1737 verstorbenen Landrats Christoph von
Lütken stehen heute noch im Garten des Pfarr-
hauses.
Den Kircheninnenraum, im romanischen Teil von
gratigen Gewölben, im gotischen Chor von ei-
nem konsolgestützten Kreuzrippengewölbe ge-
deckt, charakterisiert die Ausstattung der 1864
durchgeführten Restaurierung. Die damals auf-
gebrachte Gewölbemalerei wurde bei der 1982
vorgenommenen Ausmalung teilweise freigelegt
und erneuert. Von dem hannoverschen Kirchen-
maler H. Bücker stammt die Darstellung des Wel-
tenrichters im romanischen Chorjoch, das durch
einen Triumphbogen vom Schiff getrennt wird.
Auch das Erdgeschoß des Turmes, in dem die
Orgel steht, öffnet sich in einem Rundbogen zum Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Ansicht von Südosten
231
hövede, die hier wohl zu Beginn des 12.Jh. eine
Motte angelegt hatten (archäologisches Bau-
denkmal auf dem Grundstück unmittelbar nörd-
lich der Kirche). Nachdem der Rest des Gutes
zunächst 1347 an die Grafen von Stotel und
schließlich an den Bremer Erzbischof übergegan-
gen war, gelangte es Ende des 17.Jh. in das Ei-
gentum des Landrats von Lütken und wurde
1878 parzelliert.
Durch die Entstehung ausgedehnter Neubauge-
biete nach 1945 im Süden bzw. Südwesten, die
sich in Richtung der Durchgangsstraße nach Bre-
merhaven (B 71) orientierten, wurde der ur-
sprüngliche Dorfkern an den nördlichen Ortsrand
gerückt. Er wird von der Alten Straße im Westen,
der Straße An der Burg im Norden und Osten so-
wie der Lindenallee im Süden umschrieben. Eini-
ge Hofanlagen, jedoch nur mit Resten histori-
scher Bausubstanz, lassen hier noch die einstige
landwirtschaftliche Prägung des 1905 324 Ein-
wohner zählenden Dorfs erkennen.
Ev. Kirche St. Johannes der Täufer
Den Mittelpunkt des alten Kerns bildet auf einem
erhöhten, von Findlingen gesäumten Areal die
ev. Kirche (Am Bekeshoop), die durch Geldmar,
Albert und Lüder von Bexhövede gegründet und
zwischen 1178 und 1184 geweiht wurde. Der ein- *
3 . . = 3 In Bat Ft
schiffige Feldsteinbau mit Kantenquadern aus | N |} | In SAAL
. . : . . Sa [2
Portasandstein, teilweise auch Granitsteinen,
wird durch jeweils zwei Rundbogenfenster be- | nn )
lichtet, die nur auf der Nordseite original erhalten N. ) MU HH
sind. Anläßlich einer Restaurierung 1922/23 wur-
de das _ spätmittelalterliche Kehlbalkendach
durch ein Pfettendach ersetzt. Der eingezogene
Rechteckchor erhielt im 15.Jh. eine Erweiterung
in Backstein auf Feldsteinsockel. Die gotische
Gliederung ihres Ostgiebels mit spitzoogigen _Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Grundriß (nach einem Plan von 1983 der ev.-Iluth. Landeskirche Hannover)
und kreisförmigen Blendfenstern wurde während
der umfangreichen Restaurierung 1963-67 nach
Abriß des 1901 erstellten Windfangs wieder her-
gestellt. Dem romanischen Bau gehört der helm-
bekrönte Westturm an, den man 1751 in Fach-
werk erhöhte. Bei dieser Gelegenheit wurde wohl
auch seine Westwand mit altem Material neu auf-
gemauert. An der nördlichen Traufe des Kirchen-
schiffs weisen Fundamentreste auf den 1931 ent-
fernten Grabkammeranbau hin, den sich die Fa-
milie von Lütken 1731 errichten ließ. Die beiden
u.a. hier aufgestellten Sarkophage des 18.Jh.,
die vor dem Krieg in Lehe aufbewahrt wurden,
gelten heute als verschollen. Lediglich die drei
Fußstützen in Totenkopfform vom Sarkophag
des 1737 verstorbenen Landrats Christoph von
Lütken stehen heute noch im Garten des Pfarr-
hauses.
Den Kircheninnenraum, im romanischen Teil von
gratigen Gewölben, im gotischen Chor von ei-
nem konsolgestützten Kreuzrippengewölbe ge-
deckt, charakterisiert die Ausstattung der 1864
durchgeführten Restaurierung. Die damals auf-
gebrachte Gewölbemalerei wurde bei der 1982
vorgenommenen Ausmalung teilweise freigelegt
und erneuert. Von dem hannoverschen Kirchen-
maler H. Bücker stammt die Darstellung des Wel-
tenrichters im romanischen Chorjoch, das durch
einen Triumphbogen vom Schiff getrennt wird.
Auch das Erdgeschoß des Turmes, in dem die
Orgel steht, öffnet sich in einem Rundbogen zum Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Ansicht von Südosten
231