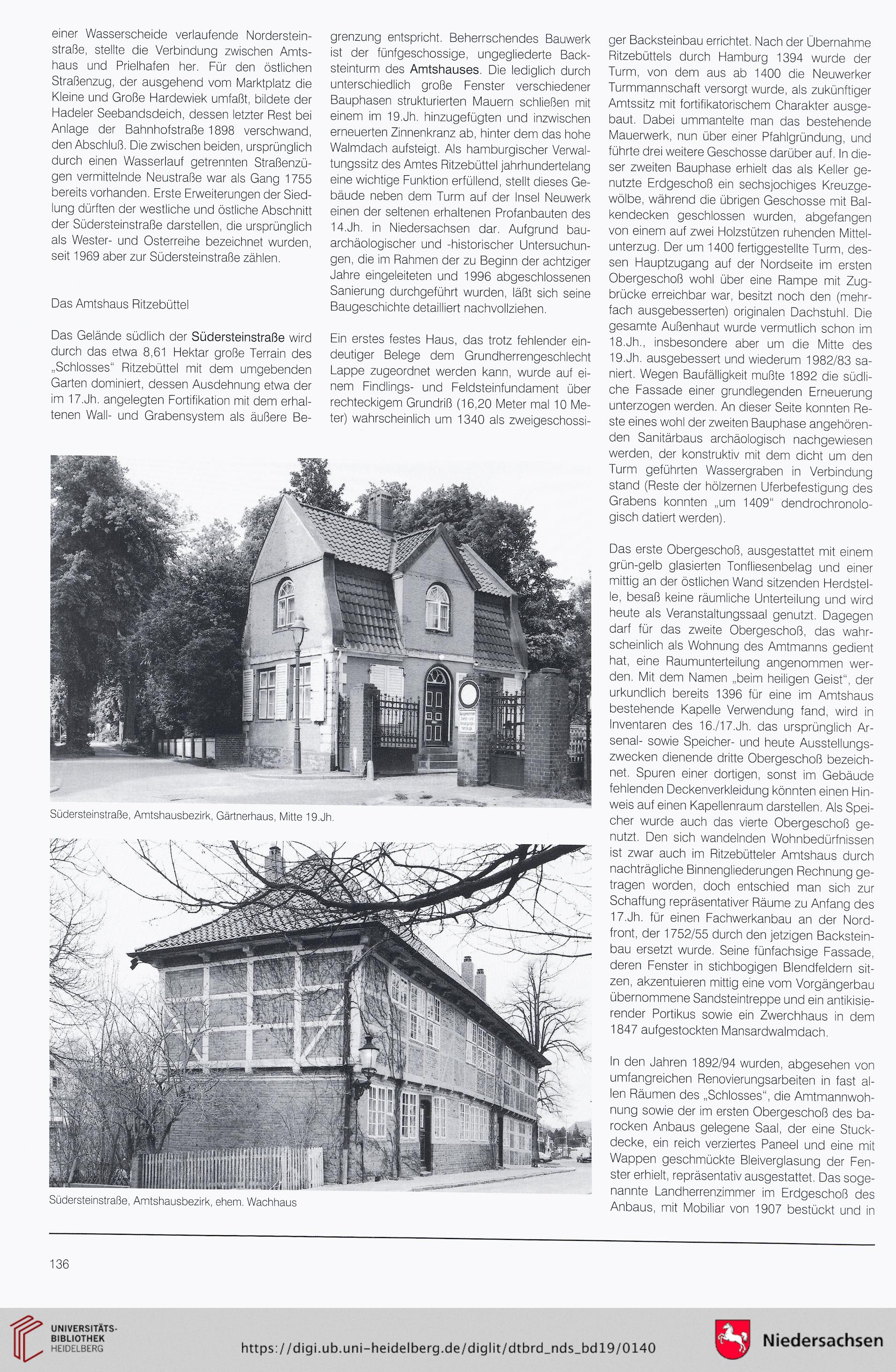einer Wasserscheide verlaufende Norderstein-
straße, stellte die Verbindung zwischen Amts-
haus und Prielhafen her. Für den östlichen
Straßenzug, der ausgehend vom Marktplatz die
Kleine und Große Hardewiek umfaßt, bildete der
Hadeler Seebandsdeich, dessen letzter Rest bei
Anlage der Bahnhofstraße 1898 verschwand,
den Abschluß. Die zwischen beiden, ursprünglich
durch einen Wasserlauf getrennten Straßenzü-
gen vermittelnde Neustraße war als Gang 1755
bereits vorhanden. Erste Erweiterungen der Sied-
lung dürften der westliche und östliche Abschnitt
der Südersteinstraße darstellen, die ursprünglich
als Wester- und Osterreihe bezeichnet wurden,
seit 1969 aber zur Südersteinstraße zählen.
Das Amtshaus Ritzebüttel
Das Gelände südlich der Südersteinstraße wird
durch das etwa 8,61 Hektar große Terrain des
„Schlosses“ Ritzebüttel mit dem umgebenden
Garten dominiert, dessen Ausdehnung etwa der
im 17.Jh. angelegten Fortifikation mit dem erhal-
tenen Wall- und Grabensystem als äußere Be-
grenzung entspricht. Beherrschendes Bauwerk
ist der fünfgeschossige, ungegliederte Back-
steinturm des Amtshauses. Die lediglich durch
unterschiedlich große Fenster verschiedener
Bauphasen strukturierten Mauern schließen mit
einem im 19.Jh. hinzugefügten und inzwischen
erneuerten Zinnenkranz ab, hinter dem das hohe
Walmdach aufsteigt. Als hamburgischer Verwal-
tungssitz des Amtes Ritzebüttel jahrhundertelang
eine wichtige Funktion erfüllend, stellt dieses Ge-
bäude neben dem Turm auf der Insel Neuwerk
einen der seltenen erhaltenen Profanbauten des
14.Jn. in Niedersachsen dar. Aufgrund bau-
archäologischer und -historischer Untersuchun-
gen, die im Rahmen der zu Beginn der achtziger
Jahre eingeleiteten und 1996 abgeschlossenen
Sanierung durchgeführt wurden, läßt sich seine
Baugeschichte detailliert nachvollziehen.
Ein erstes festes Haus, das trotz fehlender ein-
deutiger Belege dem KGrundherrengeschlecht
Lappe zugeordnet werden kann, wurde auf ei-
nem Findlings- und Feldsteinfundament über
rechteckigem Grundriß (16,20 Meter mal 10 Me-
ter) wahrscheinlich um 1340 als zweigeschossi-
ger Backsteinbau errichtet. Nach der Übernahme
Ritzebüttels durch Hamburg 1394 wurde der
Turm, von dem aus ab 1400 die Neuwerker
Turmmannschaft versorgt wurde, als zukünftiger
Amtssitz mit fortifikatorischem Charakter ausge-
baut. Dabei ummantelte man das bestehende
Mauerwerk, nun über einer Pfahlgründung, und
führte drei weitere Geschosse darüber auf. In die-
ser zweiten Bauphase erhielt das als Keller ge-
nutzte Erdgeschoß ein sechsjochiges Kreuzge-
wölbe, während die übrigen Geschosse mit Bal-
kendecken geschlossen wurden, abgefangen
von einem auf zwei Holzstützen ruhenden Mittel-
unterzug. Der um 1400 fertiggestellte Turm, des-
sen Hauptzugang auf der Nordseite im ersten
Obergeschoß wohl über eine Rampe mit ZUug-
brücke erreichbar war, besitzt noch den (mehr-
fach ausgebesserten) originalen Dachstuhl. Die
gesamte Außenhaut wurde vermutlich schon im
18.Jh., insbesondere aber um die Mitte des
19.Jh. ausgebessert und wiederum 1982/83 sa-
niert. Wegen Baufälligkeit mußte 1892 die südli-
che Fassade einer grundlegenden Erneuerung
unterzogen werden. An dieser Seite konnten Re-
ste eines wohl der zweiten Bauphase angehören-
den Sanitärbaus archäologisch nachgewiesen
werden, der konstruktiv mit dem dicht um den
Turm geführten Wassergraben in Verbindung
stand (Reste der hölzernen Uferbefestigung des
Grabens konnten „um 1409“ dendrochronolo-
gisch datiert werden).
Das erste Obergeschoß, ausgestattet mit einem
grün-gelb glasierten Tonfliesenbelag und einer
mittig an der östlichen Wand sitzenden Herdstel-
le, besaß keine räumliche Unterteilung und wird
heute als Veranstaltungssaal genutzt. Dagegen
darf für das zweite Obergeschoß, das wahr-
scheinlich als Wohnung des Amtmanns gedient
hat, eine Raumunterteilung angenommen wer-
den. Mit dem Namen „beim heiligen Geist“, der
urkundlich bereits 1396 für eine im Amtshaus
bestehende Kapelle Verwendung fand, wird in
Inventaren des 16./17.Jh. das ursprünglich Ar-
senal- sowie Speicher- und heute Ausstellungs-
zwecken dienende dritte Obergeschoß bezeich-
net. Spuren einer dortigen, sonst im Gebäude
fehlenden Deckenverkleidung könnten einen Hin-
weis auf einen Kapellenraum darstellen. Als Spei-
cher wurde auch das vierte Obergeschoß ge-
nutzt. Den sich wandelnden Wohnbedürfnissen
ist zwar auch im Ritzebütteler Amtshaus durch
nachträgliche Binnengliederungen Rechnung ge-
tragen worden, doch entschied man sich zur
Schaffung repräsentativer Räume zu Anfang des
17.Jnh. für einen Fachwerkanbau an der Nord-
front, der 1752/55 durch den jetzigen Backstein-
bau ersetzt wurde. Seine fünfachsige Fassade,
deren Fenster in stichbogigen Blendfeldern sit-
zen, akzentuieren mittig eine vom Vorgängerbau
übernommene Sandsteintreppe und ein antikisie-
render Portikus sowie ein Zwerchhaus in dem
1847 aufgestockten Mansardwalmdach.
In den Jahren 1892/94 wurden, abgesehen von
umfangreichen Renovierungsarbeiten in fast al-
len Räumen des „Schlosses“, die Amtmannwoh-
nung sowie der im ersten Obergeschoß des ba-
rocken Anbaus gelegene Saal, der eine Stuck-
decke, ein reich verziertes Paneel und eine mit
Wappen geschmückte Bleiverglasung der Fen-
ster erhielt, repräsentativ ausgestattet. Das soge-
nannte Landherrenzimmer im Erdgeschoß des
Anbaus, mit Mobiliar von 1907 bestückt und in
136
straße, stellte die Verbindung zwischen Amts-
haus und Prielhafen her. Für den östlichen
Straßenzug, der ausgehend vom Marktplatz die
Kleine und Große Hardewiek umfaßt, bildete der
Hadeler Seebandsdeich, dessen letzter Rest bei
Anlage der Bahnhofstraße 1898 verschwand,
den Abschluß. Die zwischen beiden, ursprünglich
durch einen Wasserlauf getrennten Straßenzü-
gen vermittelnde Neustraße war als Gang 1755
bereits vorhanden. Erste Erweiterungen der Sied-
lung dürften der westliche und östliche Abschnitt
der Südersteinstraße darstellen, die ursprünglich
als Wester- und Osterreihe bezeichnet wurden,
seit 1969 aber zur Südersteinstraße zählen.
Das Amtshaus Ritzebüttel
Das Gelände südlich der Südersteinstraße wird
durch das etwa 8,61 Hektar große Terrain des
„Schlosses“ Ritzebüttel mit dem umgebenden
Garten dominiert, dessen Ausdehnung etwa der
im 17.Jh. angelegten Fortifikation mit dem erhal-
tenen Wall- und Grabensystem als äußere Be-
grenzung entspricht. Beherrschendes Bauwerk
ist der fünfgeschossige, ungegliederte Back-
steinturm des Amtshauses. Die lediglich durch
unterschiedlich große Fenster verschiedener
Bauphasen strukturierten Mauern schließen mit
einem im 19.Jh. hinzugefügten und inzwischen
erneuerten Zinnenkranz ab, hinter dem das hohe
Walmdach aufsteigt. Als hamburgischer Verwal-
tungssitz des Amtes Ritzebüttel jahrhundertelang
eine wichtige Funktion erfüllend, stellt dieses Ge-
bäude neben dem Turm auf der Insel Neuwerk
einen der seltenen erhaltenen Profanbauten des
14.Jn. in Niedersachsen dar. Aufgrund bau-
archäologischer und -historischer Untersuchun-
gen, die im Rahmen der zu Beginn der achtziger
Jahre eingeleiteten und 1996 abgeschlossenen
Sanierung durchgeführt wurden, läßt sich seine
Baugeschichte detailliert nachvollziehen.
Ein erstes festes Haus, das trotz fehlender ein-
deutiger Belege dem KGrundherrengeschlecht
Lappe zugeordnet werden kann, wurde auf ei-
nem Findlings- und Feldsteinfundament über
rechteckigem Grundriß (16,20 Meter mal 10 Me-
ter) wahrscheinlich um 1340 als zweigeschossi-
ger Backsteinbau errichtet. Nach der Übernahme
Ritzebüttels durch Hamburg 1394 wurde der
Turm, von dem aus ab 1400 die Neuwerker
Turmmannschaft versorgt wurde, als zukünftiger
Amtssitz mit fortifikatorischem Charakter ausge-
baut. Dabei ummantelte man das bestehende
Mauerwerk, nun über einer Pfahlgründung, und
führte drei weitere Geschosse darüber auf. In die-
ser zweiten Bauphase erhielt das als Keller ge-
nutzte Erdgeschoß ein sechsjochiges Kreuzge-
wölbe, während die übrigen Geschosse mit Bal-
kendecken geschlossen wurden, abgefangen
von einem auf zwei Holzstützen ruhenden Mittel-
unterzug. Der um 1400 fertiggestellte Turm, des-
sen Hauptzugang auf der Nordseite im ersten
Obergeschoß wohl über eine Rampe mit ZUug-
brücke erreichbar war, besitzt noch den (mehr-
fach ausgebesserten) originalen Dachstuhl. Die
gesamte Außenhaut wurde vermutlich schon im
18.Jh., insbesondere aber um die Mitte des
19.Jh. ausgebessert und wiederum 1982/83 sa-
niert. Wegen Baufälligkeit mußte 1892 die südli-
che Fassade einer grundlegenden Erneuerung
unterzogen werden. An dieser Seite konnten Re-
ste eines wohl der zweiten Bauphase angehören-
den Sanitärbaus archäologisch nachgewiesen
werden, der konstruktiv mit dem dicht um den
Turm geführten Wassergraben in Verbindung
stand (Reste der hölzernen Uferbefestigung des
Grabens konnten „um 1409“ dendrochronolo-
gisch datiert werden).
Das erste Obergeschoß, ausgestattet mit einem
grün-gelb glasierten Tonfliesenbelag und einer
mittig an der östlichen Wand sitzenden Herdstel-
le, besaß keine räumliche Unterteilung und wird
heute als Veranstaltungssaal genutzt. Dagegen
darf für das zweite Obergeschoß, das wahr-
scheinlich als Wohnung des Amtmanns gedient
hat, eine Raumunterteilung angenommen wer-
den. Mit dem Namen „beim heiligen Geist“, der
urkundlich bereits 1396 für eine im Amtshaus
bestehende Kapelle Verwendung fand, wird in
Inventaren des 16./17.Jh. das ursprünglich Ar-
senal- sowie Speicher- und heute Ausstellungs-
zwecken dienende dritte Obergeschoß bezeich-
net. Spuren einer dortigen, sonst im Gebäude
fehlenden Deckenverkleidung könnten einen Hin-
weis auf einen Kapellenraum darstellen. Als Spei-
cher wurde auch das vierte Obergeschoß ge-
nutzt. Den sich wandelnden Wohnbedürfnissen
ist zwar auch im Ritzebütteler Amtshaus durch
nachträgliche Binnengliederungen Rechnung ge-
tragen worden, doch entschied man sich zur
Schaffung repräsentativer Räume zu Anfang des
17.Jnh. für einen Fachwerkanbau an der Nord-
front, der 1752/55 durch den jetzigen Backstein-
bau ersetzt wurde. Seine fünfachsige Fassade,
deren Fenster in stichbogigen Blendfeldern sit-
zen, akzentuieren mittig eine vom Vorgängerbau
übernommene Sandsteintreppe und ein antikisie-
render Portikus sowie ein Zwerchhaus in dem
1847 aufgestockten Mansardwalmdach.
In den Jahren 1892/94 wurden, abgesehen von
umfangreichen Renovierungsarbeiten in fast al-
len Räumen des „Schlosses“, die Amtmannwoh-
nung sowie der im ersten Obergeschoß des ba-
rocken Anbaus gelegene Saal, der eine Stuck-
decke, ein reich verziertes Paneel und eine mit
Wappen geschmückte Bleiverglasung der Fen-
ster erhielt, repräsentativ ausgestattet. Das soge-
nannte Landherrenzimmer im Erdgeschoß des
Anbaus, mit Mobiliar von 1907 bestückt und in
136