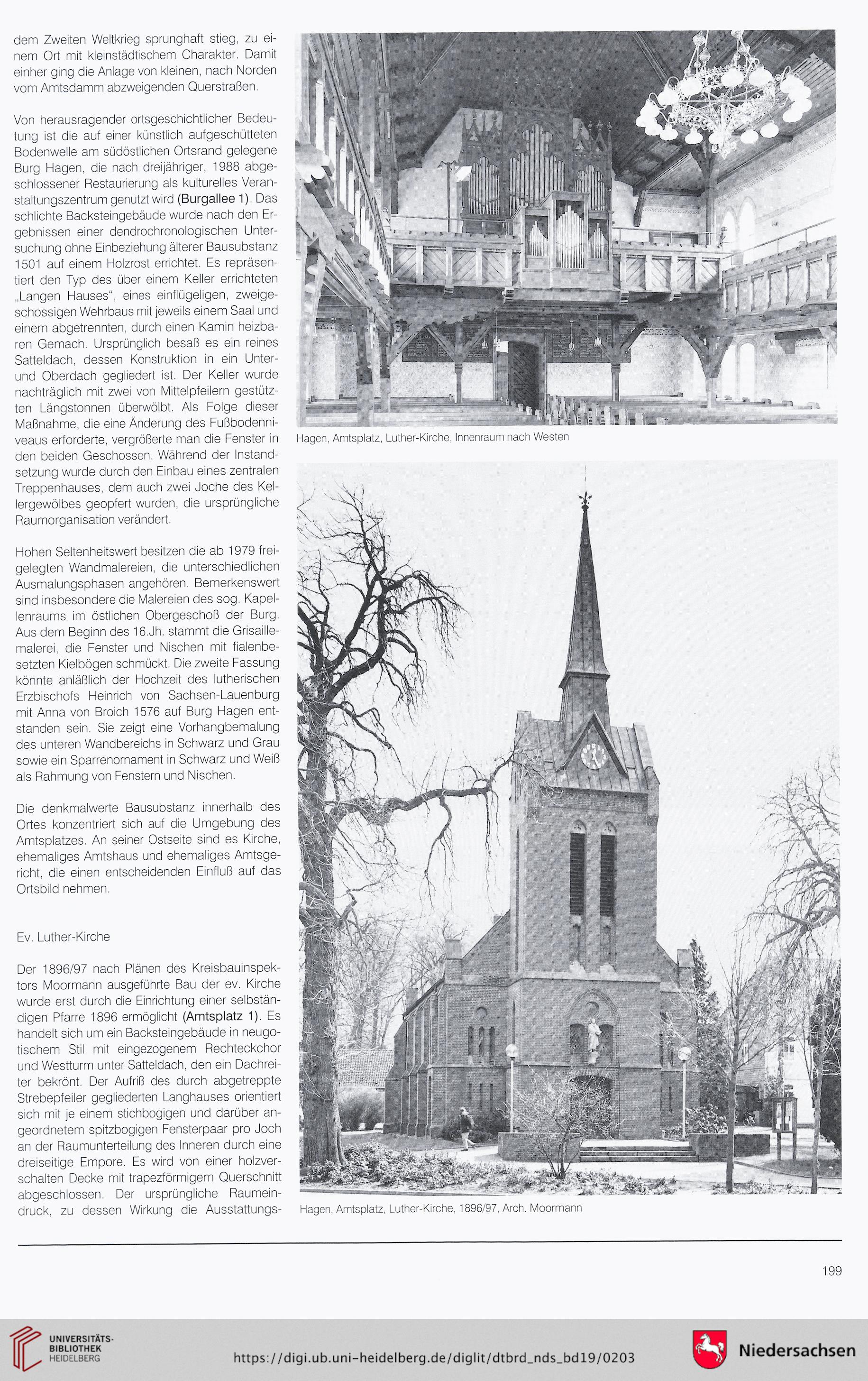dem Zweiten Weltkrieg sprunghaft stieg, zu ei-
nem Ort mit kleinstädtischem Charakter. Damit
einher ging die Anlage von kleinen, nach Norden
vom Amtsdamm abzweigenden Querstraßen.
Von herausragender ortsgeschichtlicher Bedeu-
tung ist die auf einer künstlich aufgeschütteten
Bodenwelle am südöstlichen Ortsrand gelegene
Burg Hagen, die nach dreijähriger, 1988 abge-
schlossener Restaurierung als kulturelles Veran-
staltungszentrum genutzt wird (Burgallee 1). Das
schlichte Backsteingebäude wurde nach den Er-
gebnissen einer dendrochronologischen Unter-
suchung ohne Einbeziehung älterer Bausubstanz
1501 auf einem Holzrost errichtet. Es repräsen-
tiert den Typ des über einem Keller errichteten
„Langen Hauses“, eines einflügeligen, zweige-
schossigen Wehrbaus mit jeweils einem Saal und
einem abgetrennten, durch einen Kamin heizba-
ren Gemach. Ursprünglich besaß es ein reines
Satteldach, dessen Konstruktion in ein Unter-
und Oberdach gegliedert ist. Der Keller wurde
nachträglich mit zwei von Mittelpfeilern gestütz-
ten Längstonnen überwölbt. Als Folge dieser
Maßnahme, die eine Änderung des Fußbodenni-
veaus erforderte, vergrößerte man die Fenster in
den beiden Geschossen. Während der Instand-
setzung wurde durch den Einbau eines zentralen
Treppenhauses, dem auch zwei Joche des Kel-
lergewölbes geopfert wurden, die ursprüngliche
Raumorganisation verändert.
Hohen Seltenheitswert besitzen die ab 1979 frei-
gelegten Wandmalereien, die unterschiedlichen
Ausmalungsphasen angehören. Bemerkenswert
sind insbesondere die Malereien des sog. Kapel-
lenraums im östlichen Obergeschoß der Burg.
Aus dem Beginn des 16.Jh. stammt die Grisaille-
malerei, die Fenster und Nischen mit fialenbe-
setzten Kielbögen schmückt. Die zweite Fassung
könnte anläßlich der Hochzeit des lutherischen
Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg
mit Anna von Broich 1576 auf Burg Hagen ent-
standen sein. Sie zeigt eine Vorhangbemalung
des unteren Wandbereichs in Schwarz und Grau
sowie ein Sparrenornament in Schwarz und Weiß
als Rahmung von Fenstern und Nischen.
Die denkmalwerte Bausubstanz innerhalb des
Ortes konzentriert sich auf die Umgebung des
Amtsplatzes. An seiner Ostseite sind es Kirche,
ehemaliges Amtshaus und ehemaliges Amtsge-
richt, die einen entscheidenden Einfluß auf das
Ortsbild nehmen.
Ev. Luther-Kirche
Der 1896/97 nach Plänen des Kreisbauinspek-
tors Moormann ausgeführte Bau der ev. Kirche
wurde erst durch die Einrichtung einer selbstän-
digen Pfarre 1896 ermöglicht (Amtsplatz 1). Es
handelt sich um ein Backsteingebäude in neugo-
tischem Stil mit eingezogenem Rechteckchor
und Westturm unter Satteldach, den ein Dachrei-
ter bekrönt. Der Aufri8 des durch abgetreppte
Strebepfeiler gegliederten Langhauses orientiert
sich mit je einem stichbogigen und darüber an-
geordnetem spitzbogigen Fensterpaar pro Joch
an der Raumunterteilung des Inneren durch eine
dreiseitige Empore. Es wird von einer holzver-
schalten Decke mit trapezförmigem Querschnitt
abgeschlossen. Der ursprüngliche Raumein-
druck, zu dessen Wirkung die Ausstattungs-
CZ Pe A al €
Hagen, Amtsplatz, Luther-Kirche, 1896/97, Arch. Moorman
n
199
nem Ort mit kleinstädtischem Charakter. Damit
einher ging die Anlage von kleinen, nach Norden
vom Amtsdamm abzweigenden Querstraßen.
Von herausragender ortsgeschichtlicher Bedeu-
tung ist die auf einer künstlich aufgeschütteten
Bodenwelle am südöstlichen Ortsrand gelegene
Burg Hagen, die nach dreijähriger, 1988 abge-
schlossener Restaurierung als kulturelles Veran-
staltungszentrum genutzt wird (Burgallee 1). Das
schlichte Backsteingebäude wurde nach den Er-
gebnissen einer dendrochronologischen Unter-
suchung ohne Einbeziehung älterer Bausubstanz
1501 auf einem Holzrost errichtet. Es repräsen-
tiert den Typ des über einem Keller errichteten
„Langen Hauses“, eines einflügeligen, zweige-
schossigen Wehrbaus mit jeweils einem Saal und
einem abgetrennten, durch einen Kamin heizba-
ren Gemach. Ursprünglich besaß es ein reines
Satteldach, dessen Konstruktion in ein Unter-
und Oberdach gegliedert ist. Der Keller wurde
nachträglich mit zwei von Mittelpfeilern gestütz-
ten Längstonnen überwölbt. Als Folge dieser
Maßnahme, die eine Änderung des Fußbodenni-
veaus erforderte, vergrößerte man die Fenster in
den beiden Geschossen. Während der Instand-
setzung wurde durch den Einbau eines zentralen
Treppenhauses, dem auch zwei Joche des Kel-
lergewölbes geopfert wurden, die ursprüngliche
Raumorganisation verändert.
Hohen Seltenheitswert besitzen die ab 1979 frei-
gelegten Wandmalereien, die unterschiedlichen
Ausmalungsphasen angehören. Bemerkenswert
sind insbesondere die Malereien des sog. Kapel-
lenraums im östlichen Obergeschoß der Burg.
Aus dem Beginn des 16.Jh. stammt die Grisaille-
malerei, die Fenster und Nischen mit fialenbe-
setzten Kielbögen schmückt. Die zweite Fassung
könnte anläßlich der Hochzeit des lutherischen
Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg
mit Anna von Broich 1576 auf Burg Hagen ent-
standen sein. Sie zeigt eine Vorhangbemalung
des unteren Wandbereichs in Schwarz und Grau
sowie ein Sparrenornament in Schwarz und Weiß
als Rahmung von Fenstern und Nischen.
Die denkmalwerte Bausubstanz innerhalb des
Ortes konzentriert sich auf die Umgebung des
Amtsplatzes. An seiner Ostseite sind es Kirche,
ehemaliges Amtshaus und ehemaliges Amtsge-
richt, die einen entscheidenden Einfluß auf das
Ortsbild nehmen.
Ev. Luther-Kirche
Der 1896/97 nach Plänen des Kreisbauinspek-
tors Moormann ausgeführte Bau der ev. Kirche
wurde erst durch die Einrichtung einer selbstän-
digen Pfarre 1896 ermöglicht (Amtsplatz 1). Es
handelt sich um ein Backsteingebäude in neugo-
tischem Stil mit eingezogenem Rechteckchor
und Westturm unter Satteldach, den ein Dachrei-
ter bekrönt. Der Aufri8 des durch abgetreppte
Strebepfeiler gegliederten Langhauses orientiert
sich mit je einem stichbogigen und darüber an-
geordnetem spitzbogigen Fensterpaar pro Joch
an der Raumunterteilung des Inneren durch eine
dreiseitige Empore. Es wird von einer holzver-
schalten Decke mit trapezförmigem Querschnitt
abgeschlossen. Der ursprüngliche Raumein-
druck, zu dessen Wirkung die Ausstattungs-
CZ Pe A al €
Hagen, Amtsplatz, Luther-Kirche, 1896/97, Arch. Moorman
n
199