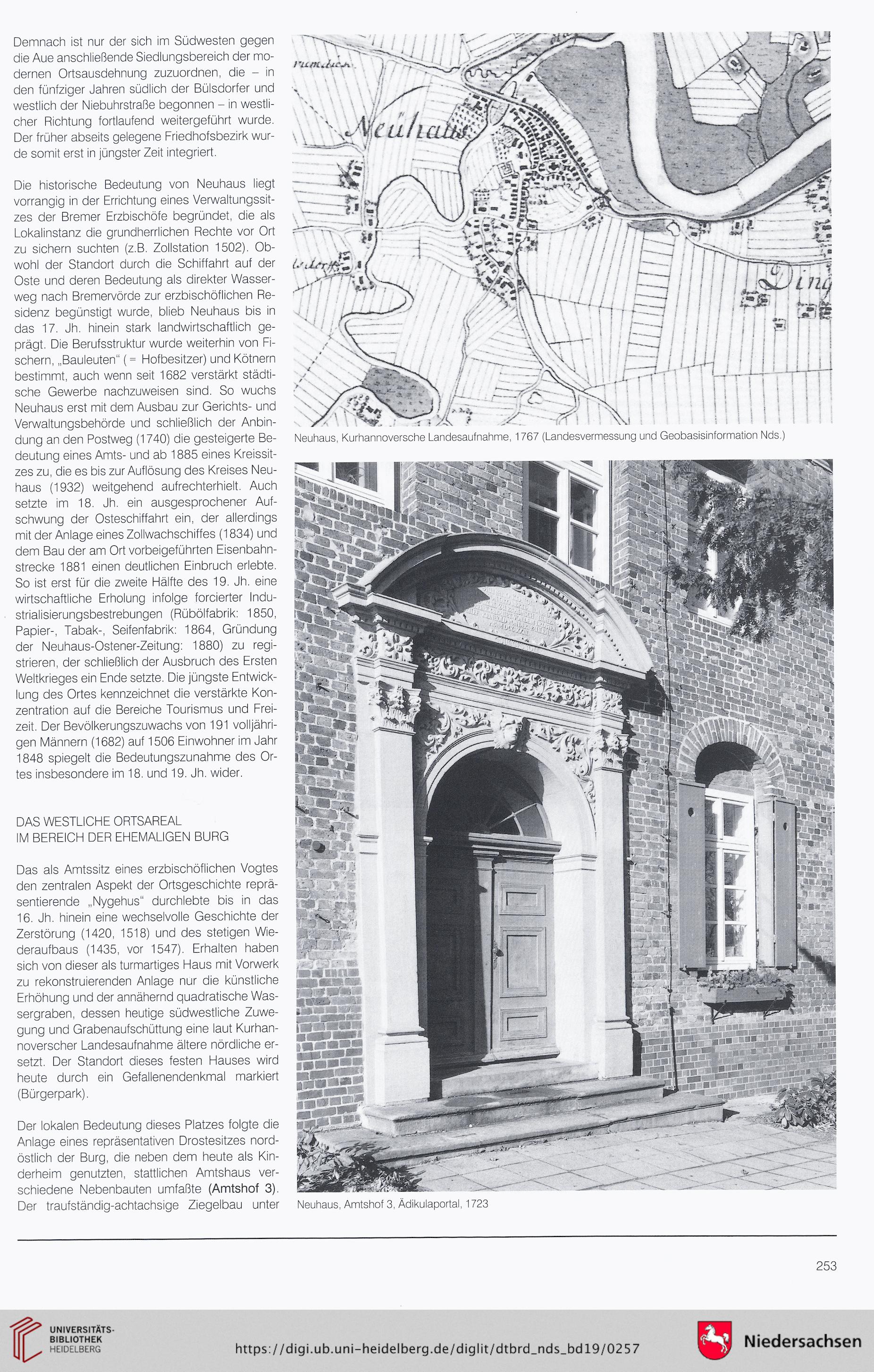Demnach ist nur der sich im Südwesten gegen
die Aue anschließende Siedlungsbereich der mo-
dernen Ortsausdehnung zuzuordnen, die — in
den fünfziger Jahren südlich der Bülsdorfer und
westlich der Niebuhrstraße begonnen — in westli-
cher Richtung fortlaufend weitergeführt wurde.
Der früher abseits gelegene Friedhofsbezirk wur-
de somit erst in jüngster Zeit integriert.
Die historische Bedeutung von Neuhaus liegt
vorrangig in der Errichtung eines Verwaltungssit-
zes der Bremer Erzbischöfe begründet, die als
Lokalinstanz die grundherrlichen Rechte vor Ort
zu sichern suchten (z.B. Zollstation 1502). Ob-
wohl der Standort durch die Schiffahrt auf der
Oste und deren Bedeutung als direkter Wasser-
weg nach Bremervörde zur erzbischöflichen Re-
sidenz begünstigt wurde, blieb Neuhaus bis in
das 17. Jh. hinein stark landwirtschaftlich ge-
prägt. Die Berufsstruktur wurde weiterhin von Fi-
schern, „Bauleuten“ (= Hofbesitzer) und Kötnern
bestimmt, auch wenn seit 1682 verstärkt städti-
sche Gewerbe nachzuweisen sind. So wuchs
Neuhaus erst mit dem Ausbau zur Gerichts- und
Verwaltungsbehörde und schließlich der Anbin-
dung an den Postweg (1740) die gesteigerte Be-
deutung eines Amts- und ab 1885 eines Kreissit-
zes zu, die es bis zur Auflösung des Kreises Neu-
haus (1932) weitgehend aufrechterhielt. Auch
setzte im 18. Jh. ein ausgesprochener Auf-
schwung der Osteschiffahrt ein, der allerdings
mit der Anlage eines Zollwachschiffes (1834) und
dem Bau der am Ort vorbeigeführten Eisenbahn-
strecke 1881 einen deutlichen Einbruch erlebte.
So ist erst für die zweite Hälfte des 19. Jh. eine
wirtschaftliche Erholung infolge forcierter Indu-
strialisierungsbestrebungen (Rübölfabrik: 1850,
Papier-, Tabak-, Seifenfabrik: 1864, Gründung
der Neuhaus-Ostener-Zeitung: 1880) zu regi-
strieren, der schließlich der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges ein Ende setzte. Die jüngste Entwick-
lung des Ortes kennzeichnet die verstärkte Kon-
zentration auf die Bereiche Tourismus und Frei-
zeit. Der Bevölkerungszuwachs von 191 volljähri-
gen Männern (1682) auf 1506 Einwohner im Jahr
1848 spiegelt die Bedeutungszunahme des Or-
tes insbesondere im 18. und 19. Jh. wider.
DAS WESTLICHE ORTSAREAL
IM BEREICH DER EHEMALIGEN BURG
Das als Amtssitz eines erzbischöflichen Vogtes
den zentralen Aspekt der Ortsgeschichte reprä-
sentierende „Nygehus“ durchlebte bis in das
16. Jh. hinein eine wechselvolle Geschichte der
Zerstörung (1420, 1518) und des stetigen Wie-
deraufbaus (1435, vor 1547). Erhalten haben
sich von dieser als turmartiges Haus mit Vorwerk
zu rekonstruierenden Anlage nur die künstliche
Erhöhung und der annähernd quadratische Was-
sergraben, dessen heutige südwestliche Zuwe-
gung und Grabenaufschüttung eine laut Kurhan-
noverscher Landesaufnahme ältere nördliche er-
setzt. Der Standort dieses festen Hauses wird
heute durch ein Gefallenendenkmal markiert
(Bürgerpark).
Der lokalen Bedeutung dieses Platzes folgte die
Anlage eines repräsentativen Drostesitzes nord-
östlich der Burg, die neben dem heute als Kin-
derheim genutzten, stattlichen Amtshaus ver-
schiedene Nebenbauten umfaßte (Amtshof 3).
Der traufständig-achtachsige Ziegelbau unter
SI
Oz
>
——H+ -
Se — Sa ——_-.
A
Neuhaus, Kurhannoversche Landesaufnahme, 1767 (Landesvermessung und Geobasisinformation Nds.)
ES
€
Neuhaus, Amtshof 3, Ädikulaportal, 1723
255
die Aue anschließende Siedlungsbereich der mo-
dernen Ortsausdehnung zuzuordnen, die — in
den fünfziger Jahren südlich der Bülsdorfer und
westlich der Niebuhrstraße begonnen — in westli-
cher Richtung fortlaufend weitergeführt wurde.
Der früher abseits gelegene Friedhofsbezirk wur-
de somit erst in jüngster Zeit integriert.
Die historische Bedeutung von Neuhaus liegt
vorrangig in der Errichtung eines Verwaltungssit-
zes der Bremer Erzbischöfe begründet, die als
Lokalinstanz die grundherrlichen Rechte vor Ort
zu sichern suchten (z.B. Zollstation 1502). Ob-
wohl der Standort durch die Schiffahrt auf der
Oste und deren Bedeutung als direkter Wasser-
weg nach Bremervörde zur erzbischöflichen Re-
sidenz begünstigt wurde, blieb Neuhaus bis in
das 17. Jh. hinein stark landwirtschaftlich ge-
prägt. Die Berufsstruktur wurde weiterhin von Fi-
schern, „Bauleuten“ (= Hofbesitzer) und Kötnern
bestimmt, auch wenn seit 1682 verstärkt städti-
sche Gewerbe nachzuweisen sind. So wuchs
Neuhaus erst mit dem Ausbau zur Gerichts- und
Verwaltungsbehörde und schließlich der Anbin-
dung an den Postweg (1740) die gesteigerte Be-
deutung eines Amts- und ab 1885 eines Kreissit-
zes zu, die es bis zur Auflösung des Kreises Neu-
haus (1932) weitgehend aufrechterhielt. Auch
setzte im 18. Jh. ein ausgesprochener Auf-
schwung der Osteschiffahrt ein, der allerdings
mit der Anlage eines Zollwachschiffes (1834) und
dem Bau der am Ort vorbeigeführten Eisenbahn-
strecke 1881 einen deutlichen Einbruch erlebte.
So ist erst für die zweite Hälfte des 19. Jh. eine
wirtschaftliche Erholung infolge forcierter Indu-
strialisierungsbestrebungen (Rübölfabrik: 1850,
Papier-, Tabak-, Seifenfabrik: 1864, Gründung
der Neuhaus-Ostener-Zeitung: 1880) zu regi-
strieren, der schließlich der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges ein Ende setzte. Die jüngste Entwick-
lung des Ortes kennzeichnet die verstärkte Kon-
zentration auf die Bereiche Tourismus und Frei-
zeit. Der Bevölkerungszuwachs von 191 volljähri-
gen Männern (1682) auf 1506 Einwohner im Jahr
1848 spiegelt die Bedeutungszunahme des Or-
tes insbesondere im 18. und 19. Jh. wider.
DAS WESTLICHE ORTSAREAL
IM BEREICH DER EHEMALIGEN BURG
Das als Amtssitz eines erzbischöflichen Vogtes
den zentralen Aspekt der Ortsgeschichte reprä-
sentierende „Nygehus“ durchlebte bis in das
16. Jh. hinein eine wechselvolle Geschichte der
Zerstörung (1420, 1518) und des stetigen Wie-
deraufbaus (1435, vor 1547). Erhalten haben
sich von dieser als turmartiges Haus mit Vorwerk
zu rekonstruierenden Anlage nur die künstliche
Erhöhung und der annähernd quadratische Was-
sergraben, dessen heutige südwestliche Zuwe-
gung und Grabenaufschüttung eine laut Kurhan-
noverscher Landesaufnahme ältere nördliche er-
setzt. Der Standort dieses festen Hauses wird
heute durch ein Gefallenendenkmal markiert
(Bürgerpark).
Der lokalen Bedeutung dieses Platzes folgte die
Anlage eines repräsentativen Drostesitzes nord-
östlich der Burg, die neben dem heute als Kin-
derheim genutzten, stattlichen Amtshaus ver-
schiedene Nebenbauten umfaßte (Amtshof 3).
Der traufständig-achtachsige Ziegelbau unter
SI
Oz
>
——H+ -
Se — Sa ——_-.
A
Neuhaus, Kurhannoversche Landesaufnahme, 1767 (Landesvermessung und Geobasisinformation Nds.)
ES
€
Neuhaus, Amtshof 3, Ädikulaportal, 1723
255