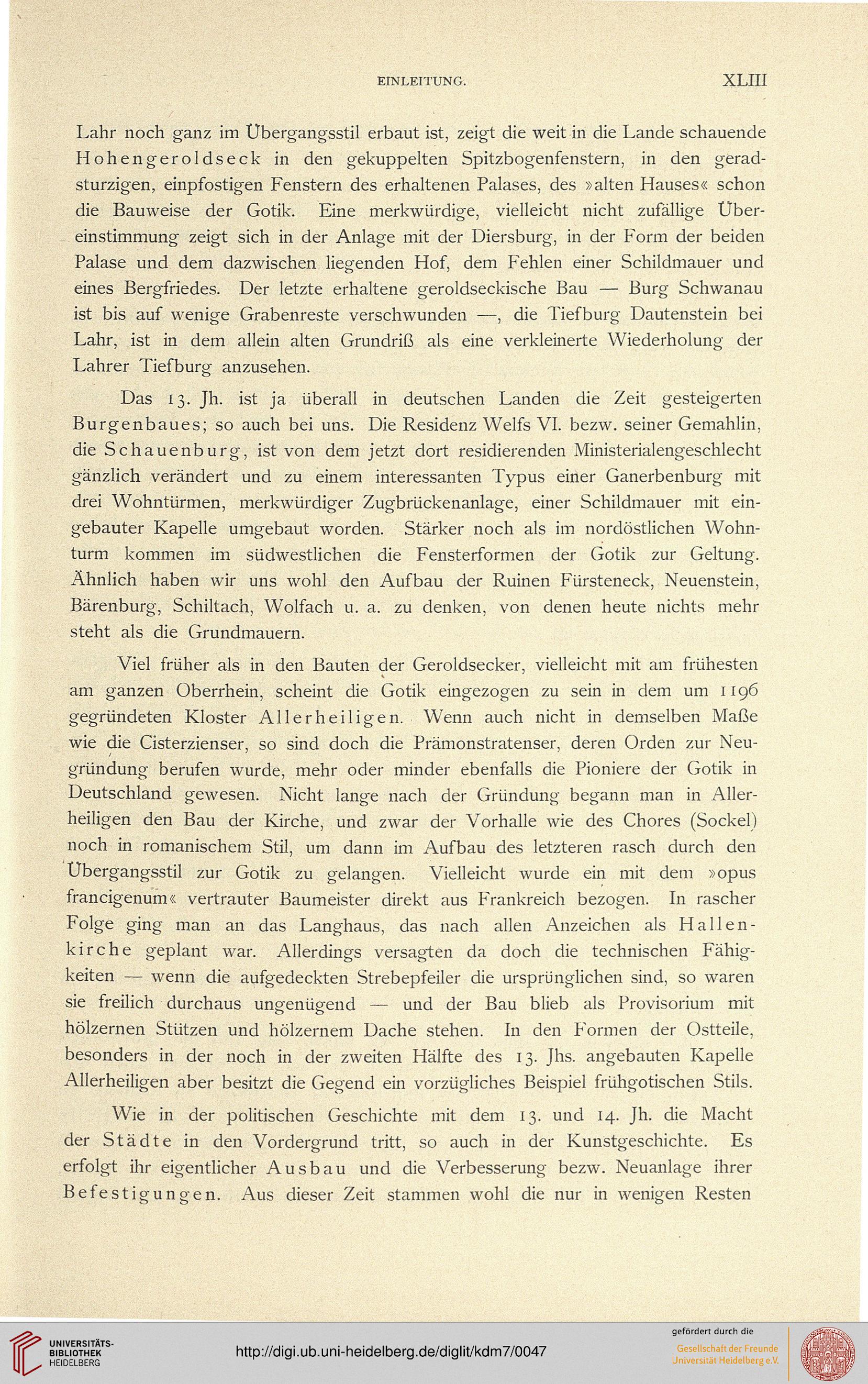EINLEITUNG. XLIII
Lahr noch ganz im Ubergangsstil erbaut ist, zeigt die weit in die Lande schauende
Hohengeroldseck in den gekuppelten Spitzbogenfenstern, in den gerad-
sturzigen, einpfostigen Fenstern des erhaltenen Palases, des »alten Hauses« schon
die Bauweise der Gotik. Eine merkwürdige, vielleicht nicht zufällige Uber-
. einstimmung zeigt sich in der Anlage mit der Diersburg, in der Form der beiden
Palase und dem dazwischen liegenden Hof, dem Fehlen einer Schildmauer und
eines Bergfriedes. Der letzte erhaltene geroldseckische Bau — Burg Schwanau
ist bis auf wenige Grabenreste verschwunden —, die Tiefburg Dautenstein bei
Lahr, ist in dem allein alten Grundriß als eine verkleinerte Wiederholung der
Lahrer Tiefburg anzusehen.
Das 13. Jh. ist ja überall in deutschen Landen die Zeit gesteigerten
Burgenbaues; so auch bei uns. Die Residenz Welfs VI. bezw. seiner Gemahlin,
die Schauenburg, ist von dem jetzt dort residierenden Ministerialengeschlecht
gänzlich verändert und zu einem interessanten Typus einer Ganerbenburg mit
drei Wohntürmen, merkwürdiger Zugbrückenanlage, einer Schildmauer mit ein-
gebauter Kapelle umgebaut worden. Stärker noch als im nordöstlichen Wohn-
turm kommen im südwestlichen die Fensterformen der Gotik zur Geltung.
Ähnlich haben wir uns wohl den Aufbau der Ruinen Fürsteneck, Neuenstein,
Bärenburg, Schiltach, Wolfach u. a. zu denken, von denen heute nichts mehr
steht als die Grundmauern.
Viel früher als in den Bauten der Geroldsecker, vielleicht mit am frühesten
am ganzen Oberrhein, scheint die Gotik eingezogen zu sein in dem um 1x96
gegründeten Kloster Allerheiligen. Wenn auch nicht in demselben Maße
wie die Cisterzienser, so sind doch die Prämonstratenser, deren Orden zur Neu-
gründung berufen wurde, mehr oder minder ebenfalls die Pioniere der Gotik in
Deutschland gewesen. Nicht lange nach der Gründung begann man in Aller-
heiligen den Bau der Kirche, und zwar der Vorhalle wie des Chores (Sockel)
noch in romanischem Stil, um dann im Aufbau des letzteren rasch durch den
Ubergangsstil zur Gotik zu gelangen. Vielleicht wurde ein mit dem »opus
francigenum« vertrauter Baumeister direkt aus Frankreich bezogen. In rascher
Folge ging man an das Langhaus, das nach allen Anzeichen als Hallen-
kirche geplant war. Allerdings versagten da doch die technischen Fähig-
keiten — wenn die aufgedeckten Strebepfeiler die ursprünglichen sind, so waren
sie freilich durchaus ungenügend — und der Bau blieb als Provisorium mit
hölzernen Stützen und hölzernem Dache stehen. In den Formen der Ostteile,
besonders in der noch in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. angebauten Kapelle
Allerheiligen aber besitzt die Gegend ein vorzügliches Beispiel frühgotischen Stils.
Wie in der politischen Geschichte mit dem 13. und 14. Jh. die Macht
der Städte in den Vordergrund tritt, so auch in der Kunstgeschichte. Es
erfolgt ihr eigentlicher Ausbau und die Verbesserung bezw. Neuanlage ihrer
Befestigungen. Aus dieser Zeit stammen wohl die nur in wenigen Resten
Lahr noch ganz im Ubergangsstil erbaut ist, zeigt die weit in die Lande schauende
Hohengeroldseck in den gekuppelten Spitzbogenfenstern, in den gerad-
sturzigen, einpfostigen Fenstern des erhaltenen Palases, des »alten Hauses« schon
die Bauweise der Gotik. Eine merkwürdige, vielleicht nicht zufällige Uber-
. einstimmung zeigt sich in der Anlage mit der Diersburg, in der Form der beiden
Palase und dem dazwischen liegenden Hof, dem Fehlen einer Schildmauer und
eines Bergfriedes. Der letzte erhaltene geroldseckische Bau — Burg Schwanau
ist bis auf wenige Grabenreste verschwunden —, die Tiefburg Dautenstein bei
Lahr, ist in dem allein alten Grundriß als eine verkleinerte Wiederholung der
Lahrer Tiefburg anzusehen.
Das 13. Jh. ist ja überall in deutschen Landen die Zeit gesteigerten
Burgenbaues; so auch bei uns. Die Residenz Welfs VI. bezw. seiner Gemahlin,
die Schauenburg, ist von dem jetzt dort residierenden Ministerialengeschlecht
gänzlich verändert und zu einem interessanten Typus einer Ganerbenburg mit
drei Wohntürmen, merkwürdiger Zugbrückenanlage, einer Schildmauer mit ein-
gebauter Kapelle umgebaut worden. Stärker noch als im nordöstlichen Wohn-
turm kommen im südwestlichen die Fensterformen der Gotik zur Geltung.
Ähnlich haben wir uns wohl den Aufbau der Ruinen Fürsteneck, Neuenstein,
Bärenburg, Schiltach, Wolfach u. a. zu denken, von denen heute nichts mehr
steht als die Grundmauern.
Viel früher als in den Bauten der Geroldsecker, vielleicht mit am frühesten
am ganzen Oberrhein, scheint die Gotik eingezogen zu sein in dem um 1x96
gegründeten Kloster Allerheiligen. Wenn auch nicht in demselben Maße
wie die Cisterzienser, so sind doch die Prämonstratenser, deren Orden zur Neu-
gründung berufen wurde, mehr oder minder ebenfalls die Pioniere der Gotik in
Deutschland gewesen. Nicht lange nach der Gründung begann man in Aller-
heiligen den Bau der Kirche, und zwar der Vorhalle wie des Chores (Sockel)
noch in romanischem Stil, um dann im Aufbau des letzteren rasch durch den
Ubergangsstil zur Gotik zu gelangen. Vielleicht wurde ein mit dem »opus
francigenum« vertrauter Baumeister direkt aus Frankreich bezogen. In rascher
Folge ging man an das Langhaus, das nach allen Anzeichen als Hallen-
kirche geplant war. Allerdings versagten da doch die technischen Fähig-
keiten — wenn die aufgedeckten Strebepfeiler die ursprünglichen sind, so waren
sie freilich durchaus ungenügend — und der Bau blieb als Provisorium mit
hölzernen Stützen und hölzernem Dache stehen. In den Formen der Ostteile,
besonders in der noch in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. angebauten Kapelle
Allerheiligen aber besitzt die Gegend ein vorzügliches Beispiel frühgotischen Stils.
Wie in der politischen Geschichte mit dem 13. und 14. Jh. die Macht
der Städte in den Vordergrund tritt, so auch in der Kunstgeschichte. Es
erfolgt ihr eigentlicher Ausbau und die Verbesserung bezw. Neuanlage ihrer
Befestigungen. Aus dieser Zeit stammen wohl die nur in wenigen Resten