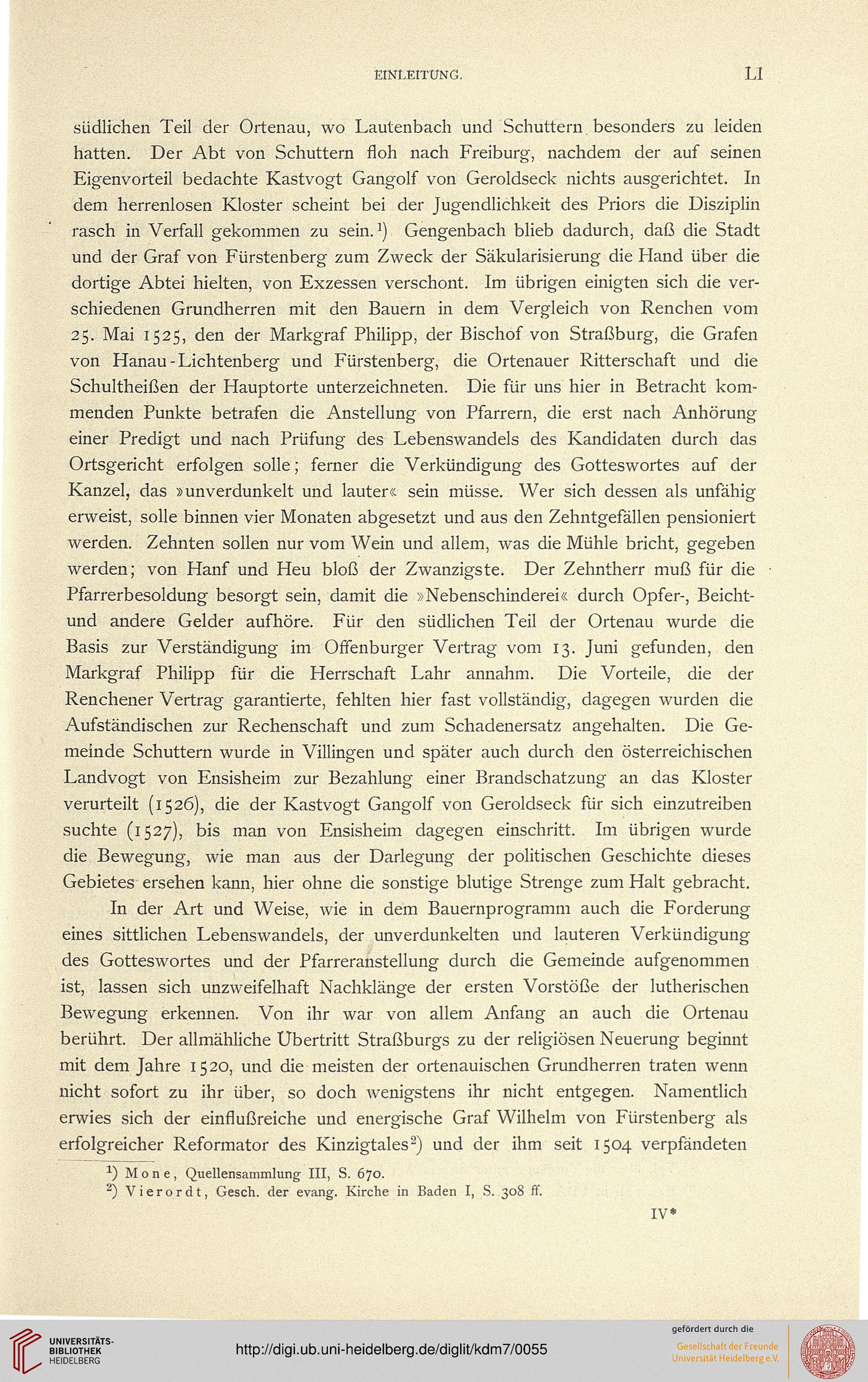EINLEITUNG. LI
südlichen Teil der Ortenau, wo Lautenbach und Schuttern. besonders zu leiden
hatten. Der Abt von Schuttern floh nach Freiburg, nachdem der auf seinen
Eigenvorteil bedachte Kastvogt Gangolf von Geroldseck nichts ausgerichtet. In
dem herrenlosen Kloster scheint bei der Jugendlichkeit des Priors die Disziplin
rasch in Verfall gekommen zu sein.1) Gengenbach blieb dadurch, daß die Stadt
und der Graf von Fürstenberg zum Zweck der Säkularisierung die Hand über die
dortige Abtei hielten, von Exzessen verschont. Im übrigen einigten sich die ver-
schiedenen Grundherren mit den Bauern in dem Vergleich von Renchen vom
25. Mai 1525, den der Markgraf Philipp, der Bischof von Straßburg, die Grafen
von Hanau - Lichtenberg und Fürstenberg, die Ortenauer Ritterschaft und die
Schultheißen der Hauptorte unterzeichneten. Die für uns hier in Betracht kom-
menden Punkte betrafen die Anstellung von Pfarrern, die erst nach Anhörung
einer Predigt und nach Prüfung des Lebenswandels des Kandidaten durch das
Ortsgericht erfolgen solle; ferner die Verkündigung des Gotteswortes auf der
Kanzel, das »unverdunkelt und lauter« sein müsse. Wer sich dessen als unfähig
erweist, solle binnen vier Monaten abgesetzt und aus den Zehntgefällen pensioniert
werden. Zehnten sollen nur vom Wein und allem, was die Mühle bricht, gegeben
werden; von Hanf und Heu bloß der Zwanzigste. Der Zehntherr muß für die
Pfarrerbesoldung besorgt sein, damit die »Nebenschinderei« durch Opfer-, Beicht-
und andere Gelder aufhöre. Für den südlichen Teil der Ortenau wurde die
Basis zur Verständigung im Offenburger Vertrag vom 13. Juni gefunden, den
Markgraf Philipp für die Herrschaft Lahr annahm. Die Vorteile, die der
Renchener Vertrag garantierte, fehlten hier fast vollständig, dagegen wurden die
Aufständischen zur Rechenschaft und zum Schadenersatz angehalten. Die Ge-
meinde Schuttern wurde in Villingen und später auch durch den österreichischen
Landvogt von Ensisheim zur Bezahlung einer Brandschatzung an das Kloster
verurteilt (1526), die der Kastvogt Gangolf von Geroldseck für sich einzutreiben
suchte (1527), bis man von Ensisheim dagegen einschritt. Im übrigen wurde
die Bewegung, wie man aus der Darlegung der politischen Geschichte dieses
Gebietes ersehen kann, hier ohne die sonstige blutige Strenge zum Halt gebracht.
In der Art und Weise, wie in dem Bauernprogramm auch die Forderung
eines sittlichen Lebenswandels, der unverdunkelten und lauteren Verkündigung
des Gotteswortes und der Pfarreranstellung durch die Gemeinde aufgenommen
ist, lassen sich unzweifelhaft Nachklänge der ersten Vorstöße der lutherischen
Bewegung erkennen. Von ihr war von allem Anfang an auch die Ortenau
berührt. Der allmähliche Übertritt Straßburgs zu der religiösen Neuerung beginnt
mit dem Jahre 1520, und die meisten der ortenauischen Grundherren traten wenn
nicht sofort zu ihr über, so doch wenigstens ihr nicht entgegen. Namentlich
erwies sich der einflußreiche und energische Graf Wilhelm von Fürstenberg als
erfolgreicher Reformator des Kinzigtales2) und der ihm seit 1504 verpfändeten
*) M 0 n e, Quellensammlung III, S. 670.
2) Vierordt, Gesch. der evang. Kirche in Baden I, S. 308 ff.
IV*
südlichen Teil der Ortenau, wo Lautenbach und Schuttern. besonders zu leiden
hatten. Der Abt von Schuttern floh nach Freiburg, nachdem der auf seinen
Eigenvorteil bedachte Kastvogt Gangolf von Geroldseck nichts ausgerichtet. In
dem herrenlosen Kloster scheint bei der Jugendlichkeit des Priors die Disziplin
rasch in Verfall gekommen zu sein.1) Gengenbach blieb dadurch, daß die Stadt
und der Graf von Fürstenberg zum Zweck der Säkularisierung die Hand über die
dortige Abtei hielten, von Exzessen verschont. Im übrigen einigten sich die ver-
schiedenen Grundherren mit den Bauern in dem Vergleich von Renchen vom
25. Mai 1525, den der Markgraf Philipp, der Bischof von Straßburg, die Grafen
von Hanau - Lichtenberg und Fürstenberg, die Ortenauer Ritterschaft und die
Schultheißen der Hauptorte unterzeichneten. Die für uns hier in Betracht kom-
menden Punkte betrafen die Anstellung von Pfarrern, die erst nach Anhörung
einer Predigt und nach Prüfung des Lebenswandels des Kandidaten durch das
Ortsgericht erfolgen solle; ferner die Verkündigung des Gotteswortes auf der
Kanzel, das »unverdunkelt und lauter« sein müsse. Wer sich dessen als unfähig
erweist, solle binnen vier Monaten abgesetzt und aus den Zehntgefällen pensioniert
werden. Zehnten sollen nur vom Wein und allem, was die Mühle bricht, gegeben
werden; von Hanf und Heu bloß der Zwanzigste. Der Zehntherr muß für die
Pfarrerbesoldung besorgt sein, damit die »Nebenschinderei« durch Opfer-, Beicht-
und andere Gelder aufhöre. Für den südlichen Teil der Ortenau wurde die
Basis zur Verständigung im Offenburger Vertrag vom 13. Juni gefunden, den
Markgraf Philipp für die Herrschaft Lahr annahm. Die Vorteile, die der
Renchener Vertrag garantierte, fehlten hier fast vollständig, dagegen wurden die
Aufständischen zur Rechenschaft und zum Schadenersatz angehalten. Die Ge-
meinde Schuttern wurde in Villingen und später auch durch den österreichischen
Landvogt von Ensisheim zur Bezahlung einer Brandschatzung an das Kloster
verurteilt (1526), die der Kastvogt Gangolf von Geroldseck für sich einzutreiben
suchte (1527), bis man von Ensisheim dagegen einschritt. Im übrigen wurde
die Bewegung, wie man aus der Darlegung der politischen Geschichte dieses
Gebietes ersehen kann, hier ohne die sonstige blutige Strenge zum Halt gebracht.
In der Art und Weise, wie in dem Bauernprogramm auch die Forderung
eines sittlichen Lebenswandels, der unverdunkelten und lauteren Verkündigung
des Gotteswortes und der Pfarreranstellung durch die Gemeinde aufgenommen
ist, lassen sich unzweifelhaft Nachklänge der ersten Vorstöße der lutherischen
Bewegung erkennen. Von ihr war von allem Anfang an auch die Ortenau
berührt. Der allmähliche Übertritt Straßburgs zu der religiösen Neuerung beginnt
mit dem Jahre 1520, und die meisten der ortenauischen Grundherren traten wenn
nicht sofort zu ihr über, so doch wenigstens ihr nicht entgegen. Namentlich
erwies sich der einflußreiche und energische Graf Wilhelm von Fürstenberg als
erfolgreicher Reformator des Kinzigtales2) und der ihm seit 1504 verpfändeten
*) M 0 n e, Quellensammlung III, S. 670.
2) Vierordt, Gesch. der evang. Kirche in Baden I, S. 308 ff.
IV*