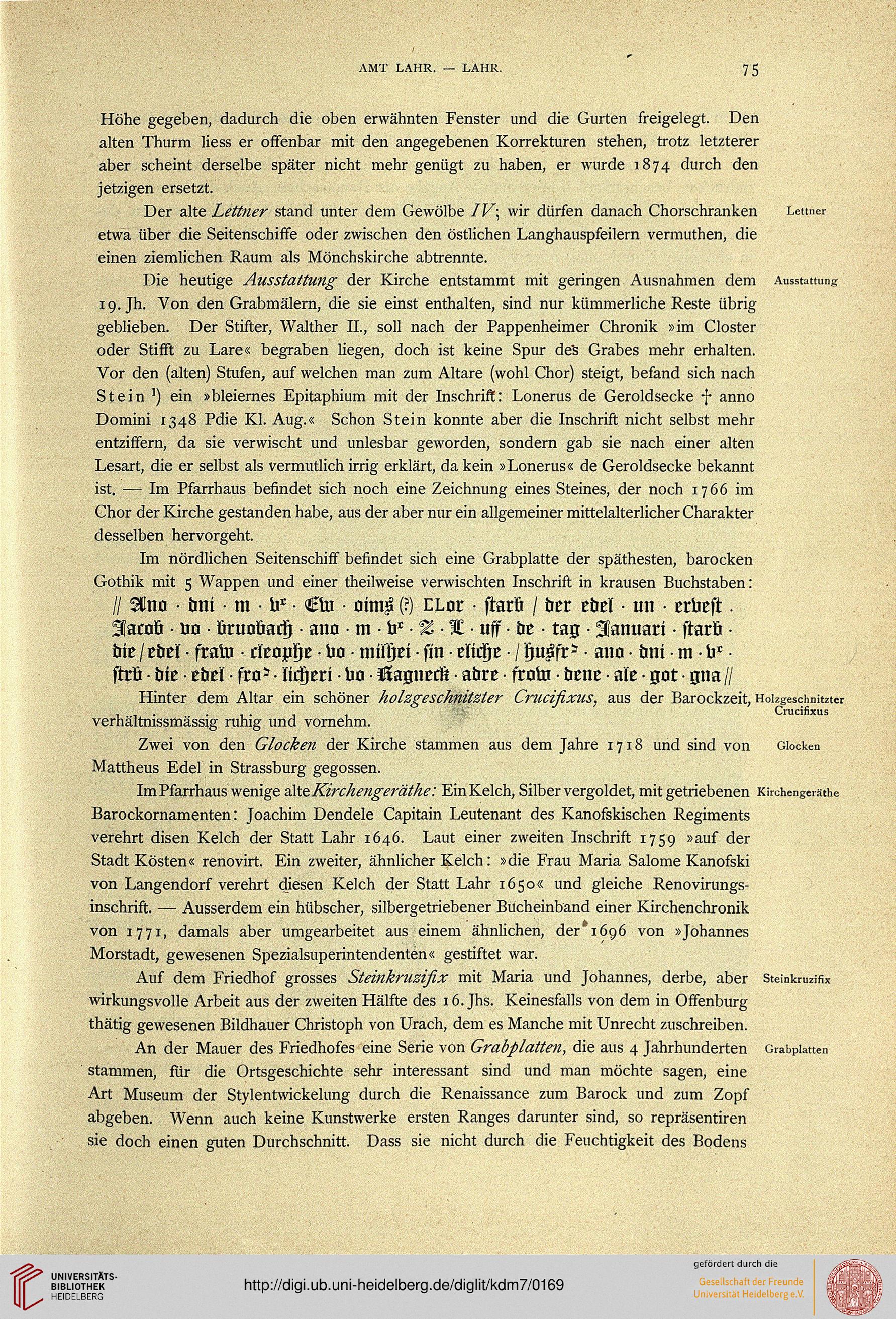AMT LAHR. — LAHR. 75
Höhe gegeben, dadurch die oben erwähnten Fenster und die Gurten freigelegt. Den
alten Thurm liess er offenbar mit den angegebenen Korrekturen stehen, trotz letzterer
aber scheint derselbe später nicht mehr genügt zu haben, er wurde 1874 durch den
jetzigen ersetzt.
Der alte Lettner stand unter dem Gewölbe IV\ wir dürfen danach Chorschranken Lettner
etwa über die Seitenschiffe oder zwischen den östlichen Langhauspfeilern vermuthen, die
einen ziemlichen Raum als Mönchskirche abtrennte.
Die heutige Ausstattung der Kirche entstammt mit geringen Ausnahmen dem Ausstattung
19. Jh. Von den Grabmälern, die sie einst enthalten, sind nur kümmerliche Reste übrig
geblieben. Der Stifter, Walther IL, soll nach der Pappenheimer Chronik »im Closter
oder Stifft zu Lare« begraben liegen, doch ist keine Spur des Grabes mehr erhalten.
Vor den (alten) Stufen, auf welchen man zum Altare (wohl Chor) steigt, befand sich nach
Stein ]) ein »bleiernes Epitaphium mit der Inschrift: Lonerus de Geroldsecke -f- anno
Domini 1348 Pdie Kl. Aug.« Schon Stein konnte aber die Inschrift nicht selbst mehr
entziffern, da sie verwischt und unlesbar geworden, sondern gab sie nach einer alten
Lesart, die er selbst als vermutlich irrig erklärt, da kein »Lonerus« de Geroldsecke bekannt
ist. — Im Pfarrhaus befindet sich noch eine Zeichnung eines Steines, der noch 1766 im
Chor der Kirche gestanden habe, aus der aber nur ein allgemeiner mittelalterlicher Charakter
desselben hervorgeht.
Im nördlichen Seitenschiff befindet sich eine Grabplatte der späthesten, barocken
Gothik mit 5 Wappen und einer theilweise verwischten Inschrift in krausen Buchstaben:
// Stno • bni • m ■ b* ■ €ta • aim$ (?) ELor • ftarft / bcr tiitl ■ un • erbeft.
Slaraö • üd • bruoöailj • ann • m • b1 • % ■ % ■ uff ■ bt ■ tag • Sfantiari • ftarfi •
öie / tbtl • frata • rienplje • bo • mifljei • fin • enrfje • / fju^fr- • ann • bni • m • b1 •
ftrfi ■ bte • tbti • fro5 • utfjeri • bn • öaguecß • ab« ■ frota ■ ötne • aie • gut • gna //
Hinter dem Altar ein schöner holzgeschnitzter Crucifixus, aus der Barockzeit, Holzgeschnitzter
verhältaissmässig ruhig und vornehm.
Zwei von den Glocken der Kirche stammen aus dem Jahre 1718 und sind von Glocken
Mattheus Edel in Strassburg gegossen.
Im Pfarrhaus wenige &\teKirchengeräthe: Ein Kelch, Silber vergoldet, mit getriebenen Khchengeräthe
Barockornamenten: Joachim Dendele Capitain Leutenant des Kanofskischen Regiments
verehrt disen Kelch der Statt Lahr 1646. Laut einer zweiten Inschrift 1759 »auf der
Stadt Kosten« renovirt. Ein zweiter, ähnlicher Kelch: »die Frau Maria Salome Kanofski
von Langendorf verehrt diesen Kelch der Statt Lahr 1650« und gleiche Renovirungs-
inschrift. — Ausserdem ein hübscher, silbergetriebener Bucheinband einer Kirchenchronik
von 1771, damals aber umgearbeitet aus einem ähnlichen, der 1696 von »Johannes
Morstadt, gewesenen Spezialsuperintendenten« gestiftet war.
Auf dem Friedhof grosses Steinkruzifix mit Maria und Johannes, derbe, aber Steinkruzifix
wirkungsvolle Arbeit aus der zweiten Hälfte des 16. Jhs. Keinesfalls von dem in Offenburg
thätig gewesenen Bildhauer Christoph von Urach, dem es Manche mit Unrecht zuschreiben.
An der Mauer des Friedhofes eine Serie von Grabplatten, die aus 4 Jahrhunderten Grabplatten
stammen, für die Ortsgeschichte sehr interessant sind und man möchte sagen, eine
Art Museum der Stylentwickelung durch die Renaissance zum Barock und zum Zopf
abgeben. Wenn auch keine Kunstwerke ersten Ranges darunter sind, so repräsentiren
sie doch einen guten Durchschnitt. Dass sie nicht durch die Feuchtigkeit des Bodens
Höhe gegeben, dadurch die oben erwähnten Fenster und die Gurten freigelegt. Den
alten Thurm liess er offenbar mit den angegebenen Korrekturen stehen, trotz letzterer
aber scheint derselbe später nicht mehr genügt zu haben, er wurde 1874 durch den
jetzigen ersetzt.
Der alte Lettner stand unter dem Gewölbe IV\ wir dürfen danach Chorschranken Lettner
etwa über die Seitenschiffe oder zwischen den östlichen Langhauspfeilern vermuthen, die
einen ziemlichen Raum als Mönchskirche abtrennte.
Die heutige Ausstattung der Kirche entstammt mit geringen Ausnahmen dem Ausstattung
19. Jh. Von den Grabmälern, die sie einst enthalten, sind nur kümmerliche Reste übrig
geblieben. Der Stifter, Walther IL, soll nach der Pappenheimer Chronik »im Closter
oder Stifft zu Lare« begraben liegen, doch ist keine Spur des Grabes mehr erhalten.
Vor den (alten) Stufen, auf welchen man zum Altare (wohl Chor) steigt, befand sich nach
Stein ]) ein »bleiernes Epitaphium mit der Inschrift: Lonerus de Geroldsecke -f- anno
Domini 1348 Pdie Kl. Aug.« Schon Stein konnte aber die Inschrift nicht selbst mehr
entziffern, da sie verwischt und unlesbar geworden, sondern gab sie nach einer alten
Lesart, die er selbst als vermutlich irrig erklärt, da kein »Lonerus« de Geroldsecke bekannt
ist. — Im Pfarrhaus befindet sich noch eine Zeichnung eines Steines, der noch 1766 im
Chor der Kirche gestanden habe, aus der aber nur ein allgemeiner mittelalterlicher Charakter
desselben hervorgeht.
Im nördlichen Seitenschiff befindet sich eine Grabplatte der späthesten, barocken
Gothik mit 5 Wappen und einer theilweise verwischten Inschrift in krausen Buchstaben:
// Stno • bni • m ■ b* ■ €ta • aim$ (?) ELor • ftarft / bcr tiitl ■ un • erbeft.
Slaraö • üd • bruoöailj • ann • m • b1 • % ■ % ■ uff ■ bt ■ tag • Sfantiari • ftarfi •
öie / tbtl • frata • rienplje • bo • mifljei • fin • enrfje • / fju^fr- • ann • bni • m • b1 •
ftrfi ■ bte • tbti • fro5 • utfjeri • bn • öaguecß • ab« ■ frota ■ ötne • aie • gut • gna //
Hinter dem Altar ein schöner holzgeschnitzter Crucifixus, aus der Barockzeit, Holzgeschnitzter
verhältaissmässig ruhig und vornehm.
Zwei von den Glocken der Kirche stammen aus dem Jahre 1718 und sind von Glocken
Mattheus Edel in Strassburg gegossen.
Im Pfarrhaus wenige &\teKirchengeräthe: Ein Kelch, Silber vergoldet, mit getriebenen Khchengeräthe
Barockornamenten: Joachim Dendele Capitain Leutenant des Kanofskischen Regiments
verehrt disen Kelch der Statt Lahr 1646. Laut einer zweiten Inschrift 1759 »auf der
Stadt Kosten« renovirt. Ein zweiter, ähnlicher Kelch: »die Frau Maria Salome Kanofski
von Langendorf verehrt diesen Kelch der Statt Lahr 1650« und gleiche Renovirungs-
inschrift. — Ausserdem ein hübscher, silbergetriebener Bucheinband einer Kirchenchronik
von 1771, damals aber umgearbeitet aus einem ähnlichen, der 1696 von »Johannes
Morstadt, gewesenen Spezialsuperintendenten« gestiftet war.
Auf dem Friedhof grosses Steinkruzifix mit Maria und Johannes, derbe, aber Steinkruzifix
wirkungsvolle Arbeit aus der zweiten Hälfte des 16. Jhs. Keinesfalls von dem in Offenburg
thätig gewesenen Bildhauer Christoph von Urach, dem es Manche mit Unrecht zuschreiben.
An der Mauer des Friedhofes eine Serie von Grabplatten, die aus 4 Jahrhunderten Grabplatten
stammen, für die Ortsgeschichte sehr interessant sind und man möchte sagen, eine
Art Museum der Stylentwickelung durch die Renaissance zum Barock und zum Zopf
abgeben. Wenn auch keine Kunstwerke ersten Ranges darunter sind, so repräsentiren
sie doch einen guten Durchschnitt. Dass sie nicht durch die Feuchtigkeit des Bodens