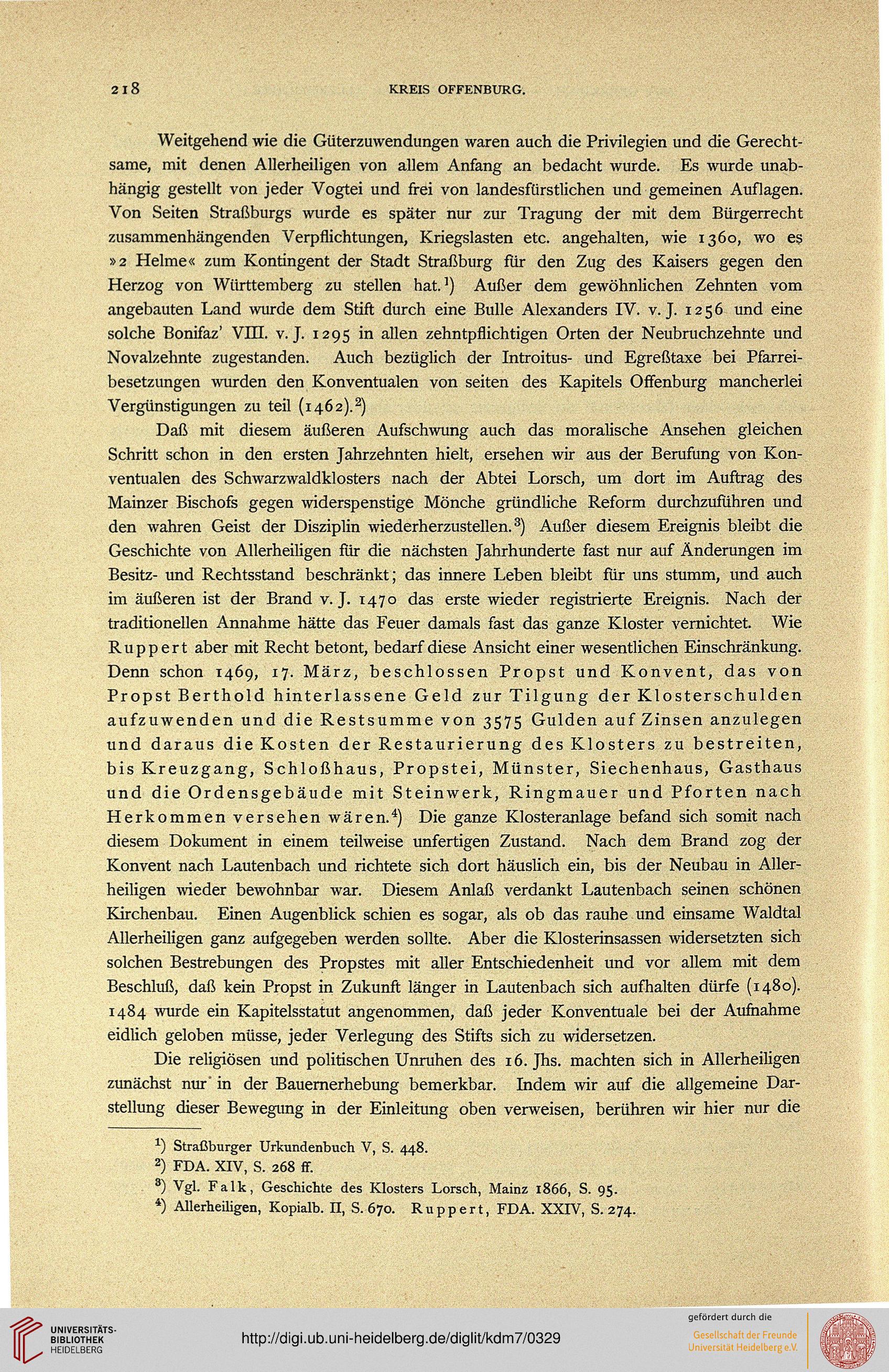2l8 KREIS OFFENBURG.
Weitgehend wie die Güterzuwendungen waren auch die Privilegien und die Gerecht-
same, mit denen Allerheiligen von allem Anfang an bedacht wurde. Es wurde unab-
hängig gestellt von jeder Vogtei und frei von landesfürstlichen und gemeinen Auflagen.
Von Seiten Straßburgs wurde es später nur zur Tragung der mit dem Bürgerrecht
zusammenhängenden Verpflichtungen, Kriegslasten etc. angehalten, wie 1360, wo es
»2 Helme« zum Kontingent der Stadt Straßburg für den Zug des Kaisers gegen den
Herzog von Württemberg zu stellen hat.') Außer dem gewöhnlichen Zehnten vom
angebauten Land wurde dem Stift durch eine Bulle Alexanders IV. v.J. 1256 und eine
solche Bonifaz' VHI. v.J. 1295 in allen zehntpflichtigen Orten der Neubruchzehnte und
Novalzehnte zugestanden. Auch bezüglich der Introitus- und Egreßtaxe bei Pfarrei-
besetzungen wurden den Konventualen von seiten des Kapitels Offenburg mancherlei
Vergünstigungen zu teil (1462).2)
Daß mit diesem äußeren Aufschwung auch das moralische Ansehen gleichen
Schritt schon in den ersten Jahrzehnten hielt, ersehen wir aus der Berufung von Kon-
ventualen des Schwarzwaldklosters nach der Abtei Lorsch, um dort im Auftrag des
Mainzer Bischofs gegen widerspenstige Mönche gründliche Reform durchzuführen und
den wahren Geist der Disziplin wiederherzustellen.3) Außer diesem Ereignis bleibt die
Geschichte von Allerheiligen für die nächsten Jahrhunderte fast nur auf Änderungen im
Besitz- und Rechtsstand beschränkt; das innere Leben bleibt für uns stumm, und auch
im äußeren ist der Brand v. J. 1470 das erste wieder registrierte Ereignis. Nach der
traditionellen Annahme hätte das Feuer damals fast das ganze Kloster vernichtet. Wie
Ruppert aber mit Recht betont, bedarf diese Ansicht einer wesentlichen Einschränkung.
Denn schon 1469, 17. März, beschlossen Propst und Konvent, das von
Propst Berthold hinterlassene Geld zur Tilgung der Klosterschulden
aufzuwenden und die Restsumme von 3575 Gulden auf Zinsen anzulegen
und daraus die Kosten der Restaurierung des Klosters zu bestreiten,
bis Kreuzgang, Schloßhaus, Propstei, Münster, Siechenhaus, Gasthaus
und die Ordensgebäude mit Steinwerk, Ringmauer und Pforten nach
Herkommen versehen wären.4) Die ganze Klosteranlage befand sich somit nach
diesem Dokument in einem teilweise unfertigen Zustand. Nach dem Brand zog der
Konvent nach Lautenbach und richtete sich dort häuslich ein, bis der Neubau in Aller-
heiligen wieder bewohnbar war. Diesem Anlaß verdankt Lautenbach seinen schönen
Kirchenbau. Einen Augenblick schien es sogar, als ob das rauhe und einsame Waldtal
Allerheiligen ganz aufgegeben werden sollte. Aber die Klosterinsassen widersetzten sich
solchen Bestrebungen des Propstes mit aller Entschiedenheit und vor allem mit dem
Beschluß, daß kein Propst in Zukunft länger in Lautenbach sich aufhalten dürfe (1480).
1484 wurde ein Kapitelsstatut angenommen, daß jeder Konventuale bei der Aufnahme
eidlich geloben müsse, jeder Verlegung des Stifts sich zu widersetzen.
Die religiösen und politischen Unruhen des 16. Jhs. machten sich in Allerheiligen
zunächst nur' in der Bauernerhebung bemerkbar. Indem wir auf die allgemeine Dar-
stellung dieser Bewegung in der Einleitung oben verweisen, berühren wir hier nur die
*) Straßburger Urkundenbuch V, S. 448.
2) FDA. XIV, S. 268 ff.
. ") Vgl. Falk, Geschichte des Klosters Lorsch, Mainz 1866, S. 95.
*) Allerheiligen, Kopialb. II, S. 670. Ruppert, FDA. XXIV, S. 274.
Weitgehend wie die Güterzuwendungen waren auch die Privilegien und die Gerecht-
same, mit denen Allerheiligen von allem Anfang an bedacht wurde. Es wurde unab-
hängig gestellt von jeder Vogtei und frei von landesfürstlichen und gemeinen Auflagen.
Von Seiten Straßburgs wurde es später nur zur Tragung der mit dem Bürgerrecht
zusammenhängenden Verpflichtungen, Kriegslasten etc. angehalten, wie 1360, wo es
»2 Helme« zum Kontingent der Stadt Straßburg für den Zug des Kaisers gegen den
Herzog von Württemberg zu stellen hat.') Außer dem gewöhnlichen Zehnten vom
angebauten Land wurde dem Stift durch eine Bulle Alexanders IV. v.J. 1256 und eine
solche Bonifaz' VHI. v.J. 1295 in allen zehntpflichtigen Orten der Neubruchzehnte und
Novalzehnte zugestanden. Auch bezüglich der Introitus- und Egreßtaxe bei Pfarrei-
besetzungen wurden den Konventualen von seiten des Kapitels Offenburg mancherlei
Vergünstigungen zu teil (1462).2)
Daß mit diesem äußeren Aufschwung auch das moralische Ansehen gleichen
Schritt schon in den ersten Jahrzehnten hielt, ersehen wir aus der Berufung von Kon-
ventualen des Schwarzwaldklosters nach der Abtei Lorsch, um dort im Auftrag des
Mainzer Bischofs gegen widerspenstige Mönche gründliche Reform durchzuführen und
den wahren Geist der Disziplin wiederherzustellen.3) Außer diesem Ereignis bleibt die
Geschichte von Allerheiligen für die nächsten Jahrhunderte fast nur auf Änderungen im
Besitz- und Rechtsstand beschränkt; das innere Leben bleibt für uns stumm, und auch
im äußeren ist der Brand v. J. 1470 das erste wieder registrierte Ereignis. Nach der
traditionellen Annahme hätte das Feuer damals fast das ganze Kloster vernichtet. Wie
Ruppert aber mit Recht betont, bedarf diese Ansicht einer wesentlichen Einschränkung.
Denn schon 1469, 17. März, beschlossen Propst und Konvent, das von
Propst Berthold hinterlassene Geld zur Tilgung der Klosterschulden
aufzuwenden und die Restsumme von 3575 Gulden auf Zinsen anzulegen
und daraus die Kosten der Restaurierung des Klosters zu bestreiten,
bis Kreuzgang, Schloßhaus, Propstei, Münster, Siechenhaus, Gasthaus
und die Ordensgebäude mit Steinwerk, Ringmauer und Pforten nach
Herkommen versehen wären.4) Die ganze Klosteranlage befand sich somit nach
diesem Dokument in einem teilweise unfertigen Zustand. Nach dem Brand zog der
Konvent nach Lautenbach und richtete sich dort häuslich ein, bis der Neubau in Aller-
heiligen wieder bewohnbar war. Diesem Anlaß verdankt Lautenbach seinen schönen
Kirchenbau. Einen Augenblick schien es sogar, als ob das rauhe und einsame Waldtal
Allerheiligen ganz aufgegeben werden sollte. Aber die Klosterinsassen widersetzten sich
solchen Bestrebungen des Propstes mit aller Entschiedenheit und vor allem mit dem
Beschluß, daß kein Propst in Zukunft länger in Lautenbach sich aufhalten dürfe (1480).
1484 wurde ein Kapitelsstatut angenommen, daß jeder Konventuale bei der Aufnahme
eidlich geloben müsse, jeder Verlegung des Stifts sich zu widersetzen.
Die religiösen und politischen Unruhen des 16. Jhs. machten sich in Allerheiligen
zunächst nur' in der Bauernerhebung bemerkbar. Indem wir auf die allgemeine Dar-
stellung dieser Bewegung in der Einleitung oben verweisen, berühren wir hier nur die
*) Straßburger Urkundenbuch V, S. 448.
2) FDA. XIV, S. 268 ff.
. ") Vgl. Falk, Geschichte des Klosters Lorsch, Mainz 1866, S. 95.
*) Allerheiligen, Kopialb. II, S. 670. Ruppert, FDA. XXIV, S. 274.