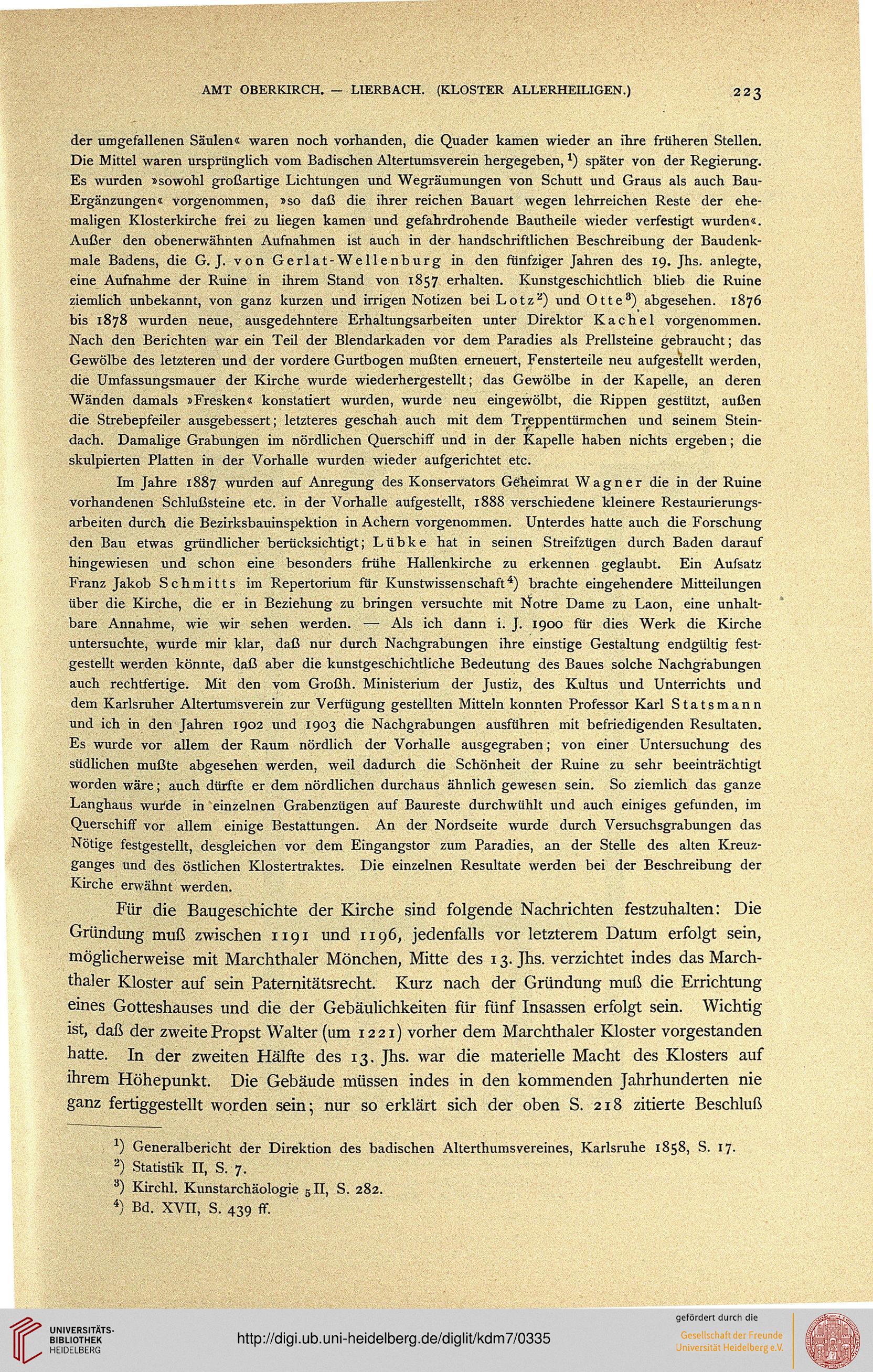AMT OBERKIRCH. — LIERBACH. (KLOSTER ALLERHEILIGEN.) 223
der umgefallenen Säulen« waren noch vorhanden, die Quader kamen wieder an ihre früheren Stellen.
Die Mittel waren ursprünglich vom Badischen Altertumsverein hergegeben,') später von der Regierung.
Es wurden »sowohl großartige Lichtungen und Wegräumungen von Schutt und Graus als auch Bau-
Ergänzungen« vorgenommen, »so daß die ihrer reichen Bauart wegen lehrreichen Reste der ehe-
maligen Klosterkirche frei zu liegen kamen und gefahrdrohende Bautheile wieder verfestigt wurden«.
Außer den obenerwähnten Aufnahmen ist auch in der handschriftlichen Beschreibung der Baudenk-
male Badens, die G. J. von Gerlat-Wellenburg in den fünfziger Jahren des 19. Jhs. anlegte,
eine Aufnahme der Ruine in ihrem Stand von 1857 erhalten. Kunstgeschichtlich blieb die Ruine
ziemlich unbekannt, von ganz kurzen und irrigen Notizen bei Lotz2) und Otte8) abgesehen. 1876
bis 1878 wurden neue, ausgedehntere Erhaltungsarbeiten unter Direktor Kachel vorgenommen.
Nach den Berichten war ein Teil der Blendarkaden vor dem Paradies als Prellsteine gebraucht; das
Gewölbe des letzteren und der vordere Gurtbogen mußten erneuert, Fensterteile neu aufgestellt werden,
die Umfassungsmauer der Kirche wurde wiederhergestellt; das Gewölbe in der Kapelle, an deren
Wänden damals »Fresken« konstatiert wurden, wurde neu eingewölbt, die Rippen gestützt, außen
die Strebepfeiler ausgebessert; letzteres geschah auch mit dem Treppentürmchen und seinem Stein-
dach. Damalige Grabungen im nördlichen Querschiff und in der Kapelle haben nichts ergeben; die
skulpierten Platten in der Vorhalle wurden wieder aufgerichtet etc.
Im Jahre 1887 wurden auf Anregung des Konservators Ge'heimrat Wagner die in der Ruine
vorhandenen Schlußsteine etc. in der Vorhalle aufgestellt, 1888 verschiedene kleinere Restaurierungs-
arbeiten durch die Bezirksbauinspektion in Achern vorgenommen. Unterdes hatte auch die Forschung
den Bau etwas gründlicher berücksichtigt; Lübke hat in seinen Streifzügen durch Baden darauf
hingewiesen und schön eine besonders frühe Hallenkirche zu erkennen geglaubt. Ein Aufsatz
Franz Jakob Schmitts im Repertorium für Kunstwissenschaft4) brachte eingehendere Mitteilungen
über die Kirche, die er in Beziehung zu bringen versuchte mit Notre Dame zu Laon, eine unhalt-
bare Annahme, wie wir sehen werden. — Als ich dann i. J. 1900 für dies Werk die Kirche
untersuchte, wurde mir klar, daß nur durch Nachgrabungen ihre einstige Gestaltung endgültig fest-
gestellt werden könnte, daß aber die kunstgeschichtliche Bedeutung des Baues solche Nachgrabungen
auch rechtfertige. Mit den vom Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts und
dem Karlsruher Altertumsverein zur Verfügung gestellten Mitteln konnten Professor Karl Statsmann
und ich in den Jahren 1902 und 1903 die Nachgrabungen ausführen mit befriedigenden Resultaten.
Es wurde vor allem der Raum nördlich der Vorhalle ausgegraben; von einer Untersuchung des
südlichen mußte abgesehen werden, weil dadurch die Schönheit der Ruine zu sehr beeinträchtigt
worden wäre; auch dürfte er dem nördlichen durchaus ähnlich gewesen sein. So ziemlich das ganze
Langhaus wurtäe in einzelnen Grabenzügen auf Baureste durchwühlt und auch einiges gefunden, im
Querschiff vor allem einige Bestattungen. An der Nordseite wurde durch Versuchsgrabungen das
Nötige festgestellt, desgleichen vor dem Eingangstor zum Paradies, an der Stelle des alten Kreuz-
ganges und des östlichen Klostertraktes. Die einzelnen Resultate werden bei der Beschreibung der
Kirche erwähnt werden.
Für die Baugeschichte der Kirche sind folgende Nachrichten festzuhalten: Die
Gründung muß zwischen 1191 und 1196, jedenfalls vor letzterem Datum erfolgt sein,
möglicherweise mit Marchthaler Mönchen, Mitte des 13. Jhs. verzichtet indes das March-
thaler Kloster auf sein Paternitätsrecht. Kurz nach der Gründung muß die Errichtung
eines Gotteshauses und die der Gebäulichkeiten für fünf Insassen erfolgt sein. Wichtig
ist, daß der zweite Propst Walter (um 1221) vorher dem Marchthaler Kloster vorgestanden
hatte. In der zweiten Hälfte des 13. Jhs. war die materielle Macht des Klosters auf
ihrem Höhepunkt. Die Gebäude müssen indes in den kommenden Jahrhunderten nie
ganz fertiggestellt worden sein; nur so erklärt sich der oben S. 218 zitierte Beschluß
) Generalbericht der Direktion des badischen Alterthumsvereines, Karlsruhe 1858, S.
2) Statistik II, S. 7.
3) Kirchl. Kunstarchäologie SII, S. 282.
*) Bd. xvn, s. 439 ff.
der umgefallenen Säulen« waren noch vorhanden, die Quader kamen wieder an ihre früheren Stellen.
Die Mittel waren ursprünglich vom Badischen Altertumsverein hergegeben,') später von der Regierung.
Es wurden »sowohl großartige Lichtungen und Wegräumungen von Schutt und Graus als auch Bau-
Ergänzungen« vorgenommen, »so daß die ihrer reichen Bauart wegen lehrreichen Reste der ehe-
maligen Klosterkirche frei zu liegen kamen und gefahrdrohende Bautheile wieder verfestigt wurden«.
Außer den obenerwähnten Aufnahmen ist auch in der handschriftlichen Beschreibung der Baudenk-
male Badens, die G. J. von Gerlat-Wellenburg in den fünfziger Jahren des 19. Jhs. anlegte,
eine Aufnahme der Ruine in ihrem Stand von 1857 erhalten. Kunstgeschichtlich blieb die Ruine
ziemlich unbekannt, von ganz kurzen und irrigen Notizen bei Lotz2) und Otte8) abgesehen. 1876
bis 1878 wurden neue, ausgedehntere Erhaltungsarbeiten unter Direktor Kachel vorgenommen.
Nach den Berichten war ein Teil der Blendarkaden vor dem Paradies als Prellsteine gebraucht; das
Gewölbe des letzteren und der vordere Gurtbogen mußten erneuert, Fensterteile neu aufgestellt werden,
die Umfassungsmauer der Kirche wurde wiederhergestellt; das Gewölbe in der Kapelle, an deren
Wänden damals »Fresken« konstatiert wurden, wurde neu eingewölbt, die Rippen gestützt, außen
die Strebepfeiler ausgebessert; letzteres geschah auch mit dem Treppentürmchen und seinem Stein-
dach. Damalige Grabungen im nördlichen Querschiff und in der Kapelle haben nichts ergeben; die
skulpierten Platten in der Vorhalle wurden wieder aufgerichtet etc.
Im Jahre 1887 wurden auf Anregung des Konservators Ge'heimrat Wagner die in der Ruine
vorhandenen Schlußsteine etc. in der Vorhalle aufgestellt, 1888 verschiedene kleinere Restaurierungs-
arbeiten durch die Bezirksbauinspektion in Achern vorgenommen. Unterdes hatte auch die Forschung
den Bau etwas gründlicher berücksichtigt; Lübke hat in seinen Streifzügen durch Baden darauf
hingewiesen und schön eine besonders frühe Hallenkirche zu erkennen geglaubt. Ein Aufsatz
Franz Jakob Schmitts im Repertorium für Kunstwissenschaft4) brachte eingehendere Mitteilungen
über die Kirche, die er in Beziehung zu bringen versuchte mit Notre Dame zu Laon, eine unhalt-
bare Annahme, wie wir sehen werden. — Als ich dann i. J. 1900 für dies Werk die Kirche
untersuchte, wurde mir klar, daß nur durch Nachgrabungen ihre einstige Gestaltung endgültig fest-
gestellt werden könnte, daß aber die kunstgeschichtliche Bedeutung des Baues solche Nachgrabungen
auch rechtfertige. Mit den vom Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts und
dem Karlsruher Altertumsverein zur Verfügung gestellten Mitteln konnten Professor Karl Statsmann
und ich in den Jahren 1902 und 1903 die Nachgrabungen ausführen mit befriedigenden Resultaten.
Es wurde vor allem der Raum nördlich der Vorhalle ausgegraben; von einer Untersuchung des
südlichen mußte abgesehen werden, weil dadurch die Schönheit der Ruine zu sehr beeinträchtigt
worden wäre; auch dürfte er dem nördlichen durchaus ähnlich gewesen sein. So ziemlich das ganze
Langhaus wurtäe in einzelnen Grabenzügen auf Baureste durchwühlt und auch einiges gefunden, im
Querschiff vor allem einige Bestattungen. An der Nordseite wurde durch Versuchsgrabungen das
Nötige festgestellt, desgleichen vor dem Eingangstor zum Paradies, an der Stelle des alten Kreuz-
ganges und des östlichen Klostertraktes. Die einzelnen Resultate werden bei der Beschreibung der
Kirche erwähnt werden.
Für die Baugeschichte der Kirche sind folgende Nachrichten festzuhalten: Die
Gründung muß zwischen 1191 und 1196, jedenfalls vor letzterem Datum erfolgt sein,
möglicherweise mit Marchthaler Mönchen, Mitte des 13. Jhs. verzichtet indes das March-
thaler Kloster auf sein Paternitätsrecht. Kurz nach der Gründung muß die Errichtung
eines Gotteshauses und die der Gebäulichkeiten für fünf Insassen erfolgt sein. Wichtig
ist, daß der zweite Propst Walter (um 1221) vorher dem Marchthaler Kloster vorgestanden
hatte. In der zweiten Hälfte des 13. Jhs. war die materielle Macht des Klosters auf
ihrem Höhepunkt. Die Gebäude müssen indes in den kommenden Jahrhunderten nie
ganz fertiggestellt worden sein; nur so erklärt sich der oben S. 218 zitierte Beschluß
) Generalbericht der Direktion des badischen Alterthumsvereines, Karlsruhe 1858, S.
2) Statistik II, S. 7.
3) Kirchl. Kunstarchäologie SII, S. 282.
*) Bd. xvn, s. 439 ff.