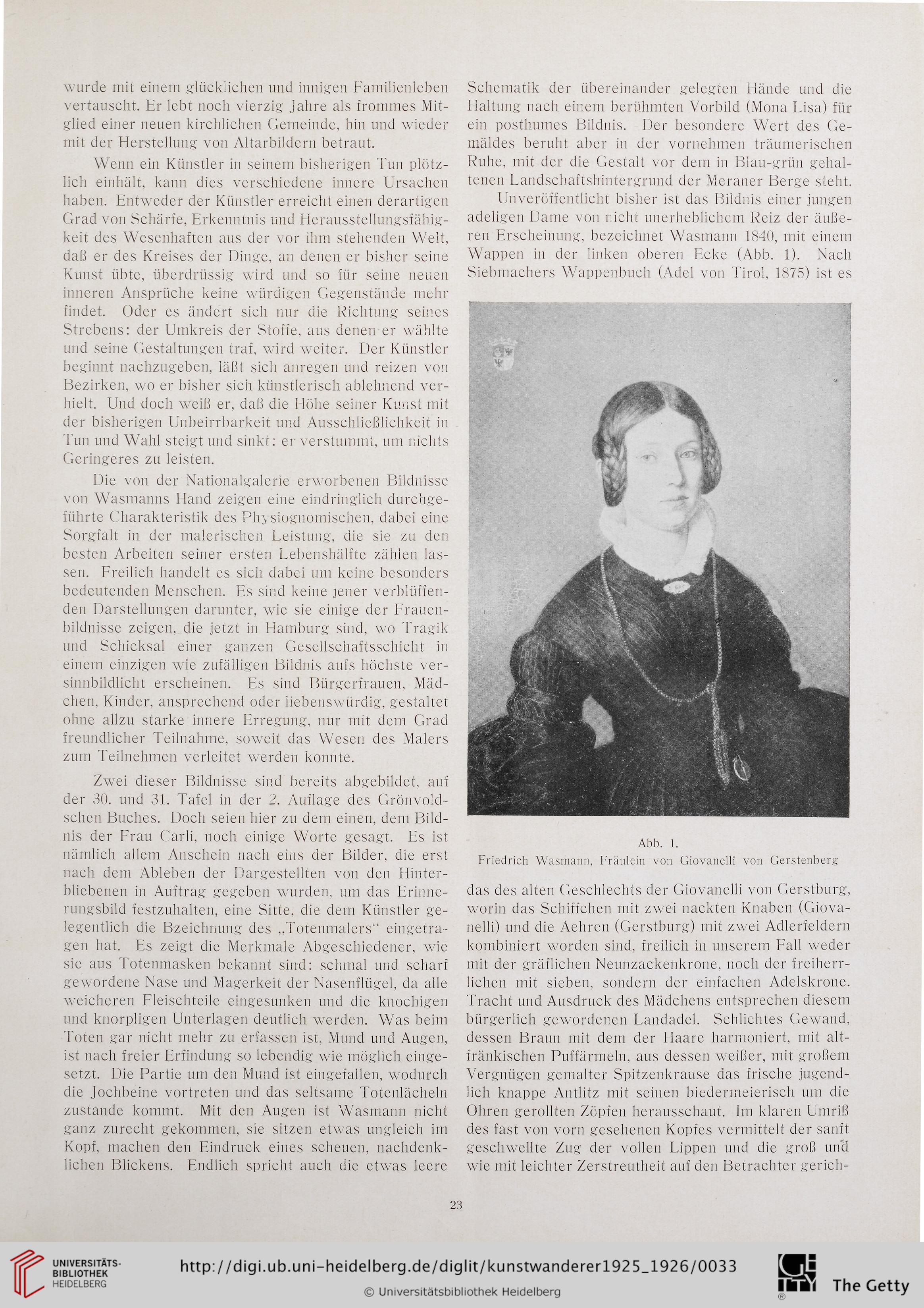wurde mit einem glücklichen und innigen Familienleben
vertauscht. Er lebt noch vierzig Jahre als frommes Mit-
glied einer neuen kirchlichen Gemeinde, hin und wieder
mit der Herstellung von Altarbildern betraut.
Wenn ein Künstler in seinem bisherigen Tun plötz-
lich einhält, kann dies verschiedene innere Ursachen
haben. Entweder der Künstler erreicht einen derartigen
Grad von Schärfe, Erkenntnis und Herausstellungsfähig-
keit des Wesenhaften aus der vor llnn stehenden Welt,
daß er des Kreises der Dinge, an denen er bisher seine
Kunst übte, überdrüssig wird und so für seine neuen
inneren Ansprüche keine würdigen Gegenstände mehr
findet. Oder es ändert sich nur die Richtung seines
Strebens: der Umkreis der Stoffe, aus denen er wählte
und seine Gestaltungen traf, wird weiter. Der Künstler
beginnt nachzugeben, Iäßt sich anregen und reizen von
Bezirken, wo er bisher sich künstlerisch ablehnend ver-
hielt. Und doch weiß er, daß die Höhe seiner Kunst mit
der bisherigen Unbeirrbarkeit und Ausschließlichkeit in
Tun und Wahl steigt und sinkt: er verstummt, um nichts
Geringeres zu leisten.
Die von der Nationalgalerie erworbenen Bildnisse
von Wasmanns Hand zeigen eine eindringlich durchge-
lührte Charakteristik des Physiognornischen, dabei eine
Sorgfalt in der malerischen Leistung, die sie zu den
besten Arbeiten seiner ersten Lebenshälfte zählen las-
sen. Freilich handelt es sich dabei um keiue besonders
bedeutenden Menschen. Es sind keine jener verblüffen-
den Darstellungen darunter, wie sie einige der Erauen-
bildnisse zeigen, die jetzt in Hamburg sind, wo Tragik
und Schicksal einer ganzen Gesellschaftsschicht in
einem einzigen wie zufälligen Bildnis auls höchste ver-
sinnbildlicht erscheinen. Es sind Bürgerfrauen, Mäd-
chen, Kinder, ansprechend oder iiebenswürdig, gestaltet
ohne allzu starke innere Erregung, nur mit dem Grad
freundlicher Teilnahme, soweit das Wesen des Malers
zum Teilnehmen verleitet werden konnte.
Zwei dieser Bildnisse sind bereits abgebildet, auf
der 30. und 3E Tafel in der 2. Auflage des Grönvold-
schen Buches. Doch seien hier zu dem einen, dem Bild-
nis der Frau Carli, noch einige Worte gesagt. Es ist
nämlich allem Anschein nach eins der Bilder, die erst
nach dem Ableben der Dargestellten von den Hinter-
bliebenen in Auftrag gegeben wurden, um das Erinne-
rungsbild festzuhalten, eine Sitte, die dem Künstler ge-
legentlich die Bzeichnung des „Totenmalers“ eingetra-
gen hat. Es zeigt die Merkrnale Abgeschiedener, wie
sie aus Totenmasken bekannt sind: schmal und sclrarf
gewordene Nase und Magerkeit der Nasenflügel, da alle
weicheren Fleischteile eingesunken und die knochigen
und knorpligen Unterlagen deutlich werden. Was beim
Toten gar nicht mehr zu erfassen ist, Mund und Augen,
ist nach freier Erfindung so lebendig wie möglich einge-
setzt. Die Partie um den Mund ist eingefallen, wodurch
die Jochbeine vortreten und das seltsame Totenlächeln
zustande kommt. Mit den Augen ist Wasmann nicht
ganz zurecht gekommen, sie sitzen etwas ungleich im
Kopf, machen den Eindruck eines scheuen, nachdenk-
lichen Blickens. Endlich spricht auch die etwas leere
Schematik der übereinander gelegten Hände und die
Haltung nach eiuem berühmten Vorbild (Mona Lisa) für
ein posthumes Bildnis. Der besondere Wert des Ge-
mäldes beruht aber in der vornehmen träumerischen
Ruhe, mit der die Gestalt vor dem in Blau-grün gehal-
tenen Landschaftshintergrund der Meraner Berge steht.
Unveröffentlicht bisher ist das Bildnis einer jungen
adeligen Dame von nicht unerheblichem Reiz der äuße-
ren Erscheinung, bezeichnet Wasmann 1840, mit einem
Wappen in der linken oberen Ecke (Abb. 1). Nacb
Siebmachers Wappenbuch (Adel von Tirol, 1875) ist es
Abb. 1.
Friedrich Wasmann, Fräulein von Giovanelli von Gerstenberg
das des alten Geschlechts der Giovanelli von Gerstburg,
worin das Schiffchen mit zwei nackten Knaben (Giova-
nelli) und die Aehren (Gerstburg) mit zwei Adlerfeldern
kombiniert worden sind, freilich in unserem Fall weder
mit der gräflichen Neunzackenkrone, noch der freiherr-
lichen mit sieben, sondern der einfachen Adelskrone.
Tracht und Ausdruck des Mädchens entsprechen diesem
bürgerlich gewordenen Landadel. Schlichtes Gewand,
dessen Braun mit dem der Haare harmoniert, mit alt-
fränkischen Puffärmeln, aus dessen weißer, mit großem
Vergnügen gemalter Spitzenkrause das frische jugend-
Jich knappe Antlitz mit seiuen biedermeierisch um die
Ohren gerollten Zöpfen herausschaut. Irn klaren Umriß
des fast von vorn gesehenen Kopfes vermittelt der sanft
geschwellte Zug der vollen Lippen und die groß uncl
wie mit leichter Zerstreutheit auf den Betrachter gerich-
23
vertauscht. Er lebt noch vierzig Jahre als frommes Mit-
glied einer neuen kirchlichen Gemeinde, hin und wieder
mit der Herstellung von Altarbildern betraut.
Wenn ein Künstler in seinem bisherigen Tun plötz-
lich einhält, kann dies verschiedene innere Ursachen
haben. Entweder der Künstler erreicht einen derartigen
Grad von Schärfe, Erkenntnis und Herausstellungsfähig-
keit des Wesenhaften aus der vor llnn stehenden Welt,
daß er des Kreises der Dinge, an denen er bisher seine
Kunst übte, überdrüssig wird und so für seine neuen
inneren Ansprüche keine würdigen Gegenstände mehr
findet. Oder es ändert sich nur die Richtung seines
Strebens: der Umkreis der Stoffe, aus denen er wählte
und seine Gestaltungen traf, wird weiter. Der Künstler
beginnt nachzugeben, Iäßt sich anregen und reizen von
Bezirken, wo er bisher sich künstlerisch ablehnend ver-
hielt. Und doch weiß er, daß die Höhe seiner Kunst mit
der bisherigen Unbeirrbarkeit und Ausschließlichkeit in
Tun und Wahl steigt und sinkt: er verstummt, um nichts
Geringeres zu leisten.
Die von der Nationalgalerie erworbenen Bildnisse
von Wasmanns Hand zeigen eine eindringlich durchge-
lührte Charakteristik des Physiognornischen, dabei eine
Sorgfalt in der malerischen Leistung, die sie zu den
besten Arbeiten seiner ersten Lebenshälfte zählen las-
sen. Freilich handelt es sich dabei um keiue besonders
bedeutenden Menschen. Es sind keine jener verblüffen-
den Darstellungen darunter, wie sie einige der Erauen-
bildnisse zeigen, die jetzt in Hamburg sind, wo Tragik
und Schicksal einer ganzen Gesellschaftsschicht in
einem einzigen wie zufälligen Bildnis auls höchste ver-
sinnbildlicht erscheinen. Es sind Bürgerfrauen, Mäd-
chen, Kinder, ansprechend oder iiebenswürdig, gestaltet
ohne allzu starke innere Erregung, nur mit dem Grad
freundlicher Teilnahme, soweit das Wesen des Malers
zum Teilnehmen verleitet werden konnte.
Zwei dieser Bildnisse sind bereits abgebildet, auf
der 30. und 3E Tafel in der 2. Auflage des Grönvold-
schen Buches. Doch seien hier zu dem einen, dem Bild-
nis der Frau Carli, noch einige Worte gesagt. Es ist
nämlich allem Anschein nach eins der Bilder, die erst
nach dem Ableben der Dargestellten von den Hinter-
bliebenen in Auftrag gegeben wurden, um das Erinne-
rungsbild festzuhalten, eine Sitte, die dem Künstler ge-
legentlich die Bzeichnung des „Totenmalers“ eingetra-
gen hat. Es zeigt die Merkrnale Abgeschiedener, wie
sie aus Totenmasken bekannt sind: schmal und sclrarf
gewordene Nase und Magerkeit der Nasenflügel, da alle
weicheren Fleischteile eingesunken und die knochigen
und knorpligen Unterlagen deutlich werden. Was beim
Toten gar nicht mehr zu erfassen ist, Mund und Augen,
ist nach freier Erfindung so lebendig wie möglich einge-
setzt. Die Partie um den Mund ist eingefallen, wodurch
die Jochbeine vortreten und das seltsame Totenlächeln
zustande kommt. Mit den Augen ist Wasmann nicht
ganz zurecht gekommen, sie sitzen etwas ungleich im
Kopf, machen den Eindruck eines scheuen, nachdenk-
lichen Blickens. Endlich spricht auch die etwas leere
Schematik der übereinander gelegten Hände und die
Haltung nach eiuem berühmten Vorbild (Mona Lisa) für
ein posthumes Bildnis. Der besondere Wert des Ge-
mäldes beruht aber in der vornehmen träumerischen
Ruhe, mit der die Gestalt vor dem in Blau-grün gehal-
tenen Landschaftshintergrund der Meraner Berge steht.
Unveröffentlicht bisher ist das Bildnis einer jungen
adeligen Dame von nicht unerheblichem Reiz der äuße-
ren Erscheinung, bezeichnet Wasmann 1840, mit einem
Wappen in der linken oberen Ecke (Abb. 1). Nacb
Siebmachers Wappenbuch (Adel von Tirol, 1875) ist es
Abb. 1.
Friedrich Wasmann, Fräulein von Giovanelli von Gerstenberg
das des alten Geschlechts der Giovanelli von Gerstburg,
worin das Schiffchen mit zwei nackten Knaben (Giova-
nelli) und die Aehren (Gerstburg) mit zwei Adlerfeldern
kombiniert worden sind, freilich in unserem Fall weder
mit der gräflichen Neunzackenkrone, noch der freiherr-
lichen mit sieben, sondern der einfachen Adelskrone.
Tracht und Ausdruck des Mädchens entsprechen diesem
bürgerlich gewordenen Landadel. Schlichtes Gewand,
dessen Braun mit dem der Haare harmoniert, mit alt-
fränkischen Puffärmeln, aus dessen weißer, mit großem
Vergnügen gemalter Spitzenkrause das frische jugend-
Jich knappe Antlitz mit seiuen biedermeierisch um die
Ohren gerollten Zöpfen herausschaut. Irn klaren Umriß
des fast von vorn gesehenen Kopfes vermittelt der sanft
geschwellte Zug der vollen Lippen und die groß uncl
wie mit leichter Zerstreutheit auf den Betrachter gerich-
23