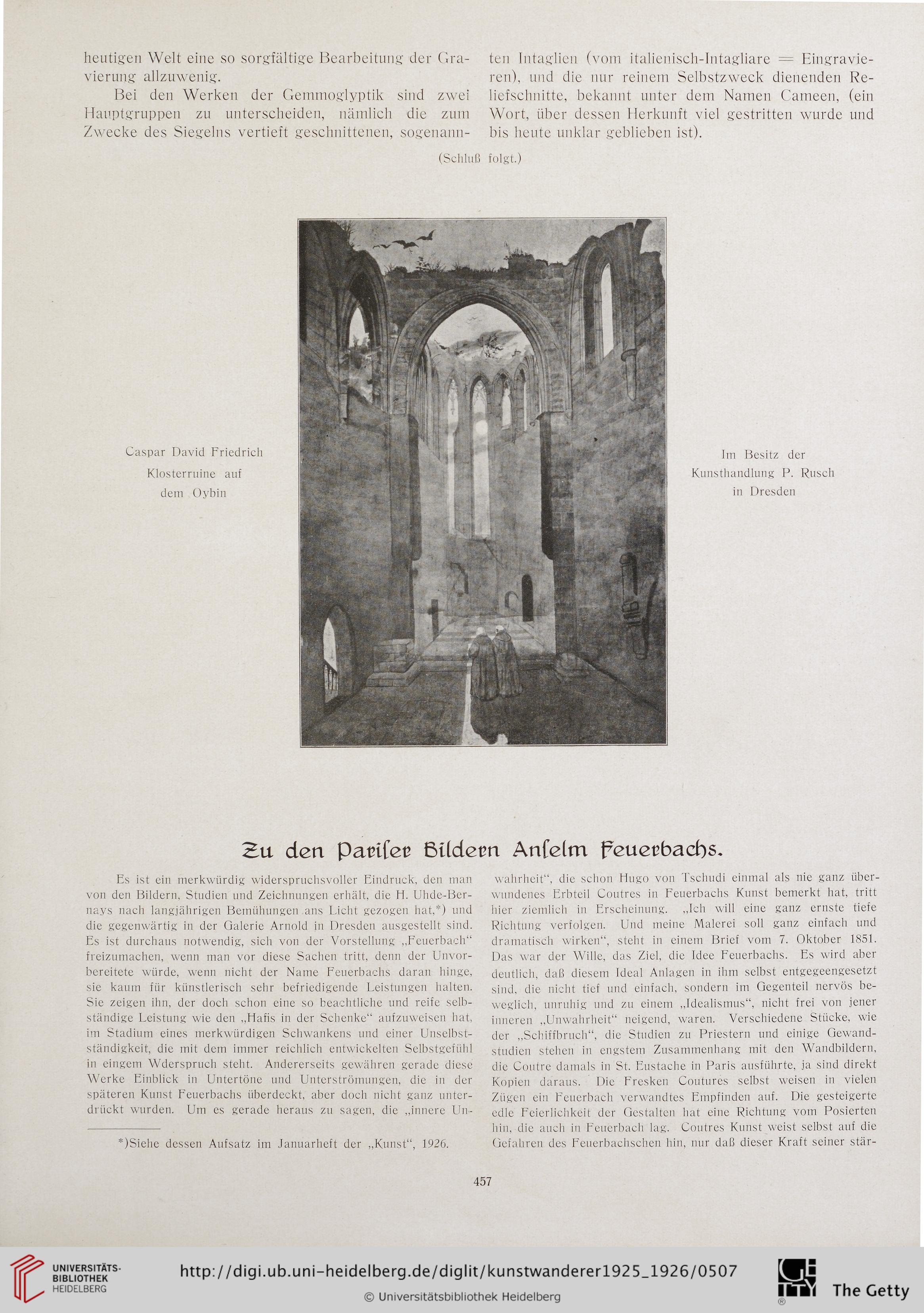heutigen Welt eine so sorgfältige Bearbeitung der Gra-
vierung allzuwenig.
Bei den Werken der Gemmoglyptik sind zwei
Hauptgruppen zu unterscheiden, nämlich die zum
Zwecke des Siegelns vertieft geschnittenen, sogenann-
ten Intaglien (vom italienisch-Intagliare = Eingravie-
ren), und die nur reinem Selbstzweck dienenden Re-
1 iefschnitte, bekannt unter dem Namen Cameen, (ein
Wort, iiber dessen Herkunft viel gestritten wurde und
bis heute unklar geblieben ist).
(Schluß folgt.)
Caspar David Friedrich
Klosterruine auf
dem Oybin
Im Besitz der
Kunsthandlung P. Rusch
in Dresden
Eu dcti Pat’tfet? Btldct’n Anfelm pcuct’bact)s.
Es ist ein merkwürdig widerspruchsvoller Eindruck, den man
von den Bildcrn, Studien und Zeichnungen erhält, dic H. Uhde-Ber-
nays nach langjährigen Bemühungen ans Licht gezogen hat,*) und
die gegenwärtig in der Qalerie Arnold in Dresden ausgestellt sind.
Es ist durchaus notwendig, sich von der Vorstellung „Feuerbach“
freizumachen, wenn man vor diese Sachen tritt, dcnn der Unvor-
bereitete würde, wenn nicht der Name Feuerbachs daran hinge,
sie kaum für künstlerisch sehr befriedigende Leistungen lialten.
Sie zeigen ihn, der doch schon eine so beachtliche und reife selb-
ständige Leistung wie den „Hafis in der Schenke“ aufzuweisen hat,
im Stadium eines merkwürdigen Schwankens und ciner Unsclbst-
ständigkeit, die mit dem immer reichlich entwickelten Selbstgefühl
in eingem Wderspruch steht. Andcrerseits gewähren gerade diese
Werke Einblick in Untertöne und Unterströmungen, die in der
späteren Kunst Feucrbachs überdeckt, aber doch nicht ganz unter-
drückt wurden. Um es geradc heraus zu sagen, die „innerc Un-
*)Siehe dessen Aufsatz im Januarheft der „Kunst“, 1926.
wahrheit“, die schon Hugo von Tschudi einmal als nie ganz tiber-
wundenes Erbteil Coutres in Feuerbachs Kunst bemerkt hat, tritt
hier zicmlich in Erscheinung. „Ich will eine ganz ernste tiefe
Richtung verfolgen. Und meine Malerei soll ganz einfach und
dramatisch wirken“, steht in einem Brief vom 7. Oktober 1851.
Das war der Wille, das Ziel, dic Idee Feuerbachs. Es wird aber
deutlich, daß diesem Ideal Anlagen in ihm selbst entgegeengesetzt
sind, die nicht tief und einfach, sondern im Qegenteil nervös be-
weglich, unruhig und zu einem „Idealismus“, nicht frei von jener
inneren „Unwahrheit“ neigcnd, waren. Verschiedene Stücke, wie
der „Schiffbruch“, die Studien zu Priestern und einige Gewand-
studien stehen in engstem Zusammenhang mit den Wandbildcrn,
dic Coutre damals in St. Eustache in Paris ausführte, ja sind direkt
Kopien daraus. Die Fresken Coutures selbst weisen in vielen
Ziigcn ein Feuerbach verwandtes Empfinden auf. Die gesteigertc
edlc Fcier 1 ichkeit der Gestalten liat cine Richtung voni Posierten
hin, die auch in Feuerbach lag. Coutres Kunst weist selbst auf die
Qefahren des Feuerbachschen hin, nur daß dieser Kraft seiner stär-
457
vierung allzuwenig.
Bei den Werken der Gemmoglyptik sind zwei
Hauptgruppen zu unterscheiden, nämlich die zum
Zwecke des Siegelns vertieft geschnittenen, sogenann-
ten Intaglien (vom italienisch-Intagliare = Eingravie-
ren), und die nur reinem Selbstzweck dienenden Re-
1 iefschnitte, bekannt unter dem Namen Cameen, (ein
Wort, iiber dessen Herkunft viel gestritten wurde und
bis heute unklar geblieben ist).
(Schluß folgt.)
Caspar David Friedrich
Klosterruine auf
dem Oybin
Im Besitz der
Kunsthandlung P. Rusch
in Dresden
Eu dcti Pat’tfet? Btldct’n Anfelm pcuct’bact)s.
Es ist ein merkwürdig widerspruchsvoller Eindruck, den man
von den Bildcrn, Studien und Zeichnungen erhält, dic H. Uhde-Ber-
nays nach langjährigen Bemühungen ans Licht gezogen hat,*) und
die gegenwärtig in der Qalerie Arnold in Dresden ausgestellt sind.
Es ist durchaus notwendig, sich von der Vorstellung „Feuerbach“
freizumachen, wenn man vor diese Sachen tritt, dcnn der Unvor-
bereitete würde, wenn nicht der Name Feuerbachs daran hinge,
sie kaum für künstlerisch sehr befriedigende Leistungen lialten.
Sie zeigen ihn, der doch schon eine so beachtliche und reife selb-
ständige Leistung wie den „Hafis in der Schenke“ aufzuweisen hat,
im Stadium eines merkwürdigen Schwankens und ciner Unsclbst-
ständigkeit, die mit dem immer reichlich entwickelten Selbstgefühl
in eingem Wderspruch steht. Andcrerseits gewähren gerade diese
Werke Einblick in Untertöne und Unterströmungen, die in der
späteren Kunst Feucrbachs überdeckt, aber doch nicht ganz unter-
drückt wurden. Um es geradc heraus zu sagen, die „innerc Un-
*)Siehe dessen Aufsatz im Januarheft der „Kunst“, 1926.
wahrheit“, die schon Hugo von Tschudi einmal als nie ganz tiber-
wundenes Erbteil Coutres in Feuerbachs Kunst bemerkt hat, tritt
hier zicmlich in Erscheinung. „Ich will eine ganz ernste tiefe
Richtung verfolgen. Und meine Malerei soll ganz einfach und
dramatisch wirken“, steht in einem Brief vom 7. Oktober 1851.
Das war der Wille, das Ziel, dic Idee Feuerbachs. Es wird aber
deutlich, daß diesem Ideal Anlagen in ihm selbst entgegeengesetzt
sind, die nicht tief und einfach, sondern im Qegenteil nervös be-
weglich, unruhig und zu einem „Idealismus“, nicht frei von jener
inneren „Unwahrheit“ neigcnd, waren. Verschiedene Stücke, wie
der „Schiffbruch“, die Studien zu Priestern und einige Gewand-
studien stehen in engstem Zusammenhang mit den Wandbildcrn,
dic Coutre damals in St. Eustache in Paris ausführte, ja sind direkt
Kopien daraus. Die Fresken Coutures selbst weisen in vielen
Ziigcn ein Feuerbach verwandtes Empfinden auf. Die gesteigertc
edlc Fcier 1 ichkeit der Gestalten liat cine Richtung voni Posierten
hin, die auch in Feuerbach lag. Coutres Kunst weist selbst auf die
Qefahren des Feuerbachschen hin, nur daß dieser Kraft seiner stär-
457