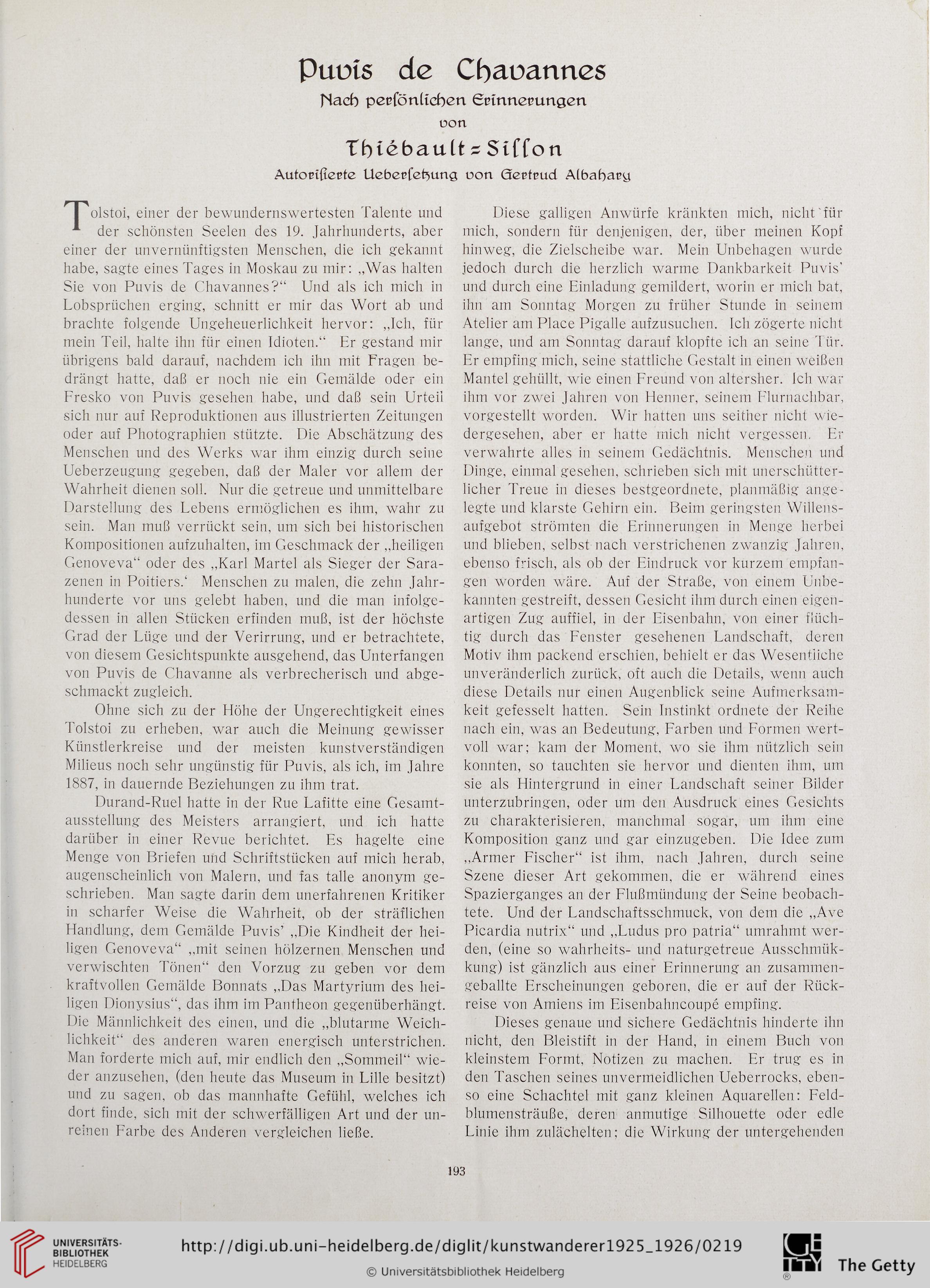Puüts de Cbaoannes
]Sacb pcpfönticben 6t’tnnct’ungen
üon
Tbißbautt s Stffon
Autot’ißet’te Ueberrebung üon Qet?tt?ud Atbabacy
olstoi, einer der bewundernswertesten Talente und
A der schönsten Seelen des 19. Jahrhunderts, aber
einer der unvernünftigsten Menschen, die ich gekannt
habe, sagte eines Tages in Moskau zu mir: „Was halten
Sie von Puvis de Chavannes?“ Und als ich mich in
Lobsprüchen erging, schnitt er mir das Wort ab und
brachte folgende Ungeheuerlichkeit hervor: „Ich, für
mein Teil, halte ihn für einen Idioten.“ Er gestand mir
übrigens bald darauf, nachdem ich ihn mit Fragen be-
drängt hatte, daß er noch nie ein Gemälde oder ein
Fresko von Puvis gesehen habe, und daß sein Urteii
sich nur auf Reproduktionen aus illustrierten Zeitungen
oder auf Photographien stützte. Die Abschätzung des
Menschen und des Werks war ihm einzig durch seine
Ueberzeugung gegeben, daß der Maler vor allem der
Wahrheit dienen soll. Nur die getreue und unmittelbare
Darstellung des Lebens ermöglichen es ihm, wahr zu
sein. Man muß verrückt sein, um sich bei historischen
Kompositionen aufzuhalten, im Geschmack der „heiligen
Genoveva“ oder des „Karl Martel als Sieger der Sara-
zenen in Poitiers? Menschen zu malen, die zehn Jahr-
hunderte vor uns gelebt haben, und die man infolge-
dessen in allen Stücken erfinden muß, ist der höchste
Grad der Lüge und der Verirrung, und er betrachtete,
von diesem Gesichtspunkte ausgehend, das Unterfangen
von Puvis de Chavanne als verbrecherisch und abge-
schmackt zugleich.
Ohne sich zu der Höhe der Ungerechtigkeit eines
Tolstoi zu erheben, war auch die Meinung gewisser
Künstlerkreise und der meisten kunstverständigen
Milieus noch sehr ungünstig für Puvis, als ich, im Jalire
1887, in dauernde Beziehungen zu ihm trat.
Durand-Ruel hatte in der Rue Lafitte eine Gesamt-
ausstellung des Meisters arrangiert, und ich hatte
darüber in einer Revue berichtet. Es hagelte eine
Menge von Briefen uiid Schriftstücken auf mich herab,
augenscheinlich von Malern, und fas talle anonym ge-
schrieben. Man sagte darin dem unerfahrenen Kritiker
in scharfer Weise die Wahrheit, ob der sträflichen
Handlung, dem Gemälde Puvis’ „Die Kindheit der hei-
ligen Genoveva“ „mit seinen hölzernen Menschen und
verwischten Tönen“ den Vorzug zu geben vor dem
kraftvollen Gemälde Bonnats „Das Martyrium des liei-
ligen Dionysius“, das ihm im Pantheon gegenüberhängt.
Die Männlichkeit des einen, und die „blutarme Weich-
lichkeit“ des anderen waren energisch unterstrichen.
Man forderte mich auf, mir endlich den „Sommeil“ wie-
der anzusehen, (den heute das Museum in Lille besitzt)
und zu sagen, ob das mannhafte Gefühl, welches ich
dort finde, sich mit der schwerfälligen Art und der un-
reinen Farbe des Anderen vergleichen ließe.
Diese galligen Anwürfe kränkten mich, nicht'für
mich, sondern für denjenigen, der, über meinen Kopf
hinweg, die Zielscheibe war. Mein Unbehagen wurde
jedoch durch die herzlich warme Dankbarkeit Puvis’
und durch eine Einladung gemildert, worin er mich bat,
ihn am Sonntag Morgen zu früher Stunde in seinem
Atelier am Place Pigalle aufzusuchen. Ich zögerte nicht
lange, und am Sonntag darauf klopfte ich an seine Tür.
Er empfing mich, seine stattliche Gestalt in einen weißen
Mantel gehüllt, wie einen Freund von altersher. Ich war
ihm vor zwei Jahren von Henner, seinem Flurnachbar,
vorgestellt worden. Wir hatten uns seither nicht wie-
dergesehen, aber er hatte rnich nicht vergessen. Er
verwahrte alles in seinem Gedächtnis. Menschen und
Dinge, einmal gesehen, schrieben sich mit unerschütter-
licher Treue in dieses bestgeordnete, planmäßig ange-
legte und klarste Gehirn ein. Beim geringsten Willens-
aufgebot strömten die Erinnerungen in Menge herbei
und blieben, selbst nach verstrichenen zwanzig Jahren,
ebenso frisch, als ob der Eindruck vor kurzem empfan-
gen worden wäre. Auf der Straße, von einem Unbe-
kannten gestreift, dessen Gesicht ihm durch einen eigen-
artigen Zug auffiel, in der Eisenbahn, von einer flüch-
tig durch das Fenster gesehenen Landschaft, deren
Motiv ihm packend erschien, behielt er das Wesentiiche
unveränderlich zurück, oft auch die Details, wenn auch
diese Details nur einen Augenblick seine Aufmerksam-
keit gefesselt hatten. Sein Instinkt ordnete der Reihe
nacli ein, was an Bedeutung, Farben und Eormen wert-
voll war; kam der Moment, wo sie ihm nützlich sein
konnten, so tauchten sie hervor und dienten ihm, um
sie als Hintergrund in einer Landschaft seiner Bilder
unterzubringen, oder um den Ausdruck eines Gesichts
zu charakterisieren, manchmal sogar, um ihm eine
Komposition ganz und gar einzugeben. Die Idee zum
„Armer Fischer“ ist ihm, nach Jahren, durch seine
Szene dieser Art gekommen, die er während eines
Spazierganges an der Flußmündung der Seine beobach-
tete. Und der Landschaftsschmuck, von dem die „Ave
Picardia nutrix“ und „Ludus pro patria“ umrahmt wer-
den, (eine so wahrheits- und naturgetreue Ausschmük-
kung) ist gänzlich aus einer Erinnerung an zusammen-
geballte Erscheinungen geboren, die er auf der Rück-
reise von Amiens im Eisenbahncoupe empfing.
Dieses genaue und sichere Gedächtnis hinderte ihn
nicht, den Bleistift in der Hand, in einem Buch von
kleinstem Formt, Notizen zu machen. Er trug es in
den Taschen seines unvermeidlichen Ueberrocks, eben-
so eine Schachtel mit ganz kleinen Aquarellen: Feld-
blumensträuße, deren anmutige Silliouette oder edle
Linie ihm zulächelten; die Wirkung der untergehenden
193
]Sacb pcpfönticben 6t’tnnct’ungen
üon
Tbißbautt s Stffon
Autot’ißet’te Ueberrebung üon Qet?tt?ud Atbabacy
olstoi, einer der bewundernswertesten Talente und
A der schönsten Seelen des 19. Jahrhunderts, aber
einer der unvernünftigsten Menschen, die ich gekannt
habe, sagte eines Tages in Moskau zu mir: „Was halten
Sie von Puvis de Chavannes?“ Und als ich mich in
Lobsprüchen erging, schnitt er mir das Wort ab und
brachte folgende Ungeheuerlichkeit hervor: „Ich, für
mein Teil, halte ihn für einen Idioten.“ Er gestand mir
übrigens bald darauf, nachdem ich ihn mit Fragen be-
drängt hatte, daß er noch nie ein Gemälde oder ein
Fresko von Puvis gesehen habe, und daß sein Urteii
sich nur auf Reproduktionen aus illustrierten Zeitungen
oder auf Photographien stützte. Die Abschätzung des
Menschen und des Werks war ihm einzig durch seine
Ueberzeugung gegeben, daß der Maler vor allem der
Wahrheit dienen soll. Nur die getreue und unmittelbare
Darstellung des Lebens ermöglichen es ihm, wahr zu
sein. Man muß verrückt sein, um sich bei historischen
Kompositionen aufzuhalten, im Geschmack der „heiligen
Genoveva“ oder des „Karl Martel als Sieger der Sara-
zenen in Poitiers? Menschen zu malen, die zehn Jahr-
hunderte vor uns gelebt haben, und die man infolge-
dessen in allen Stücken erfinden muß, ist der höchste
Grad der Lüge und der Verirrung, und er betrachtete,
von diesem Gesichtspunkte ausgehend, das Unterfangen
von Puvis de Chavanne als verbrecherisch und abge-
schmackt zugleich.
Ohne sich zu der Höhe der Ungerechtigkeit eines
Tolstoi zu erheben, war auch die Meinung gewisser
Künstlerkreise und der meisten kunstverständigen
Milieus noch sehr ungünstig für Puvis, als ich, im Jalire
1887, in dauernde Beziehungen zu ihm trat.
Durand-Ruel hatte in der Rue Lafitte eine Gesamt-
ausstellung des Meisters arrangiert, und ich hatte
darüber in einer Revue berichtet. Es hagelte eine
Menge von Briefen uiid Schriftstücken auf mich herab,
augenscheinlich von Malern, und fas talle anonym ge-
schrieben. Man sagte darin dem unerfahrenen Kritiker
in scharfer Weise die Wahrheit, ob der sträflichen
Handlung, dem Gemälde Puvis’ „Die Kindheit der hei-
ligen Genoveva“ „mit seinen hölzernen Menschen und
verwischten Tönen“ den Vorzug zu geben vor dem
kraftvollen Gemälde Bonnats „Das Martyrium des liei-
ligen Dionysius“, das ihm im Pantheon gegenüberhängt.
Die Männlichkeit des einen, und die „blutarme Weich-
lichkeit“ des anderen waren energisch unterstrichen.
Man forderte mich auf, mir endlich den „Sommeil“ wie-
der anzusehen, (den heute das Museum in Lille besitzt)
und zu sagen, ob das mannhafte Gefühl, welches ich
dort finde, sich mit der schwerfälligen Art und der un-
reinen Farbe des Anderen vergleichen ließe.
Diese galligen Anwürfe kränkten mich, nicht'für
mich, sondern für denjenigen, der, über meinen Kopf
hinweg, die Zielscheibe war. Mein Unbehagen wurde
jedoch durch die herzlich warme Dankbarkeit Puvis’
und durch eine Einladung gemildert, worin er mich bat,
ihn am Sonntag Morgen zu früher Stunde in seinem
Atelier am Place Pigalle aufzusuchen. Ich zögerte nicht
lange, und am Sonntag darauf klopfte ich an seine Tür.
Er empfing mich, seine stattliche Gestalt in einen weißen
Mantel gehüllt, wie einen Freund von altersher. Ich war
ihm vor zwei Jahren von Henner, seinem Flurnachbar,
vorgestellt worden. Wir hatten uns seither nicht wie-
dergesehen, aber er hatte rnich nicht vergessen. Er
verwahrte alles in seinem Gedächtnis. Menschen und
Dinge, einmal gesehen, schrieben sich mit unerschütter-
licher Treue in dieses bestgeordnete, planmäßig ange-
legte und klarste Gehirn ein. Beim geringsten Willens-
aufgebot strömten die Erinnerungen in Menge herbei
und blieben, selbst nach verstrichenen zwanzig Jahren,
ebenso frisch, als ob der Eindruck vor kurzem empfan-
gen worden wäre. Auf der Straße, von einem Unbe-
kannten gestreift, dessen Gesicht ihm durch einen eigen-
artigen Zug auffiel, in der Eisenbahn, von einer flüch-
tig durch das Fenster gesehenen Landschaft, deren
Motiv ihm packend erschien, behielt er das Wesentiiche
unveränderlich zurück, oft auch die Details, wenn auch
diese Details nur einen Augenblick seine Aufmerksam-
keit gefesselt hatten. Sein Instinkt ordnete der Reihe
nacli ein, was an Bedeutung, Farben und Eormen wert-
voll war; kam der Moment, wo sie ihm nützlich sein
konnten, so tauchten sie hervor und dienten ihm, um
sie als Hintergrund in einer Landschaft seiner Bilder
unterzubringen, oder um den Ausdruck eines Gesichts
zu charakterisieren, manchmal sogar, um ihm eine
Komposition ganz und gar einzugeben. Die Idee zum
„Armer Fischer“ ist ihm, nach Jahren, durch seine
Szene dieser Art gekommen, die er während eines
Spazierganges an der Flußmündung der Seine beobach-
tete. Und der Landschaftsschmuck, von dem die „Ave
Picardia nutrix“ und „Ludus pro patria“ umrahmt wer-
den, (eine so wahrheits- und naturgetreue Ausschmük-
kung) ist gänzlich aus einer Erinnerung an zusammen-
geballte Erscheinungen geboren, die er auf der Rück-
reise von Amiens im Eisenbahncoupe empfing.
Dieses genaue und sichere Gedächtnis hinderte ihn
nicht, den Bleistift in der Hand, in einem Buch von
kleinstem Formt, Notizen zu machen. Er trug es in
den Taschen seines unvermeidlichen Ueberrocks, eben-
so eine Schachtel mit ganz kleinen Aquarellen: Feld-
blumensträuße, deren anmutige Silliouette oder edle
Linie ihm zulächelten; die Wirkung der untergehenden
193