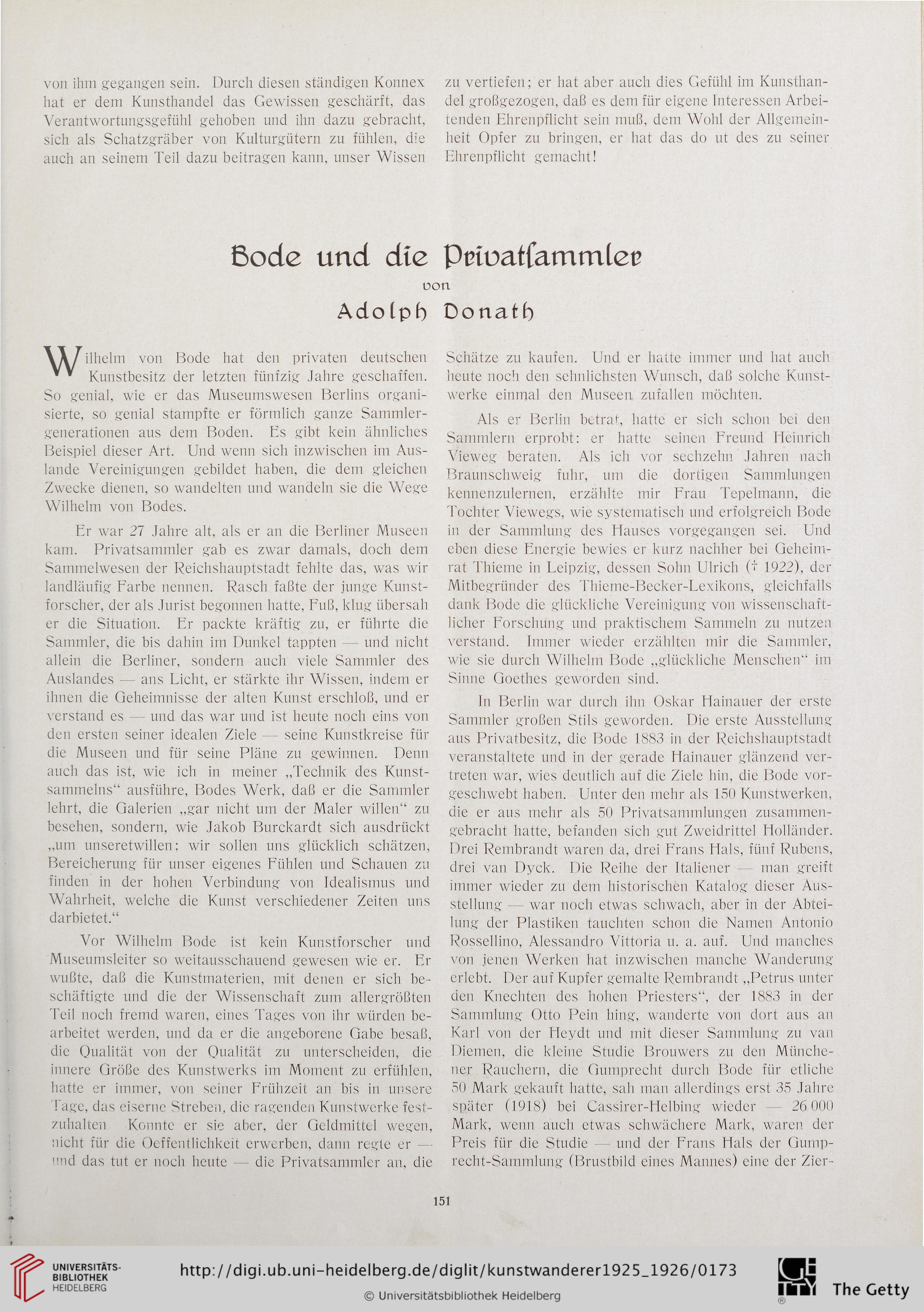von ihm gegangen sein. Durch diesen ständigen Konnex
hat er dem Kunsthandel das Gewissen geschärft, das
Verantwortungsgefühl gehoben und ihn dazu gebracht,
sich als Schatzgräber von Kulturgütern zu fühlen, die
auch an seinem Teil dazu beitragen kann, unser Wissen
zu vertiefen; er hat aber auch dies Gefühl im Kunsthan-
del großgezogen, daß es dem für eigene Interessen Arbei-
tenden Ehrenpflicht sein muß, dem Wohl der Allgemein-
heit Opfer zu bringen, er hat das do ut des zu seiner
Ehrenpflicht gemacht!
ßode und dte Ptnoatfammlet?
oon
Adotpb Donatb
\\/ ilhelm von Bode hat den privaten deutschen
Kunstbesitz der letzten fünfzig Jahre geschaffen.
So genial, wie er das Museumswesen Berlins organi-
sierte, so genial stampfte er förmlich ganze Sammler-
generationen aus dem Boden. Es gibt kein ähnliches
Beispiel dieser Art. Und wenn sicli inzwischen im Aus-
lande Vereinigungen gebildet haben, die dem gleichen
Zwecke dienen, so wandelten und wandeln sie die Wege
Wilhelm von Bodes.
Er war 27 Jahre alt, als er an die Berliner Museen
kam. Privatsammler gab es zwar damals, doch dem
Sammelwesen der Reichshauptstadt fehlte das, was wir
landläufig Farbe nennen. Rasch faßte der junge Kunst-
forscher, der als Jurist begonnen hatte, Fuß, klug übersah
er die Situation. Er packte kräftig zu, er führte die
Sammler, die bis dahin im Dunkel tappten — und nicht
allein die Berliner, sondern auch viele Sammler des
Auslandes — ans Licht, er stärkte ihr Wissen, indem er
ihnen die Geheimnisse der alten Kunst erschloß, und er
verstand es — und das war und ist heute noch eins von
den ersten seiner idealen Ziele — seine Kunstkreise für
die Museen und für seine Pläne zu gewinnen. Denn
auch das ist, wie ich in meiner ,,Technik des Kunst-
sammelns“ ausführe, Bodes Werk, daß er die Sammler
lehrt, die Galerien „gar nicht um der Maler willen“ zu
besehen, sondern, wie Jakob Burckardt sich ausdrückt
„um unseretwillen; wir sollen uns glücklich schätzen,
Bereicherung für unser eigenes Fühlen und Schauen zu
finden in der hohen Verbindung von Idealismus und
Wahrheit, welche die Kunst verschiedener Zeiten uns
darbietet.“
Vor Wilhelm Bode ist kein Kunstforscher und
Museumsleiter so weitausschauend gewesen wie er. Er
wußte, daß die Kunstmaterien, mit denen er sich be-
schäftigte und die der Wissenschaft zum allergrößten
Teil noch fremd waren, eines Tages von ihr würden be-
arbeitet werden, und da er die angeborene Gabe besaß,
dic Qualität von der Qualität zu unterscheiden, die
innere Größe des Kunstwerks im Moment zu crfühlen,
hatte er immer, von sciner Frühzeit an bis in unsere
Tage, das eisernc Streben, dic ragenden Kunstwerke fest-
zuhalten Konntc er sie aber, der Geldmittel wegen,
nicht für die Oeffentlichkeit erwerben, dann regte er -
und das tut er noch heute — die Privatsammler an, die
Schätze zu kaufen. Und er hatte immer und hat auch
heute noch den sehnlichsten Wunsch, daß solche Kunst-
werke einmal den Museen zufallen möchten.
Als er Berlin betrat, hatte er sich schon bei den
Sammlern erprobt: er hatte seinen Freund Ideinrich
Vieweg beraten. Als ich vor sechzehn Jahren nach
Braunschweig fuhr, um die dortigen Sammlungen
kennenzulernen, erzählte mir Frau Tepelmann, die
Tochter Viewegs, wie systematisch und erfolgreich Bode
in der Sammlung des Hauses vorgegangen sei. Und
eben diese Energie bewies er kurz nachher bei Geheim-
rat Thieme in Leipzig, dessen Sohn Ulrich Q 1922), der
Mitbegründer des Thieme-Becker-Lexikons, gleichfalls
dank Tdode die gliickliche Vereinigung von wissenschaft-
licher Forschung und praktischem Sammeln zu nutzen
verstand. Immer wieder erzählten mir die Sammler,
wie sie durch Wilhelm Bode „glückliche Menschen“ im
Sinne Goethes geworden sind.
In Berlin war durch ihn Oskar Hainauer der erste
Sammler großen Stils geworden. Die erste Ausstellung
aus Privatbesitz, die Bode 1883 in der Reichshauptstadt
veranstaltcte und in der gerade Hainauer glänzend ver-
treten war, wies deutlich auf die Ziele hin, die Bode vor-
geschwebt haben. Unter den mehr als 150 Kunstwerken,
aie er aus mehr als 50 Privatsammlungen zusammen-
gebracht hatte, befanden sich gut Zweidrittel Holländer.
Drei Rembrandt waren da, drei Frans Hals, fünf Rubens,
drei van Dyck. Die Reihe der Italiencr - man greift
immer wieder zu dem historischen Katalog dieser Aus-
stellung — war noch etwas schwach, aber in der Abtei-
lung der Plastiken tauchten schon die Namen Antonio
Rossellino, Alessandro Vittoria u. a. auf. Und manches
von jenen Werken hat inzwischen manchc Wanderung
erlebt. Der auf Kupfer gemalte Rembrandt „Petrus unter
den Knechten des hohen Priesters“, der 1883 in der
Sammlung Otto Pein hing, wanderte von dort aus an
Karl von dcr Iieydt und mit dieser Sammlung zu van
Diemen, die kleine Studie Brouwers zu den Münche-
ncr Rauchern, die Gumprecht durch Bode fiir etliche
50 Mark gekauft hattc, sah man allerdings crst 35 Jahre
später (1918) bei Cassirer-Helbing wicder — 26 000
Mark, wcnn auch etwas schwächere Mark, waren der
Preis für die Studie — und der Frans Hals der Gump-
recht-Sammlung (Brustbild eines Mannes) eine der Zier-
151
hat er dem Kunsthandel das Gewissen geschärft, das
Verantwortungsgefühl gehoben und ihn dazu gebracht,
sich als Schatzgräber von Kulturgütern zu fühlen, die
auch an seinem Teil dazu beitragen kann, unser Wissen
zu vertiefen; er hat aber auch dies Gefühl im Kunsthan-
del großgezogen, daß es dem für eigene Interessen Arbei-
tenden Ehrenpflicht sein muß, dem Wohl der Allgemein-
heit Opfer zu bringen, er hat das do ut des zu seiner
Ehrenpflicht gemacht!
ßode und dte Ptnoatfammlet?
oon
Adotpb Donatb
\\/ ilhelm von Bode hat den privaten deutschen
Kunstbesitz der letzten fünfzig Jahre geschaffen.
So genial, wie er das Museumswesen Berlins organi-
sierte, so genial stampfte er förmlich ganze Sammler-
generationen aus dem Boden. Es gibt kein ähnliches
Beispiel dieser Art. Und wenn sicli inzwischen im Aus-
lande Vereinigungen gebildet haben, die dem gleichen
Zwecke dienen, so wandelten und wandeln sie die Wege
Wilhelm von Bodes.
Er war 27 Jahre alt, als er an die Berliner Museen
kam. Privatsammler gab es zwar damals, doch dem
Sammelwesen der Reichshauptstadt fehlte das, was wir
landläufig Farbe nennen. Rasch faßte der junge Kunst-
forscher, der als Jurist begonnen hatte, Fuß, klug übersah
er die Situation. Er packte kräftig zu, er führte die
Sammler, die bis dahin im Dunkel tappten — und nicht
allein die Berliner, sondern auch viele Sammler des
Auslandes — ans Licht, er stärkte ihr Wissen, indem er
ihnen die Geheimnisse der alten Kunst erschloß, und er
verstand es — und das war und ist heute noch eins von
den ersten seiner idealen Ziele — seine Kunstkreise für
die Museen und für seine Pläne zu gewinnen. Denn
auch das ist, wie ich in meiner ,,Technik des Kunst-
sammelns“ ausführe, Bodes Werk, daß er die Sammler
lehrt, die Galerien „gar nicht um der Maler willen“ zu
besehen, sondern, wie Jakob Burckardt sich ausdrückt
„um unseretwillen; wir sollen uns glücklich schätzen,
Bereicherung für unser eigenes Fühlen und Schauen zu
finden in der hohen Verbindung von Idealismus und
Wahrheit, welche die Kunst verschiedener Zeiten uns
darbietet.“
Vor Wilhelm Bode ist kein Kunstforscher und
Museumsleiter so weitausschauend gewesen wie er. Er
wußte, daß die Kunstmaterien, mit denen er sich be-
schäftigte und die der Wissenschaft zum allergrößten
Teil noch fremd waren, eines Tages von ihr würden be-
arbeitet werden, und da er die angeborene Gabe besaß,
dic Qualität von der Qualität zu unterscheiden, die
innere Größe des Kunstwerks im Moment zu crfühlen,
hatte er immer, von sciner Frühzeit an bis in unsere
Tage, das eisernc Streben, dic ragenden Kunstwerke fest-
zuhalten Konntc er sie aber, der Geldmittel wegen,
nicht für die Oeffentlichkeit erwerben, dann regte er -
und das tut er noch heute — die Privatsammler an, die
Schätze zu kaufen. Und er hatte immer und hat auch
heute noch den sehnlichsten Wunsch, daß solche Kunst-
werke einmal den Museen zufallen möchten.
Als er Berlin betrat, hatte er sich schon bei den
Sammlern erprobt: er hatte seinen Freund Ideinrich
Vieweg beraten. Als ich vor sechzehn Jahren nach
Braunschweig fuhr, um die dortigen Sammlungen
kennenzulernen, erzählte mir Frau Tepelmann, die
Tochter Viewegs, wie systematisch und erfolgreich Bode
in der Sammlung des Hauses vorgegangen sei. Und
eben diese Energie bewies er kurz nachher bei Geheim-
rat Thieme in Leipzig, dessen Sohn Ulrich Q 1922), der
Mitbegründer des Thieme-Becker-Lexikons, gleichfalls
dank Tdode die gliickliche Vereinigung von wissenschaft-
licher Forschung und praktischem Sammeln zu nutzen
verstand. Immer wieder erzählten mir die Sammler,
wie sie durch Wilhelm Bode „glückliche Menschen“ im
Sinne Goethes geworden sind.
In Berlin war durch ihn Oskar Hainauer der erste
Sammler großen Stils geworden. Die erste Ausstellung
aus Privatbesitz, die Bode 1883 in der Reichshauptstadt
veranstaltcte und in der gerade Hainauer glänzend ver-
treten war, wies deutlich auf die Ziele hin, die Bode vor-
geschwebt haben. Unter den mehr als 150 Kunstwerken,
aie er aus mehr als 50 Privatsammlungen zusammen-
gebracht hatte, befanden sich gut Zweidrittel Holländer.
Drei Rembrandt waren da, drei Frans Hals, fünf Rubens,
drei van Dyck. Die Reihe der Italiencr - man greift
immer wieder zu dem historischen Katalog dieser Aus-
stellung — war noch etwas schwach, aber in der Abtei-
lung der Plastiken tauchten schon die Namen Antonio
Rossellino, Alessandro Vittoria u. a. auf. Und manches
von jenen Werken hat inzwischen manchc Wanderung
erlebt. Der auf Kupfer gemalte Rembrandt „Petrus unter
den Knechten des hohen Priesters“, der 1883 in der
Sammlung Otto Pein hing, wanderte von dort aus an
Karl von dcr Iieydt und mit dieser Sammlung zu van
Diemen, die kleine Studie Brouwers zu den Münche-
ncr Rauchern, die Gumprecht durch Bode fiir etliche
50 Mark gekauft hattc, sah man allerdings crst 35 Jahre
später (1918) bei Cassirer-Helbing wicder — 26 000
Mark, wcnn auch etwas schwächere Mark, waren der
Preis für die Studie — und der Frans Hals der Gump-
recht-Sammlung (Brustbild eines Mannes) eine der Zier-
151