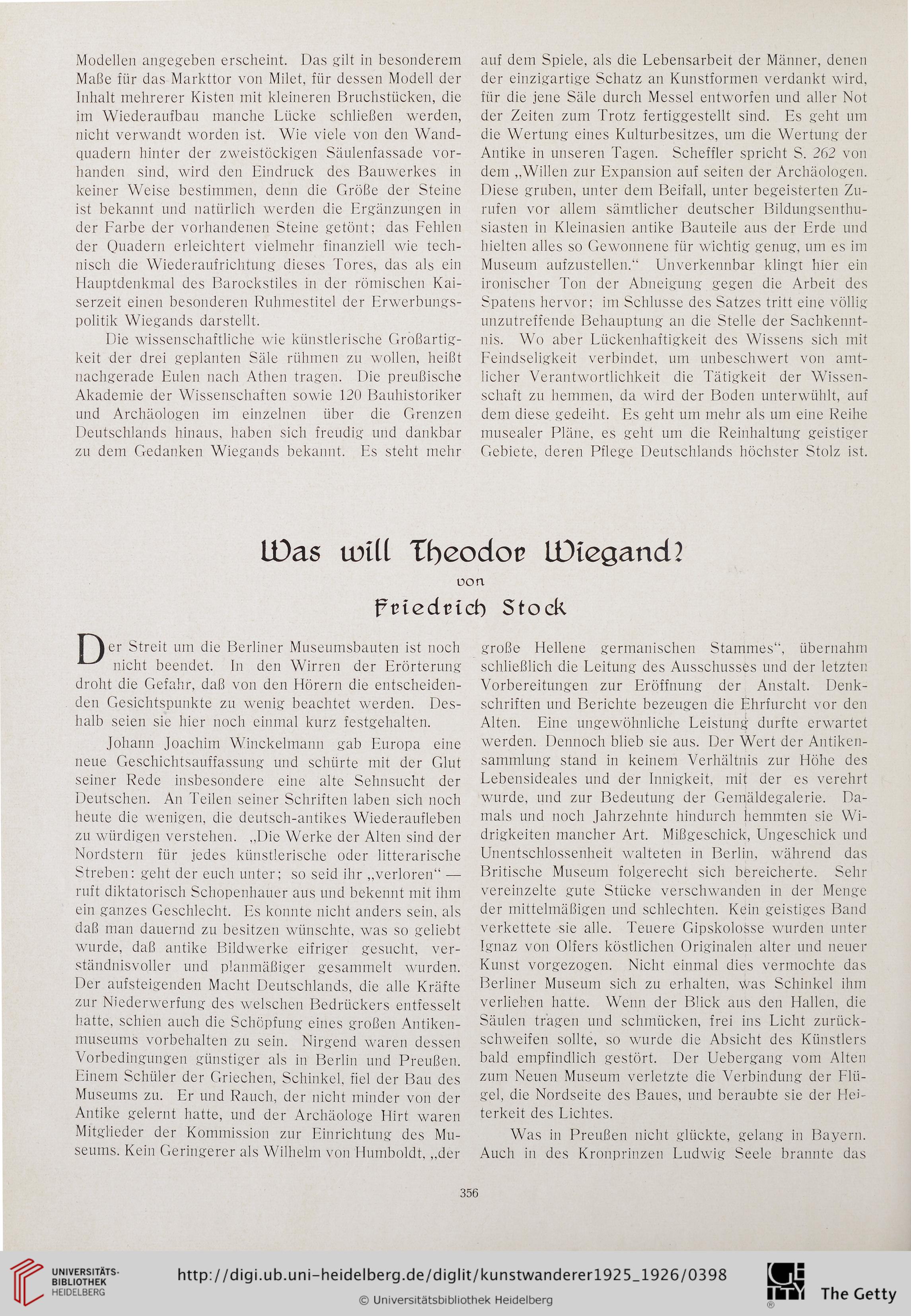Modellen angegeben erscheint. Das gilt in besonderem
Maße für das Markttor von Milet, für dessen Modell der
Inhalt mehrerer Kisten mit kleineren Bruchstücken, die
im Wiederaufbau manche Lücke schließen werden,
nicht verwandt worden ist. Wie viele von den Wand-
quadern hinter der zweistöckigen Säulenfassade vor-
handen sind, wird den Eindruck des Bauwerkes in
keiner Weise bestimmen, denn die Größe der Steine
ist bekannt und natiirlich werden die Ergänzungen in
der Farbe der vorhandenen Steine getönt; das Fehlen
der Qnadern erleichtert viehnehr finanziell wie tech-
nisch die Wiederaufrichtung dieses Tores, das als ein
Hauptdenkmal des Barockstiles in der römischen Kai-
serzeit einen besonderen Rulnnestitel der Erwerbungs-
politik Wiegands darstellt.
Die wissenschaftliche wie künstlerische Großartig-
keit der drei geplanten Säle rühmen zu wollen, heißt
nachgerade Eulen nach Athen tragen. Die preußische
Akademie der Wissenschaften sowie 120 Bauhistoriker
und Archäologen im einzelnen über die Grenzen
Deutschlands hinaus, haben sich freudig und dankbar
zu dem G-edanken Wiegands bekannt. Es steht mehr
auf dem Spiele, als die Lebensarbeit der Männer, denen
der einzigartige Schatz an Kunstformen verdankt wird,
für die jene Säle durch Messel entworfen und aller Not
der Zeiten zum Trotz fertiggestellt sind. Es geht um
die Wertung eines Kulturbesitzes, um die Wertung der
Antike in unseren Tagen. Scheffler spricht S. 262 von
dem „Willen zur Expansion auf seiten der Archäologen.
Diese gruben, unter dem Beifall, unter begeisterten Zu-
rufen vor allem sämtlicher deutscher Bildungsenthu-
siasten in Kleinasien antike Bauteile aus der Erde und
hielten alles so Gewonnene für wichtig genug, um es im
Museum aufzustellen.“ Unverkennbar klingt hier ein
ironischer Ton der Abneigung gegen die Arbeit des
Spatens hervor; im Schlusse des Satzes tritt eine völlig
unzutreffende Behauptung an die Stelle der Sachkennt-
nis. Wo aber Lückenhaftigkeit des Wissens sich mit
Feindseligkeit verbindet, um unbeschwert von amt-
licher Verantwortlichkeit die Tätigkeit der Wissen-
schaft zu hemmen, da wird der Boden unterwühlt, auf
dem diese gedeiht. Es geht um mehr als um eine Reihe
musealer Pläne, es geht um die Reinhaltung geistiger
Gebiete, deren Pflege Deutschlands höchster Stolz ist.
IDas wiil Tbcodot? LÜtegand?
oon
ptHedtucb Stock
ler Streit um die Berliner Museumsbauten ist noch
nicht beendet. In den Wirren der Erörterung
droht die Gefahr, daß von den Hörern die entscheiden-
den Gesichtspunkte zu wenig beachtet werden. Des-
halb seien sie hier noch einmal kurz festgehalten.
Johann Joachim Winckelmann gab Europa eine
neue Geschichtsauffassung und schürte mit der Glut
seiner Rede insbesondere eine alte Sehnsucht der
Deutschen. An Teilen seiner Schriften laben sich noch
heute die wenigen, die deutsch-antikes Wiederaufleben
zu würdigen verstehen. „Die Werke der Alten sind der
Nordstern für jedes künstlerische oder litterarische
Streben: geht der euch unter; so seid ihr „verloren“ —
ruft diktatorisch Schopenhauer aus und bekennt mit ihm
ein ganzes Geschlecht. Es konnte nicht anders sein, als
daß man dauernd zu besitzen wünschte, was so geliebt
wurde, daß antike Bildwerke eifriger gesucht, ver-
ständnisvoller und planmäßiger gesammelt wurden.
Der aufsteigenden Macht Deutschlands, die alle Kräfte
zur Niederwerfung des welschen Bedrückers entfesselt
hatte, schien auch die Schöpfung eines großen Antiken-
museums vorbehalten zu sein. Nirgend waren dessen
Vorbedingungen günstiger als in Berlin und Preußen.
Einem Schüler der Griechen, Schinkel, fiel der Bau des
Museums zu. Er und Rauch, der nicht minder von der
Antike gelernt hatte, und der Archäologe Hirt waren
Mitglieder der Kommission zur Einrichtung des Mu-
seums. Kein Geringerer als Willielm von Humboldt, „der
große Hellene germanischen Stammes“, übernahm
schließlich die Leitung des Ausschusses und der letzten
Vorbereitungen zur Eröffnung der Anstalt. Denk-
schriften und Berichte bezeugen die Ehrfurcht vor den
Alten. Eine ungewöhnliche Leistung durfte erwartet
werden. Dennoch blieb sie aus. Der Wert der Antiken-
sammlung stand in keinem Verhältnis zur Hölie des
Lebensideales und der Innigkeit, mit der es verehrt
wurde, und zur Bedeutung der Gemäldegalerie. Da-
mals und noch Jahrzelmte hindurch hemmten sie Wi-
drigkeiten mancher Art. Mißgeschick, Ungeschick und
Unentschlossenheit walteten in Berlin, während das
Britische Museum folgerecht sich bereicherte. Sehr
vereinzelte gute Stücke verschwanden in der Menge
der mittelmäßigen und schlechten. Kein geistiges Band
verkettete sie alle. Teuere Gipskolosse wurden unter
Ignaz von Olfers köstlichen Originalen alter und neuer
Kunst vorgezogen. Nicht einmal dies vermochte das
Berliner Museum sich zu erhalten, was Schinkel ihm
verliehen hatte. Wenn der Blick aus den Hallen, die
Säulen tragen und schmücken, frei ins Licht zurück-
schweifen sollte, so wurde die Absicht des Künstlers
bald empfindlich gestört. Der Uebergang vom Alten
zum Neuen Museum verletzte die Verbindung der Flii-
gel, die Nordseite des Baues, und beraubte sie der Hei-
terkeit des Lichtes.
Was in Preußen nicht glückte, gelang in Bayern.
Auch in des Kronprinzen Ludwig Seele brannte das
356
Maße für das Markttor von Milet, für dessen Modell der
Inhalt mehrerer Kisten mit kleineren Bruchstücken, die
im Wiederaufbau manche Lücke schließen werden,
nicht verwandt worden ist. Wie viele von den Wand-
quadern hinter der zweistöckigen Säulenfassade vor-
handen sind, wird den Eindruck des Bauwerkes in
keiner Weise bestimmen, denn die Größe der Steine
ist bekannt und natiirlich werden die Ergänzungen in
der Farbe der vorhandenen Steine getönt; das Fehlen
der Qnadern erleichtert viehnehr finanziell wie tech-
nisch die Wiederaufrichtung dieses Tores, das als ein
Hauptdenkmal des Barockstiles in der römischen Kai-
serzeit einen besonderen Rulnnestitel der Erwerbungs-
politik Wiegands darstellt.
Die wissenschaftliche wie künstlerische Großartig-
keit der drei geplanten Säle rühmen zu wollen, heißt
nachgerade Eulen nach Athen tragen. Die preußische
Akademie der Wissenschaften sowie 120 Bauhistoriker
und Archäologen im einzelnen über die Grenzen
Deutschlands hinaus, haben sich freudig und dankbar
zu dem G-edanken Wiegands bekannt. Es steht mehr
auf dem Spiele, als die Lebensarbeit der Männer, denen
der einzigartige Schatz an Kunstformen verdankt wird,
für die jene Säle durch Messel entworfen und aller Not
der Zeiten zum Trotz fertiggestellt sind. Es geht um
die Wertung eines Kulturbesitzes, um die Wertung der
Antike in unseren Tagen. Scheffler spricht S. 262 von
dem „Willen zur Expansion auf seiten der Archäologen.
Diese gruben, unter dem Beifall, unter begeisterten Zu-
rufen vor allem sämtlicher deutscher Bildungsenthu-
siasten in Kleinasien antike Bauteile aus der Erde und
hielten alles so Gewonnene für wichtig genug, um es im
Museum aufzustellen.“ Unverkennbar klingt hier ein
ironischer Ton der Abneigung gegen die Arbeit des
Spatens hervor; im Schlusse des Satzes tritt eine völlig
unzutreffende Behauptung an die Stelle der Sachkennt-
nis. Wo aber Lückenhaftigkeit des Wissens sich mit
Feindseligkeit verbindet, um unbeschwert von amt-
licher Verantwortlichkeit die Tätigkeit der Wissen-
schaft zu hemmen, da wird der Boden unterwühlt, auf
dem diese gedeiht. Es geht um mehr als um eine Reihe
musealer Pläne, es geht um die Reinhaltung geistiger
Gebiete, deren Pflege Deutschlands höchster Stolz ist.
IDas wiil Tbcodot? LÜtegand?
oon
ptHedtucb Stock
ler Streit um die Berliner Museumsbauten ist noch
nicht beendet. In den Wirren der Erörterung
droht die Gefahr, daß von den Hörern die entscheiden-
den Gesichtspunkte zu wenig beachtet werden. Des-
halb seien sie hier noch einmal kurz festgehalten.
Johann Joachim Winckelmann gab Europa eine
neue Geschichtsauffassung und schürte mit der Glut
seiner Rede insbesondere eine alte Sehnsucht der
Deutschen. An Teilen seiner Schriften laben sich noch
heute die wenigen, die deutsch-antikes Wiederaufleben
zu würdigen verstehen. „Die Werke der Alten sind der
Nordstern für jedes künstlerische oder litterarische
Streben: geht der euch unter; so seid ihr „verloren“ —
ruft diktatorisch Schopenhauer aus und bekennt mit ihm
ein ganzes Geschlecht. Es konnte nicht anders sein, als
daß man dauernd zu besitzen wünschte, was so geliebt
wurde, daß antike Bildwerke eifriger gesucht, ver-
ständnisvoller und planmäßiger gesammelt wurden.
Der aufsteigenden Macht Deutschlands, die alle Kräfte
zur Niederwerfung des welschen Bedrückers entfesselt
hatte, schien auch die Schöpfung eines großen Antiken-
museums vorbehalten zu sein. Nirgend waren dessen
Vorbedingungen günstiger als in Berlin und Preußen.
Einem Schüler der Griechen, Schinkel, fiel der Bau des
Museums zu. Er und Rauch, der nicht minder von der
Antike gelernt hatte, und der Archäologe Hirt waren
Mitglieder der Kommission zur Einrichtung des Mu-
seums. Kein Geringerer als Willielm von Humboldt, „der
große Hellene germanischen Stammes“, übernahm
schließlich die Leitung des Ausschusses und der letzten
Vorbereitungen zur Eröffnung der Anstalt. Denk-
schriften und Berichte bezeugen die Ehrfurcht vor den
Alten. Eine ungewöhnliche Leistung durfte erwartet
werden. Dennoch blieb sie aus. Der Wert der Antiken-
sammlung stand in keinem Verhältnis zur Hölie des
Lebensideales und der Innigkeit, mit der es verehrt
wurde, und zur Bedeutung der Gemäldegalerie. Da-
mals und noch Jahrzelmte hindurch hemmten sie Wi-
drigkeiten mancher Art. Mißgeschick, Ungeschick und
Unentschlossenheit walteten in Berlin, während das
Britische Museum folgerecht sich bereicherte. Sehr
vereinzelte gute Stücke verschwanden in der Menge
der mittelmäßigen und schlechten. Kein geistiges Band
verkettete sie alle. Teuere Gipskolosse wurden unter
Ignaz von Olfers köstlichen Originalen alter und neuer
Kunst vorgezogen. Nicht einmal dies vermochte das
Berliner Museum sich zu erhalten, was Schinkel ihm
verliehen hatte. Wenn der Blick aus den Hallen, die
Säulen tragen und schmücken, frei ins Licht zurück-
schweifen sollte, so wurde die Absicht des Künstlers
bald empfindlich gestört. Der Uebergang vom Alten
zum Neuen Museum verletzte die Verbindung der Flii-
gel, die Nordseite des Baues, und beraubte sie der Hei-
terkeit des Lichtes.
Was in Preußen nicht glückte, gelang in Bayern.
Auch in des Kronprinzen Ludwig Seele brannte das
356