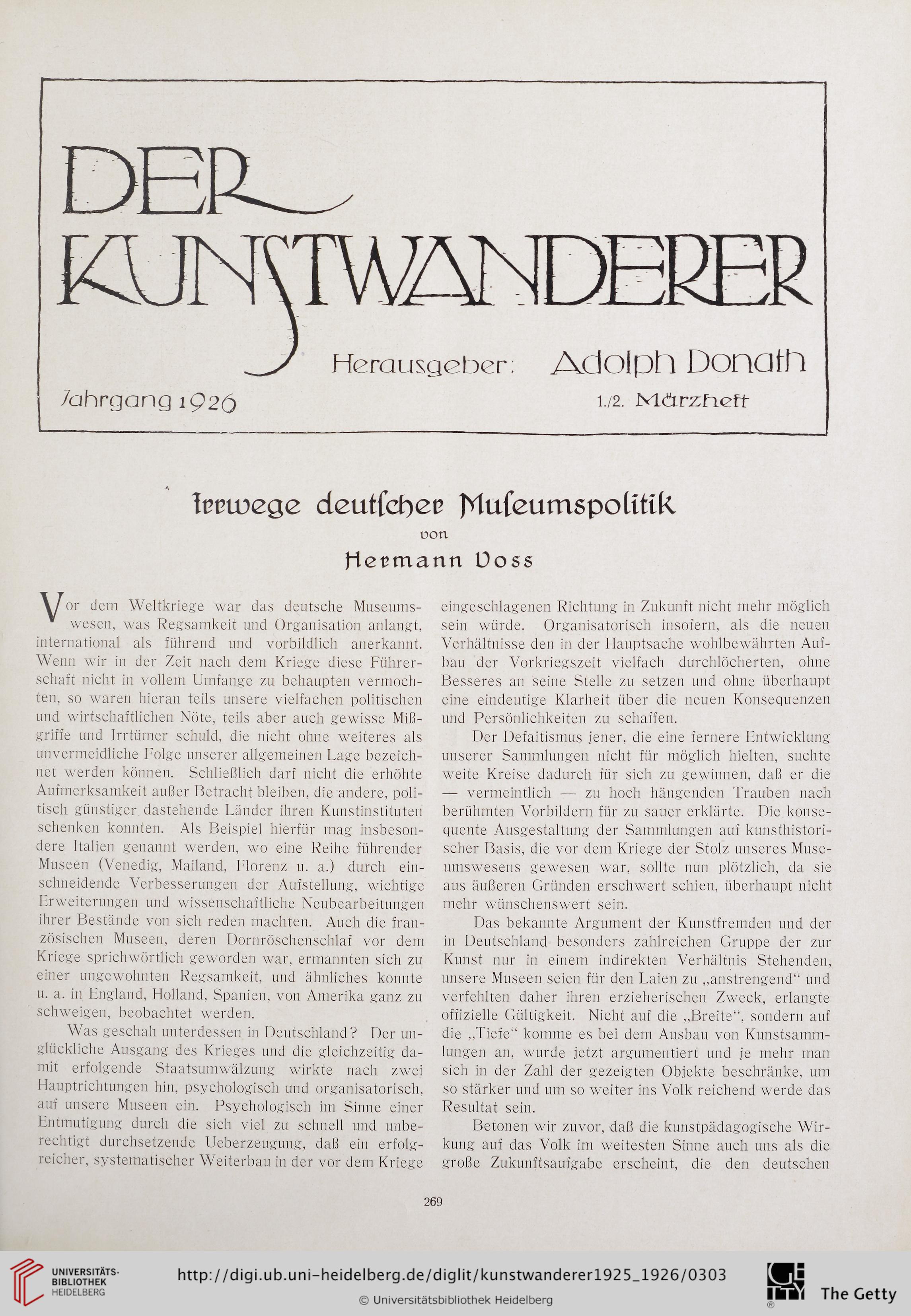Jvüwege deutfcbet? JvlufeumspoUttk
oon
ficümauu Üoss
or dem Weltkriege war das deutsche Museums-
* wesen, was Regsamkeit und Organisation anlangt,
international als führend und vorbildlich anerkannt.
Wenn wir in der Zeit nach dem Kriege diese Führer-
schaft nicht in vollem Umfange zu behaupten vermoch-
ten, so waren hieran teils unsere vielfachen politischen
und wirtschaftlichen Nöte, teils aber auch gewisse Miß-
griffe und Irrtümer schuld, die nicht ohne weiteres als
unvermeidliche Folge unserer allgemeinen Lage bezeich-
net werden können. Schließltch darf nicht die erhöhte
Aufmerksamkeit außer Betracht bleiben, die andere, poli-
tisch günstiger dastehende Länder ihren Kunstinstituten
schenken konnten. Als Beispiel hierfür mag insbeson-
dere Italien genannt werden, wo eine Reihe führender
Museen (Venedig, Mailand, Florenz u. a.) durch ein-
schneidende Verbesserungen der Aufstellung, wichtige
Erweiterungen und wissenschaftliche Neubearbeitungen
ihrer Bestände von sich reden machten. Auch die fran-
zösischen Museen, deren Dornröschenschlaf vor dem
Kriege sprichwörtlich geworden war, ermannten sich zu
einer ungewohnten Regsamkeit, und ähnliches konnte
u. a. in England, Holland, Spanien, von Amerika ganz zu
schweigen, beobachtet werden.
Was geschah unterdessen in Deutschland? Der un-
glückliche Ausgang des Krieges und die gleichzeitig da-
mit erfolgende Staatsumwälzung wirkte nach zwei
Hauptrichtungen hin, psychologisch und organisatorisch,
auf unsere Museen ein. Psychologisch im Sinne einer
Entmutigung durch die sich viel zu schnell und unbe-
rechtigt durchsetzende Ueberzeugung, daß ein erfolg-
reicher, systematischer Weiterbau in der vor dem Kriege
eingeschlagenen Richtung in Zukunft nicht mehr möglich
sein würde. Organisatorisch insofern, als die neuen
Verhältnisse den in der Hauptsache wohlbewährten Auf-
bau der Vorkriegszeit vielfach durchlöcherten, ohne
Besseres an seine Stelle zu setzen und ohne überhaupt
eine eindeutige Klarheit über die neuen Konsequenzen
und Persönlichkeiten zu schaffen.
Der Defaitismus jener, die eine fernere Entwicklung
unserer Sammlungen nicht für möglich hielten, suchte
weite Kreise dadurch für sich zu gewinnen, daß er die
— vermeintlich — zu hoch hängenden Trauben nach
berühmten Vorbildern für zu sauer erklärte. Die konse-
quente Ausgestaltung der Sammlungen auf kunsthistori-
scher Basis, die vor dem Kriege der Stolz unseres Muse-
umswesens gewesen war, sollte nun plötzlich, da sie
aus äußeren Gründen erschwert schien, überhaupt nicht
mehr wünschenswert sein.
Das bekannte Argument der Kunstfremden und der
in Deutschland besonders zahlreicheu Gruppe der zur
Kunst nur in einem indirekten Verhältnis Stehenden,
unsere Museen seien fiir den Laien zu „anstrengend“ und
verfehlten daher ihren erzieherischen Zweck, erlangte
offizielle Gültigkeit. Nicht auf die „Breite“, sondern auf
die „Tiefe“ komme es bei dem Ausbau von Kunstsamm-
lungen an, wurde jetzt argumentiert und je mehr man
sich in der Zahl der gezeigten Objekte beschränke, um
so stärker und um so weiter ins Volk reichend werde das
Resultat sein.
Betonen wir zuvor, daß die kunstpädagogische Wir-
kung auf das Volk im weitesten Sinne auch uns als die
große Zukunftsaufgabe erscheint, die den deutschen
269
oon
ficümauu Üoss
or dem Weltkriege war das deutsche Museums-
* wesen, was Regsamkeit und Organisation anlangt,
international als führend und vorbildlich anerkannt.
Wenn wir in der Zeit nach dem Kriege diese Führer-
schaft nicht in vollem Umfange zu behaupten vermoch-
ten, so waren hieran teils unsere vielfachen politischen
und wirtschaftlichen Nöte, teils aber auch gewisse Miß-
griffe und Irrtümer schuld, die nicht ohne weiteres als
unvermeidliche Folge unserer allgemeinen Lage bezeich-
net werden können. Schließltch darf nicht die erhöhte
Aufmerksamkeit außer Betracht bleiben, die andere, poli-
tisch günstiger dastehende Länder ihren Kunstinstituten
schenken konnten. Als Beispiel hierfür mag insbeson-
dere Italien genannt werden, wo eine Reihe führender
Museen (Venedig, Mailand, Florenz u. a.) durch ein-
schneidende Verbesserungen der Aufstellung, wichtige
Erweiterungen und wissenschaftliche Neubearbeitungen
ihrer Bestände von sich reden machten. Auch die fran-
zösischen Museen, deren Dornröschenschlaf vor dem
Kriege sprichwörtlich geworden war, ermannten sich zu
einer ungewohnten Regsamkeit, und ähnliches konnte
u. a. in England, Holland, Spanien, von Amerika ganz zu
schweigen, beobachtet werden.
Was geschah unterdessen in Deutschland? Der un-
glückliche Ausgang des Krieges und die gleichzeitig da-
mit erfolgende Staatsumwälzung wirkte nach zwei
Hauptrichtungen hin, psychologisch und organisatorisch,
auf unsere Museen ein. Psychologisch im Sinne einer
Entmutigung durch die sich viel zu schnell und unbe-
rechtigt durchsetzende Ueberzeugung, daß ein erfolg-
reicher, systematischer Weiterbau in der vor dem Kriege
eingeschlagenen Richtung in Zukunft nicht mehr möglich
sein würde. Organisatorisch insofern, als die neuen
Verhältnisse den in der Hauptsache wohlbewährten Auf-
bau der Vorkriegszeit vielfach durchlöcherten, ohne
Besseres an seine Stelle zu setzen und ohne überhaupt
eine eindeutige Klarheit über die neuen Konsequenzen
und Persönlichkeiten zu schaffen.
Der Defaitismus jener, die eine fernere Entwicklung
unserer Sammlungen nicht für möglich hielten, suchte
weite Kreise dadurch für sich zu gewinnen, daß er die
— vermeintlich — zu hoch hängenden Trauben nach
berühmten Vorbildern für zu sauer erklärte. Die konse-
quente Ausgestaltung der Sammlungen auf kunsthistori-
scher Basis, die vor dem Kriege der Stolz unseres Muse-
umswesens gewesen war, sollte nun plötzlich, da sie
aus äußeren Gründen erschwert schien, überhaupt nicht
mehr wünschenswert sein.
Das bekannte Argument der Kunstfremden und der
in Deutschland besonders zahlreicheu Gruppe der zur
Kunst nur in einem indirekten Verhältnis Stehenden,
unsere Museen seien fiir den Laien zu „anstrengend“ und
verfehlten daher ihren erzieherischen Zweck, erlangte
offizielle Gültigkeit. Nicht auf die „Breite“, sondern auf
die „Tiefe“ komme es bei dem Ausbau von Kunstsamm-
lungen an, wurde jetzt argumentiert und je mehr man
sich in der Zahl der gezeigten Objekte beschränke, um
so stärker und um so weiter ins Volk reichend werde das
Resultat sein.
Betonen wir zuvor, daß die kunstpädagogische Wir-
kung auf das Volk im weitesten Sinne auch uns als die
große Zukunftsaufgabe erscheint, die den deutschen
269