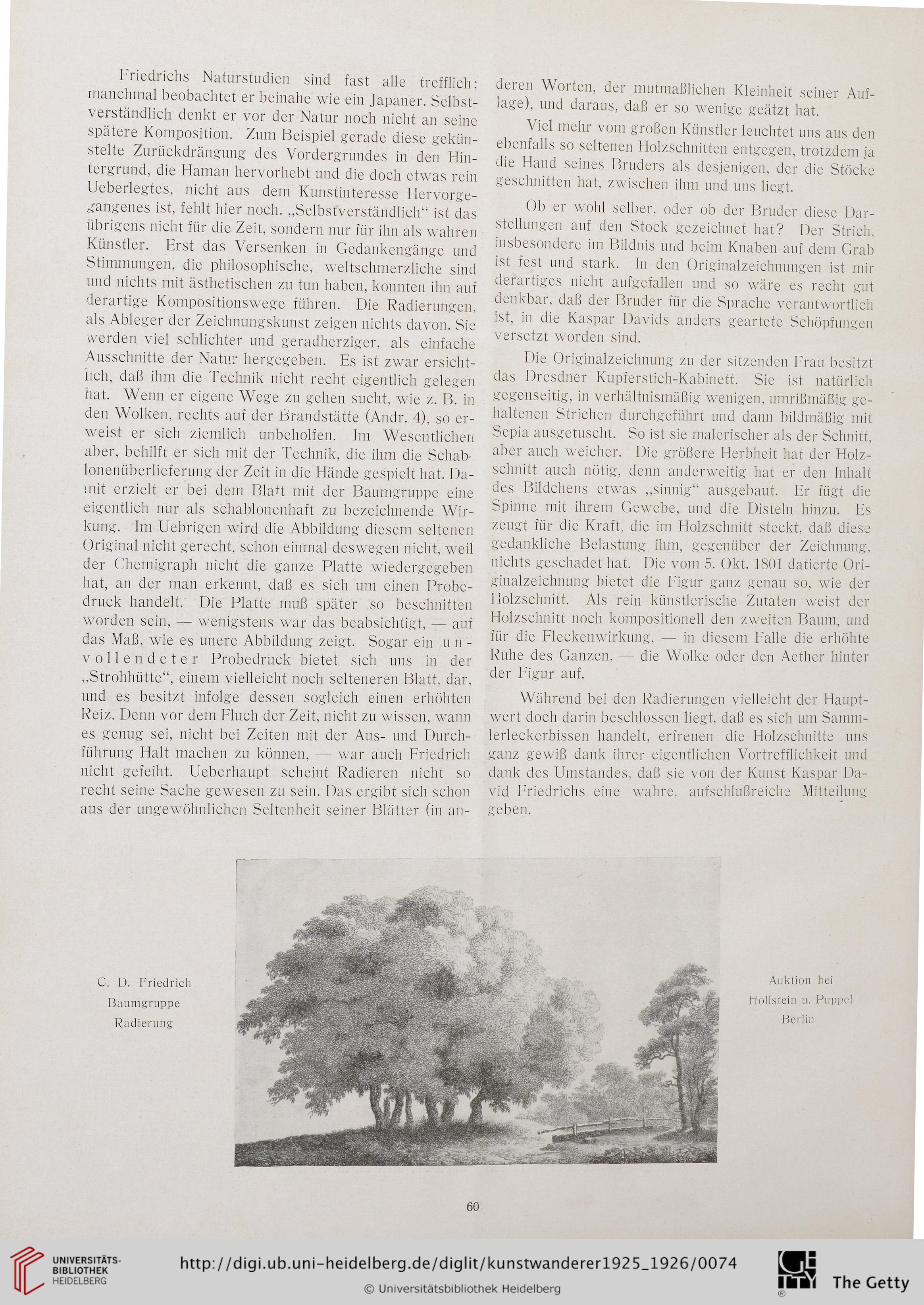Friedrichs Naturstudien sind fast alle trefflich;
rnanchmal beobachtet er beinahe wie ein Japaner. Selbst-
verständlich denkt er vor der Natur noch nicht an seine
spätere Komposition. Zum Beispiel gerade diese gekün-
stelte Zurückdrängung des Vordergrundes in den Flin-
tergrund, die Flaman hervorhebt und die doch etwas rein
Ueberlegtes, nicht aus dem Kunstinteresse Hervorge-
gangenes ist, fehlt liier noch. „Selbst'verständlich“ ist das
übrigens nicht für die Zeit, sondern nur für ihn als wahren
Künstler. Erst das Versenken in Gedankengänge nnd
Stimmungen, die philosophische, weltschmerzliche sind
und nichts mit ästhetischen zu tun haben, konnten ihn auf
derartige Kompositionswege führen. Die Radierungen,
als Ableger der Zeichnungskunst zeigen nichts davon. Sie
werden viel schlichter und geradherziger, als einfache
Ausschnitte der Natur hergegeben. Es ist zwar ersicht-
iich, daß ihm die Technik nicht recht eigentlich gelegen
hat. Wenn er eigene Wege zu gehen sucht, wie z. B. in
den Wolken, rechts auf der Brandstätte (Andr. 4), so er-
weist er sich ziemlich unbeholfen. Im Wesentlichen
aber, behilft er sich mit der Technik, die ihm die Schab-
lonenüberlieferung der Zeit in die Hände gespielt hat. Da-
mit erzielt er bei dem Blatt mit der Baumgruppe eine
eigentlich nur als schablonenhaft zu bezeichnende Wir-
kung. Im Uebrigen wird die Abbildung diesem seltenen
Original nicht gerecht, schon einmal deswegen nicht, weil
der C-hemigraph nicht die ganze Platte wiedergegeben
iiat, an der män erkennt, daß es sich um einen Probe-
druck handelt. Die Platte muß später so beschnitten
worden sein, — wenigstens war das beabsichtigt, — auf
das Maß, wie es unere Abbildung zeigt. Sogar ein u n -
v o 11 e n d e t e r Probedruck bietet sicli uns in der
„Strohhütte“, einem vielleicht noch selteneren Blatt, dar,
und es besitzt infolge dessen sogleich einen erhöhten
Reiz. Denn vor dem Fluch der Zeit, nicht zu wissen, wann
es genug sei, nicht bei Zeiten mit der Aus- und Durch-
führung Halt machen zu können, — war auch Friedrich
nicht gefeiht. Ueberhaupt scheint Radieren nicht so
recht seine Sache gewesen zu sein. Das ergibt sich schon
aus der ungewöhnlichen Seltenheit seiner Blätter (in an-
deren Worten, der mutmaßlichen Kleinheit seiner Auf-
lage), und daraus, daß er so wenige geätzt hat.
Viel mehr vom großen Künstler leuchtet uns aus den
ebenfalls so seltenen Holzschnitten entgegen, trotzdem ja
die Hand seines Bruders als desjenigen, der die Stöcke
geschnitten hat, zwischen ihm und uns liegt.
Ob er wohl selber, oder ob der Bruder diese Dar-
stellungen auf den Stock gezeichnet hat? Der Strich,
insbesondere im Bildnis und beim Knaben auf dem Grab
ist fest und stark. In den Originalzeichnungen ist mir
derartiges nicht aufgefallen und so wäre es recht gut
denkbar, daß der Bruder für die Sprache verantwortlich
ist, in die Kaspar Davids anders geartete Schöpfungen
versetzt worden sind.
Die Originalzeichnung zu der sitzenden Frau besitzt
das Dresdner Kupferstich-Kabinett. Sie ist natürlich
gegenseitig, in verhältnismäßig wenigen, umrißmäßig ge-
haltenen Strichen durchgeführt und dann bildmäßig mit
Sepia ausgetuscht. So ist sie malerischer als der Schnitt,
aber auch weicher. Die größere Herbheit hat der Holz-
schnitt auch nötig, denn anderweitig hat er den Inhalt
des Bildchens etwas „sinnig“ ausgebaut. Er fügt die
Spinne mit ihrem Gewebe, und die Disteln hinzu. Es
zeugt für die Kraft, die im Holzschnitt steckt, daß diese
gedankliche Belastung ihm, gegenüber der Zeichnung,
nichts geschadet hat. Die vom 5. Okt. 1801 datierte Ori-
ginalzeichnung bietet die Figur ganz genau so, wie der
Holzschnitt. Als rein künstlerische Zutaten weist der
Holzschnitt noch kompositionell den zweiten Baum, und
für die Fleckenwirkung, — in diesem Falle die erhöhte
Ruhe des Ganzen, — die Wolke oder den Aether hinter
der Figur auf.
Während bei den Radierungen vielleicht der Haupt-
wert doch darin beschlossen liegt, daß es sich um Samm-
lerleckerbissen handelt, erfreuen die Holzschnitte uns
ganz gewiß dank ihrer eigentlichen Vortrefflichkeit und
dank des Umstandes, daß sie von der Kunst Kaspar Da-
vid Friedrichs eine wahre, aufschlußreiche Mitteilung
geben.
C. D. Friedrich
Baumgruppe
Radierung
Auktion bei
Hollstein u. Puppcl
Berlin
60
rnanchmal beobachtet er beinahe wie ein Japaner. Selbst-
verständlich denkt er vor der Natur noch nicht an seine
spätere Komposition. Zum Beispiel gerade diese gekün-
stelte Zurückdrängung des Vordergrundes in den Flin-
tergrund, die Flaman hervorhebt und die doch etwas rein
Ueberlegtes, nicht aus dem Kunstinteresse Hervorge-
gangenes ist, fehlt liier noch. „Selbst'verständlich“ ist das
übrigens nicht für die Zeit, sondern nur für ihn als wahren
Künstler. Erst das Versenken in Gedankengänge nnd
Stimmungen, die philosophische, weltschmerzliche sind
und nichts mit ästhetischen zu tun haben, konnten ihn auf
derartige Kompositionswege führen. Die Radierungen,
als Ableger der Zeichnungskunst zeigen nichts davon. Sie
werden viel schlichter und geradherziger, als einfache
Ausschnitte der Natur hergegeben. Es ist zwar ersicht-
iich, daß ihm die Technik nicht recht eigentlich gelegen
hat. Wenn er eigene Wege zu gehen sucht, wie z. B. in
den Wolken, rechts auf der Brandstätte (Andr. 4), so er-
weist er sich ziemlich unbeholfen. Im Wesentlichen
aber, behilft er sich mit der Technik, die ihm die Schab-
lonenüberlieferung der Zeit in die Hände gespielt hat. Da-
mit erzielt er bei dem Blatt mit der Baumgruppe eine
eigentlich nur als schablonenhaft zu bezeichnende Wir-
kung. Im Uebrigen wird die Abbildung diesem seltenen
Original nicht gerecht, schon einmal deswegen nicht, weil
der C-hemigraph nicht die ganze Platte wiedergegeben
iiat, an der män erkennt, daß es sich um einen Probe-
druck handelt. Die Platte muß später so beschnitten
worden sein, — wenigstens war das beabsichtigt, — auf
das Maß, wie es unere Abbildung zeigt. Sogar ein u n -
v o 11 e n d e t e r Probedruck bietet sicli uns in der
„Strohhütte“, einem vielleicht noch selteneren Blatt, dar,
und es besitzt infolge dessen sogleich einen erhöhten
Reiz. Denn vor dem Fluch der Zeit, nicht zu wissen, wann
es genug sei, nicht bei Zeiten mit der Aus- und Durch-
führung Halt machen zu können, — war auch Friedrich
nicht gefeiht. Ueberhaupt scheint Radieren nicht so
recht seine Sache gewesen zu sein. Das ergibt sich schon
aus der ungewöhnlichen Seltenheit seiner Blätter (in an-
deren Worten, der mutmaßlichen Kleinheit seiner Auf-
lage), und daraus, daß er so wenige geätzt hat.
Viel mehr vom großen Künstler leuchtet uns aus den
ebenfalls so seltenen Holzschnitten entgegen, trotzdem ja
die Hand seines Bruders als desjenigen, der die Stöcke
geschnitten hat, zwischen ihm und uns liegt.
Ob er wohl selber, oder ob der Bruder diese Dar-
stellungen auf den Stock gezeichnet hat? Der Strich,
insbesondere im Bildnis und beim Knaben auf dem Grab
ist fest und stark. In den Originalzeichnungen ist mir
derartiges nicht aufgefallen und so wäre es recht gut
denkbar, daß der Bruder für die Sprache verantwortlich
ist, in die Kaspar Davids anders geartete Schöpfungen
versetzt worden sind.
Die Originalzeichnung zu der sitzenden Frau besitzt
das Dresdner Kupferstich-Kabinett. Sie ist natürlich
gegenseitig, in verhältnismäßig wenigen, umrißmäßig ge-
haltenen Strichen durchgeführt und dann bildmäßig mit
Sepia ausgetuscht. So ist sie malerischer als der Schnitt,
aber auch weicher. Die größere Herbheit hat der Holz-
schnitt auch nötig, denn anderweitig hat er den Inhalt
des Bildchens etwas „sinnig“ ausgebaut. Er fügt die
Spinne mit ihrem Gewebe, und die Disteln hinzu. Es
zeugt für die Kraft, die im Holzschnitt steckt, daß diese
gedankliche Belastung ihm, gegenüber der Zeichnung,
nichts geschadet hat. Die vom 5. Okt. 1801 datierte Ori-
ginalzeichnung bietet die Figur ganz genau so, wie der
Holzschnitt. Als rein künstlerische Zutaten weist der
Holzschnitt noch kompositionell den zweiten Baum, und
für die Fleckenwirkung, — in diesem Falle die erhöhte
Ruhe des Ganzen, — die Wolke oder den Aether hinter
der Figur auf.
Während bei den Radierungen vielleicht der Haupt-
wert doch darin beschlossen liegt, daß es sich um Samm-
lerleckerbissen handelt, erfreuen die Holzschnitte uns
ganz gewiß dank ihrer eigentlichen Vortrefflichkeit und
dank des Umstandes, daß sie von der Kunst Kaspar Da-
vid Friedrichs eine wahre, aufschlußreiche Mitteilung
geben.
C. D. Friedrich
Baumgruppe
Radierung
Auktion bei
Hollstein u. Puppcl
Berlin
60