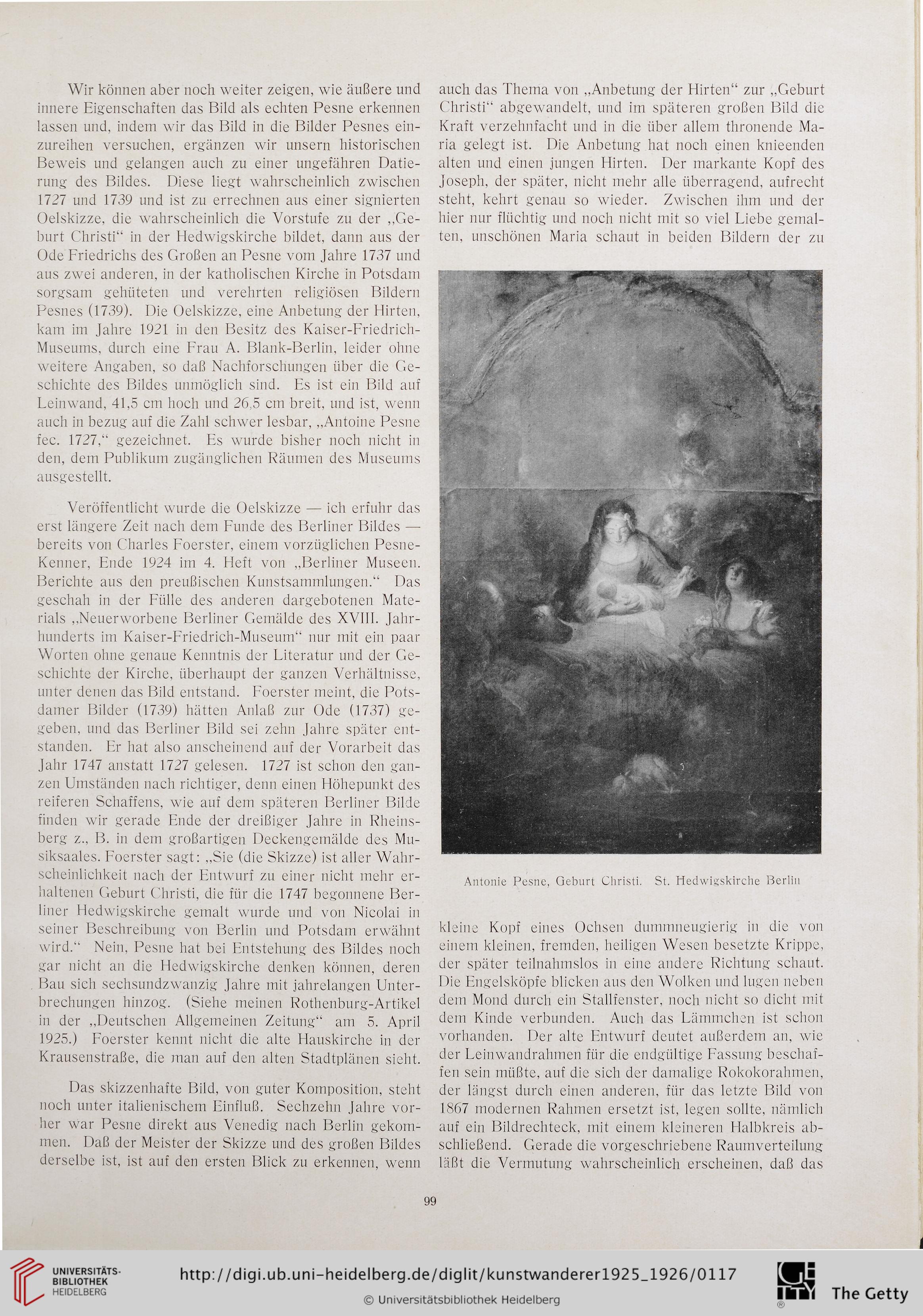Wir können aber noch weiter zeigen, wie äußere und
innere Eigenschaften das Bild als echten Pesne erkennen
lassen und, indem wir das Bild in die Bilder Pesnes ein-
zureihen versuchen, ergänzen wir unsern historischen
Beweis und gelangen auch zu einer ungefähren Datie-
rung des Bildes. Diese liegt wahrscheinlich zwischen
1727 und 1739 und ist zu errechnen aus einer signierten
Oelskizze, die wahrscheinlich die Vorstufe zu der ,,Ge-
burt Christi“ in der Hedwigskirche bildet, dann aus der
Ode Friedrichs des Großen an Pesne vom Jahre 1737 und
aus zwei anderen, in der katholischen Kirche in Potsdam
sorgsam gehüteten und verehrten religiösen Bildern
Pesnes (1739). Die Oelskizze, eine Anbetung der Hirten,
kam im Jahre 1921 in den Besitz des Kaiser-Friedrich-
Museums, durch eine Frau A. Blank-Berlin, leider ohne
weitere Angaben, so daß Nachforschungen über die Ge-
schichte des Bildes unmöglich sind. Es ist ein Bild auf
Feinwand, 41,5 cm hoch und 26,5 cm breit, und ist, wenn
auch in bezug auf die Zahl schwer lesbar, „Antoine Pesne
fec. 1727,“ gezeichnet. Es wurde bisher noch nicht in
den, dem Publikum zugänglichen Räumen des Museums
ausgestellt.
Veröffentlicht wurde die Oelskizze — ich erfuhr das
erst längere Zeit nach dem Funde des Berliner Bildes —
bereits von Charles Foerster, einem vorzüglichen Pesne-
Kenner, Ende 1924 im 4. Heft von „Berliner Museen.
Berichte aus den preußischen Kunstsammlungen.“ Das
geschah in der Fülle des anderen dargebotenen Mate-
rials „Neuerworbene Berliner Gemälde des XVIII. Jahr-
hunderts im Kaiser-Friedrich-Museum“ nur mit ein paar
Worten ohne genaue Kenntnis der Fiteratur und der Ge-
schichte der Kirche, überhaupt der ganzen Verhältnisse,
unter denen das Bild entstand. Foerster meint, die Pots-
damer Bilder (1739) hätten Anlaß zur Ode (1737) ge-
geben, und das Berliner Bild sei zehn Jahre später ent-
standen. Fr hat also anscheinend auf der Vorarbeit das
Jahr 1747 anstatt 1727 gelesen. 1727 ist schon den gan-
zen Umständen nach richtiger, denn einen Höhepunkt des
reiferen Schaffens, wie auf dem späteren Berliner Bilde
finden wir gerade Ende der dreißiger Jahre in Rheins-
berg z„ B. in dem großartigen Deckengemälde des Mu-
siksaales. Foerster sagt: „Sie (die Skizze) ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Entwurf zu einer nicht mehr er-
haltenen Geburt Christi, die für die 1747 begonnene Ber-
liner Hedwigskirche gemalt wurde und von Nicolai in
seiner Beschreibung von Berlin und Potsdam erwähnt
wird.“ Nein, Pesne hat bei Entstehung des Bildes noch
gar nicht an die Hedwigskirche denken können, deren
Bau sich sechsundzwanzig Jahre mit jahrelangen Unter-
brechungen hinzog. (Siehe meinen Rothenburg-Artikel
in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ am 5. April
1925.) Foerster kennt nicht die alte Hauskirche in der
Krausenstraße, die man auf den alten Stadtplänen sieht.
Das skizzenhafte Bild, von guter Komposition, steht
noch unter italienischem Einfluß. Sechzehn Jahre vor-
her war Pesne direkt aus Venedig nach Berlin gekom-
men. Daß der Meister der Skizze und des großen Bildes
derselbe ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen, wenn
auch das Thema von „Anbetung der Hirten“ zur „Geburt
Christi“ abgewandelt, und im späteren großen Bild die
Kraft verzehnfacht und in die über allem thronende Ma-
ria gelegt ist. Die Anbetung hat noch einen knieenden
alten und einen jungen Hirten. Der markante Kopf des
Joseph, der später, nicht mehr alle überragend, aufrecht
steht, kehrt genau so wieder. Zwischen ihm und der
hier nur flüchtig und noch nicht mit so viel Liebe gemal-
ten, unschönen Maria schaut in beiden Bildern der zu
Antonie Pesne, Geburt Christi. St. Hedwigskirche Berlin
kleine Kopf eines Ochsen dummneugierig in die von
einem kleinen, fremden, heiligen Wesen besetzte Krippe,
der später teilnahmslos in eine andere Richtung schaut.
Die Fngelsköpfe blicken aus den Wolken und lugen neben
dem Mond durch ein Stallfenster, noch nicht so dicht mit
dem Kinde verbunden. Auch das Lämmchen ist schon
vorhanden. Der alte Entwurf deutet außerdem an, wie
der Leinwandrahmen für die endgültige Fassung beschaf-
fen sein müßte, auf die sich der damalige Rokokorahmen,
der längst durch einen anderen, für das letzte Bild von
1867 modernen Rahmen ersetzt ist, legen sollte, nämlich
auf ein Bildrechteck, mit einem kleineren Halbkreis ab-
schließend. Gerade die vorgeschriebene Raumverteilung
läßt die Vennutung wahrscheinlich erscheinen, daß das
99
innere Eigenschaften das Bild als echten Pesne erkennen
lassen und, indem wir das Bild in die Bilder Pesnes ein-
zureihen versuchen, ergänzen wir unsern historischen
Beweis und gelangen auch zu einer ungefähren Datie-
rung des Bildes. Diese liegt wahrscheinlich zwischen
1727 und 1739 und ist zu errechnen aus einer signierten
Oelskizze, die wahrscheinlich die Vorstufe zu der ,,Ge-
burt Christi“ in der Hedwigskirche bildet, dann aus der
Ode Friedrichs des Großen an Pesne vom Jahre 1737 und
aus zwei anderen, in der katholischen Kirche in Potsdam
sorgsam gehüteten und verehrten religiösen Bildern
Pesnes (1739). Die Oelskizze, eine Anbetung der Hirten,
kam im Jahre 1921 in den Besitz des Kaiser-Friedrich-
Museums, durch eine Frau A. Blank-Berlin, leider ohne
weitere Angaben, so daß Nachforschungen über die Ge-
schichte des Bildes unmöglich sind. Es ist ein Bild auf
Feinwand, 41,5 cm hoch und 26,5 cm breit, und ist, wenn
auch in bezug auf die Zahl schwer lesbar, „Antoine Pesne
fec. 1727,“ gezeichnet. Es wurde bisher noch nicht in
den, dem Publikum zugänglichen Räumen des Museums
ausgestellt.
Veröffentlicht wurde die Oelskizze — ich erfuhr das
erst längere Zeit nach dem Funde des Berliner Bildes —
bereits von Charles Foerster, einem vorzüglichen Pesne-
Kenner, Ende 1924 im 4. Heft von „Berliner Museen.
Berichte aus den preußischen Kunstsammlungen.“ Das
geschah in der Fülle des anderen dargebotenen Mate-
rials „Neuerworbene Berliner Gemälde des XVIII. Jahr-
hunderts im Kaiser-Friedrich-Museum“ nur mit ein paar
Worten ohne genaue Kenntnis der Fiteratur und der Ge-
schichte der Kirche, überhaupt der ganzen Verhältnisse,
unter denen das Bild entstand. Foerster meint, die Pots-
damer Bilder (1739) hätten Anlaß zur Ode (1737) ge-
geben, und das Berliner Bild sei zehn Jahre später ent-
standen. Fr hat also anscheinend auf der Vorarbeit das
Jahr 1747 anstatt 1727 gelesen. 1727 ist schon den gan-
zen Umständen nach richtiger, denn einen Höhepunkt des
reiferen Schaffens, wie auf dem späteren Berliner Bilde
finden wir gerade Ende der dreißiger Jahre in Rheins-
berg z„ B. in dem großartigen Deckengemälde des Mu-
siksaales. Foerster sagt: „Sie (die Skizze) ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Entwurf zu einer nicht mehr er-
haltenen Geburt Christi, die für die 1747 begonnene Ber-
liner Hedwigskirche gemalt wurde und von Nicolai in
seiner Beschreibung von Berlin und Potsdam erwähnt
wird.“ Nein, Pesne hat bei Entstehung des Bildes noch
gar nicht an die Hedwigskirche denken können, deren
Bau sich sechsundzwanzig Jahre mit jahrelangen Unter-
brechungen hinzog. (Siehe meinen Rothenburg-Artikel
in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ am 5. April
1925.) Foerster kennt nicht die alte Hauskirche in der
Krausenstraße, die man auf den alten Stadtplänen sieht.
Das skizzenhafte Bild, von guter Komposition, steht
noch unter italienischem Einfluß. Sechzehn Jahre vor-
her war Pesne direkt aus Venedig nach Berlin gekom-
men. Daß der Meister der Skizze und des großen Bildes
derselbe ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen, wenn
auch das Thema von „Anbetung der Hirten“ zur „Geburt
Christi“ abgewandelt, und im späteren großen Bild die
Kraft verzehnfacht und in die über allem thronende Ma-
ria gelegt ist. Die Anbetung hat noch einen knieenden
alten und einen jungen Hirten. Der markante Kopf des
Joseph, der später, nicht mehr alle überragend, aufrecht
steht, kehrt genau so wieder. Zwischen ihm und der
hier nur flüchtig und noch nicht mit so viel Liebe gemal-
ten, unschönen Maria schaut in beiden Bildern der zu
Antonie Pesne, Geburt Christi. St. Hedwigskirche Berlin
kleine Kopf eines Ochsen dummneugierig in die von
einem kleinen, fremden, heiligen Wesen besetzte Krippe,
der später teilnahmslos in eine andere Richtung schaut.
Die Fngelsköpfe blicken aus den Wolken und lugen neben
dem Mond durch ein Stallfenster, noch nicht so dicht mit
dem Kinde verbunden. Auch das Lämmchen ist schon
vorhanden. Der alte Entwurf deutet außerdem an, wie
der Leinwandrahmen für die endgültige Fassung beschaf-
fen sein müßte, auf die sich der damalige Rokokorahmen,
der längst durch einen anderen, für das letzte Bild von
1867 modernen Rahmen ersetzt ist, legen sollte, nämlich
auf ein Bildrechteck, mit einem kleineren Halbkreis ab-
schließend. Gerade die vorgeschriebene Raumverteilung
läßt die Vennutung wahrscheinlich erscheinen, daß das
99