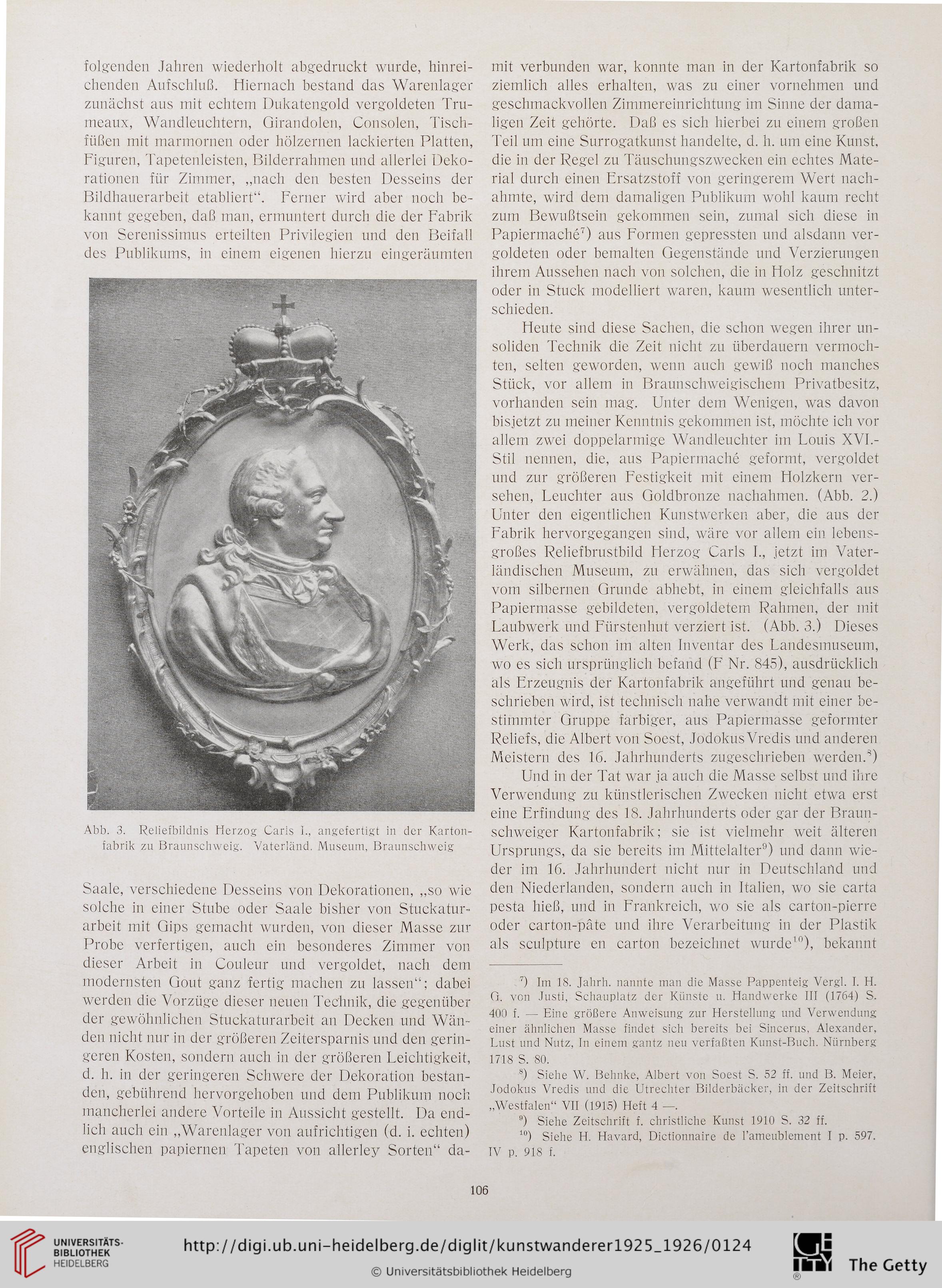folgenden Jahren wiederholt abg'edruckt wurde, hinrei-
chenden Aufschluß. Hiernach bestand das Warenlager
zunächst aus mit echtem Dukatengold vergoldeten Tru-
meaux, Wandleuchtern, Girandolen, Consolen, Tisch-
füßen mit marmornen oder hölzernen lackierten Platten,
Figuren, Tapetenleisten, Bilderrahmen und allerlei üeko-
rationen fiir Zimmer, ,,nach den besten Desseins der
Bildhauerarbeit etabliert“. Ferner wird aber noch be-
kannt gegeben, daß man, ermuntert durch die der Fabrik
von Serenissimus erteilten Privilegien und den Beifall
des Publikums, in einem eigenen hierzu eingeräumten
Abb. 3. Reliefbildnis Herzog Caris 1., angefertigt in der Karton-
fabrik zu Braunschweig. Vaterländ. Museum, Braunschweig
Saale, verschiedene Desseins von Dekorationen, „so wie
solche in einer Stube oder Saale bisher von Stuckatur-
arbeit mit Gips gemacht wurden, von dieser Masse zur
Probe verfertigen, auch ein besonderes Zimmer von
dieser Arbeit in Couleur und vergoldet, nach dem
modernsten Gout ganz fertig machen zu lassen“; dabei
werden die Vorzüge dieser neuen Technik, die gegentiber
der gewöhnlichen Stuckaturarbeit an Decken und Wän-
den nicht nur in der größeren Zeitersparnis und den gerin-
geren Kosten, sondern auch in der größeren Leichtigkeit,
d. h. in der geringeren Schwere der Dekoration bestan-
den, gebtihrend hervorgehoben und dem Publikum noch
mancherlei andere Vorteile in Aussicht gestellt. Da end-
licli auch ein „Warenlager von aufrichtigen (d. i. echten)
englischen papiernen Tapeten von allerley Sorten“ da-
mit verbunden war, konnte man in der Kartonfabrik so
ziemlich alles erhalten, was zu einer vornehmen und
geschmackvollen Zimmereinrichtung im Sinne der dama-
ligen Zeit gehörte. Daß es sich hierbei zu einem großen
Teil um eine Surrogatkunst handelte, d. h. um eine Kunst,
die in der Regel zu Täuschungszwecken ein echtes Mate-
rial durch einen Ersatzstoff von geringerem Wert nach-
ahmte, wird dem damaligen Publikum wohl kaum recht
zum Bewußtsein gekommen sein, zumal sich diese in
Papiermache 7 8) aus Formen gepressten und alsdann ver-
goldeten oder bemalten Gegenstände und Verzierungen
ihrem Aussehen nach von solchen, die in Holz geschnitzt
oder in Stuck modelliert waren, kaurn wesentlich unter-
schieden.
Heute sind diese Sachen, die schon wegen ihrer un-
soliden Technik die Zeit nicht zu überdauern vermoch-
ten, selten geworden, wenn auch gewiß noch manches
Stück, vor allem in Braunschweigischem Privatbesitz,
vorhanden sein mag. Unter dem Wenigen, was davon
bisjetzt zu meiner Kenntnis gekommen ist, möchte ich vor
allem zwei doppelarmige Wandleuchter iin Louis XVI.-
Stil nennen, die, aus Papiermache geformt, vergoldet
und zur größeren Festigkeit mit einem Holzkern ver-
sehen, Leuchter aus Goldbronze nachahmen. (Abb. 2.)
Unter den eigentlichen Kunstwerken aber, die aus der
Fabrik hervorgegangen sind, wäre vor allem ein lebens-
großes Reliefbrustbild Herzog Carls L, jetzt im Vater-
ländischen Museum, zu erwähnen, das sich vergoldet
vom silbernen Grunde abhebt, in einem gleichfalls aus
Papiermasse gebildeten, vergoldetem Rahmen, der mit
Laubwerk und Fürstenhut verziert ist. (Abb. 3.) Dieses
Werk, das schon im alten Inventar des Landesmuseum,
wo es sich ursprünglich befand (F Nr. 845), ausdrücklich
als Erzeugnis der Kartonfabrik angeführt und genau be-
schrieben wird, ist technisch nahe verwandt mit einer be-
stimmter Gruppe farbiger, aus Papiermasse geformter
Reliefs, die Albert von Soest, Jodokus Vredis und anderen
Meistern des 16. Jahrhunderts zugeschrieben werdenF)
Und in der Tat war ja auch die Masse selbst und ihre
Verwendung zu künstlerischen Zwecken nicht etwa erst
eine Erfindung des 18. Jahrhunderts oder gar der Braun-
schweiger Kartonfabrik; sie ist vielmehr weit älteren
Ursprungs, da sie bereits im Mittelalter 9) und dann wie-
der im 16. Jahrhundert nicht nur in Deutschland und
den Niederlanden, sondern auch in Italien, wo sie carta
pesta hieß, und in Frankreich, wo sie als carton-pierre
oder carton-päte und ihre Verarbeitung in der Plastik
als sculpture en carton bezeichnet wurde 10), bekannt
7) Im 18. Jahrh. nannte man die Masse Pappenteig Vergl. I. H.
0. von Justi, Schauplatz der Künste u. Handwerke III (1764) S.
400 f. — Eine größere Anweisung zur Hersteliung und Verwendung
einer ähnlichen Masse findet sich bereits bei Sincerus, Alexander,
Lust und Nutz, In einem gantz neu verfaßten Kunst-Buch. Nürnberg
1718 S. 80.
8) Siehe W. Behnke, Albert von Soest S. 52 ff. und B. Meier,
Jodokus Vredis und die Utrechter Bilderbäcker, in der Zeitschrift
„Westfalen“ VII (1915) Heft 4 —.
D) Siehe Zeitschrift f. christliche Kunst 1910 S. 32 ff.
10) Siehe H. Havard, Dictionnaire de l’ameublement I p. 597.
IV p. 918 f.
106
chenden Aufschluß. Hiernach bestand das Warenlager
zunächst aus mit echtem Dukatengold vergoldeten Tru-
meaux, Wandleuchtern, Girandolen, Consolen, Tisch-
füßen mit marmornen oder hölzernen lackierten Platten,
Figuren, Tapetenleisten, Bilderrahmen und allerlei üeko-
rationen fiir Zimmer, ,,nach den besten Desseins der
Bildhauerarbeit etabliert“. Ferner wird aber noch be-
kannt gegeben, daß man, ermuntert durch die der Fabrik
von Serenissimus erteilten Privilegien und den Beifall
des Publikums, in einem eigenen hierzu eingeräumten
Abb. 3. Reliefbildnis Herzog Caris 1., angefertigt in der Karton-
fabrik zu Braunschweig. Vaterländ. Museum, Braunschweig
Saale, verschiedene Desseins von Dekorationen, „so wie
solche in einer Stube oder Saale bisher von Stuckatur-
arbeit mit Gips gemacht wurden, von dieser Masse zur
Probe verfertigen, auch ein besonderes Zimmer von
dieser Arbeit in Couleur und vergoldet, nach dem
modernsten Gout ganz fertig machen zu lassen“; dabei
werden die Vorzüge dieser neuen Technik, die gegentiber
der gewöhnlichen Stuckaturarbeit an Decken und Wän-
den nicht nur in der größeren Zeitersparnis und den gerin-
geren Kosten, sondern auch in der größeren Leichtigkeit,
d. h. in der geringeren Schwere der Dekoration bestan-
den, gebtihrend hervorgehoben und dem Publikum noch
mancherlei andere Vorteile in Aussicht gestellt. Da end-
licli auch ein „Warenlager von aufrichtigen (d. i. echten)
englischen papiernen Tapeten von allerley Sorten“ da-
mit verbunden war, konnte man in der Kartonfabrik so
ziemlich alles erhalten, was zu einer vornehmen und
geschmackvollen Zimmereinrichtung im Sinne der dama-
ligen Zeit gehörte. Daß es sich hierbei zu einem großen
Teil um eine Surrogatkunst handelte, d. h. um eine Kunst,
die in der Regel zu Täuschungszwecken ein echtes Mate-
rial durch einen Ersatzstoff von geringerem Wert nach-
ahmte, wird dem damaligen Publikum wohl kaum recht
zum Bewußtsein gekommen sein, zumal sich diese in
Papiermache 7 8) aus Formen gepressten und alsdann ver-
goldeten oder bemalten Gegenstände und Verzierungen
ihrem Aussehen nach von solchen, die in Holz geschnitzt
oder in Stuck modelliert waren, kaurn wesentlich unter-
schieden.
Heute sind diese Sachen, die schon wegen ihrer un-
soliden Technik die Zeit nicht zu überdauern vermoch-
ten, selten geworden, wenn auch gewiß noch manches
Stück, vor allem in Braunschweigischem Privatbesitz,
vorhanden sein mag. Unter dem Wenigen, was davon
bisjetzt zu meiner Kenntnis gekommen ist, möchte ich vor
allem zwei doppelarmige Wandleuchter iin Louis XVI.-
Stil nennen, die, aus Papiermache geformt, vergoldet
und zur größeren Festigkeit mit einem Holzkern ver-
sehen, Leuchter aus Goldbronze nachahmen. (Abb. 2.)
Unter den eigentlichen Kunstwerken aber, die aus der
Fabrik hervorgegangen sind, wäre vor allem ein lebens-
großes Reliefbrustbild Herzog Carls L, jetzt im Vater-
ländischen Museum, zu erwähnen, das sich vergoldet
vom silbernen Grunde abhebt, in einem gleichfalls aus
Papiermasse gebildeten, vergoldetem Rahmen, der mit
Laubwerk und Fürstenhut verziert ist. (Abb. 3.) Dieses
Werk, das schon im alten Inventar des Landesmuseum,
wo es sich ursprünglich befand (F Nr. 845), ausdrücklich
als Erzeugnis der Kartonfabrik angeführt und genau be-
schrieben wird, ist technisch nahe verwandt mit einer be-
stimmter Gruppe farbiger, aus Papiermasse geformter
Reliefs, die Albert von Soest, Jodokus Vredis und anderen
Meistern des 16. Jahrhunderts zugeschrieben werdenF)
Und in der Tat war ja auch die Masse selbst und ihre
Verwendung zu künstlerischen Zwecken nicht etwa erst
eine Erfindung des 18. Jahrhunderts oder gar der Braun-
schweiger Kartonfabrik; sie ist vielmehr weit älteren
Ursprungs, da sie bereits im Mittelalter 9) und dann wie-
der im 16. Jahrhundert nicht nur in Deutschland und
den Niederlanden, sondern auch in Italien, wo sie carta
pesta hieß, und in Frankreich, wo sie als carton-pierre
oder carton-päte und ihre Verarbeitung in der Plastik
als sculpture en carton bezeichnet wurde 10), bekannt
7) Im 18. Jahrh. nannte man die Masse Pappenteig Vergl. I. H.
0. von Justi, Schauplatz der Künste u. Handwerke III (1764) S.
400 f. — Eine größere Anweisung zur Hersteliung und Verwendung
einer ähnlichen Masse findet sich bereits bei Sincerus, Alexander,
Lust und Nutz, In einem gantz neu verfaßten Kunst-Buch. Nürnberg
1718 S. 80.
8) Siehe W. Behnke, Albert von Soest S. 52 ff. und B. Meier,
Jodokus Vredis und die Utrechter Bilderbäcker, in der Zeitschrift
„Westfalen“ VII (1915) Heft 4 —.
D) Siehe Zeitschrift f. christliche Kunst 1910 S. 32 ff.
10) Siehe H. Havard, Dictionnaire de l’ameublement I p. 597.
IV p. 918 f.
106