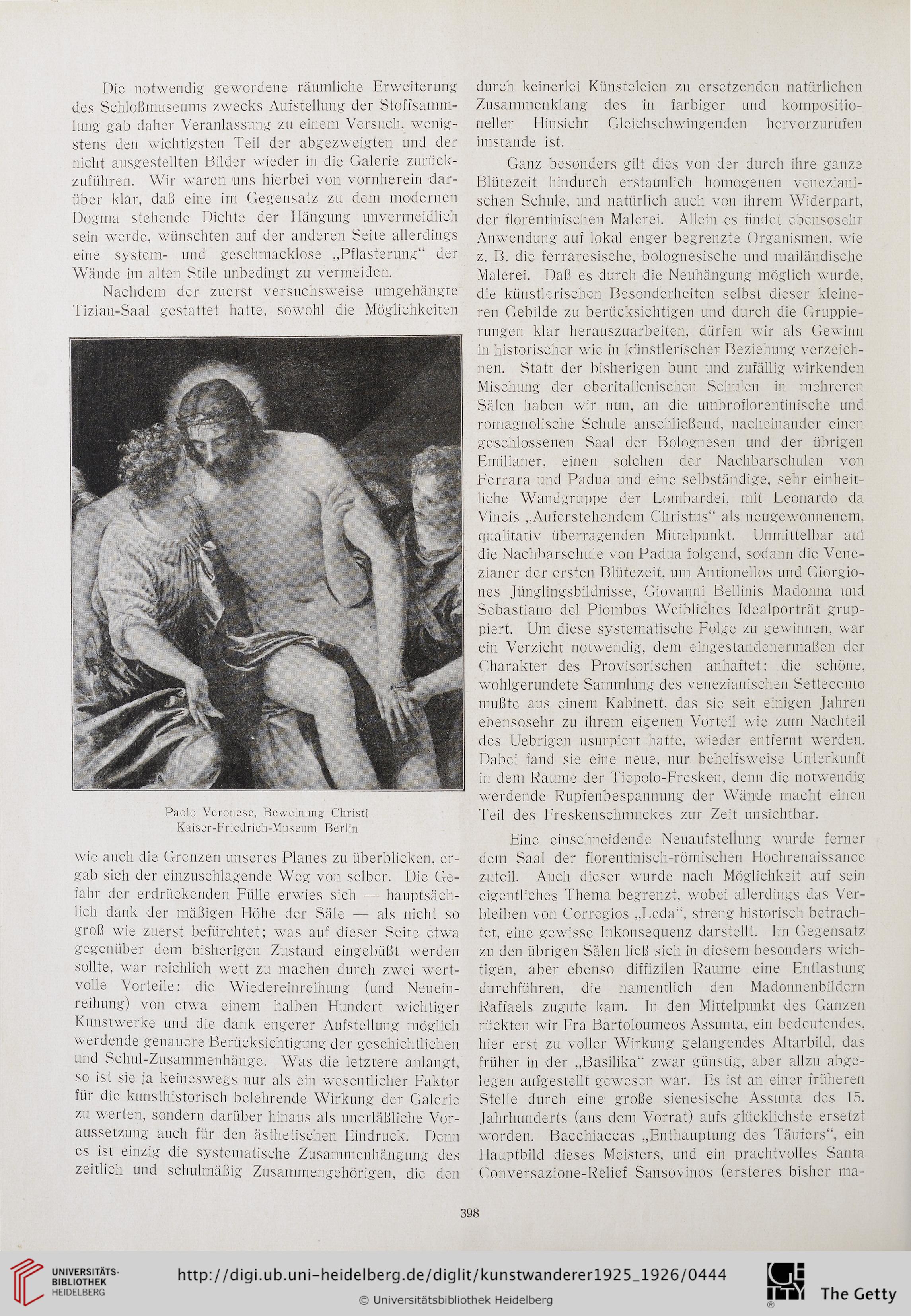Die notwendig gewordene räumliche Erweiterung
des Schloßmuseums zwecks Aufstellung der Stoffsamm-
lung gab daher Veranlassung zu einem Versuch, wenig-
stens den wichtigsten Teil der abgezweigten und der
nicht ausgestellten Bilder wieder in die Galerie zurück-
zuführen. Wir waren uns hierbei von vornherein dar-
über klar, daß eine im Gegensatz zu dem modernen
Dogma stehende Dichte der Hängung unvermeidlich
sein werde, wünschten auf der anderen Seite allerdings
eine system- und geschmacklose „Pflasterung“ der
Wände im alten Stile unbedingt zu vermeiden.
Nachdem der zuerst versuchsweise umgehängte
Tizian-Saal gestattet hatte, sowohl die Möglichkeiten
Paolo Veronese, Beweinung Christi
Kaiser-Friedrich-Museum Berlin
wie auch die Grenzen unseres Planes zu überblicken, er-
gab sich der einzuschlagende Weg von selber. Die Ge-
fahr der erdrückenden Fülle erwies sich — hauptsäch-
lich dank der mäßigen Höhe der Säle — als nicht so
groß wie zuerst befürchtet; was auf dieser Seite etwa
gegenüber dem bisherigen Zustand eingebüßt werden
sollte, war reichlich wett zu machen durch zwei wert-
volle Vorteile: die Wiedereinreihung (und Neuein-
reihung) von etwa einem halben Hundert wichtiger
Kunstwerke und die dank engerer Aufstellung möglich
werdende genauere Berücksichtigung der geschichtlichen
und Schul-Zusammenhänge. Was die letztere anlangt,
so ist sie ja keineswegs nur als eiu wesentlicher Faktor
für die kunsthistorisch belehrende Wirkung der Galerie
zu werten, sondern darüber hinaus als unerläßliche Vor-
aussetzung auch für den ästhetischen Eindruck. Denn
es ist einzig die systematische Zusammenhängung des
zeitlich und schulmäßig Zusammengehörigen, die den
durch keinerlei Künsteleien zu ersetzenden natürlichen
Zusammenklang des 'in farbiger und kompositio-
neller Hinsicht Gleichschwingenden hervorzurufen
imstande ist.
Ganz besonders gilt dies von der durch ihre ganze
Blütezeit hindurch erstaunlich homogenen veneziani-
schen Schule, und natürlich auch von ihrem Widerpart,
der fiorentinischen Malerei. Allein es findet ebensosehr
Anwendung auf lokal enger begrenzte Organismen, wie
z. B. die ferraresische, bolognesische und mailändische
Malerei. Daß es durch die Neuhängung möglich wurde,
die künstlerischen Besonderheiten selbst dieser kleine-
ren Gebilde zu berücksichtigen und durch die Gruppie-
rungen klar herauszuarbeiten, dürfen wir als Gewinn
in historischer wie in künstlerischer Beziehung verzeich-
nen. Statt der bisherigen bunt und zufällig wirkenden
Mischung der oberitalienischen Schulen in mehreren
Sälen haben wir nun, an die umbroflorentinische und
romagnolische Schule anschließend, nacheinander einen
geschlossenen Saal der Bolognesen und der übrigen
Emilianer, einen solchen der Nachbarschulen von
Ferrara und Padua und eine selbständige, sehr einheit-
liche Wandgruppe der Lombardei, mit Leonardo da
Vincis „Auferstehendem Christus“ als neugewonnenem,
qualitativ überragenden Mittelpunkt. Unmittelbar aui
die Nachbarschule von Padua folgend, sodann die Vene-
zianer der ersten Blütezeit, um Antionellos und Giorgio-
nes Jünglingsbildnisse, Giovanni Bellinis Madonna und
Sebastiano del Piombos Weibliches Idealporträt grup-
piert. Um diese systematische Folge zu gewinnen, war
ein Verzicht notwendig, dem eingestandenermaßen der
Charakter des Provisorischen anhaftet: die schöne,
wohlgerundete Sammlung des venezianischen Settecento
mußte aus einem Kabinett, das sie seit einigen Jahren
ebensosehr zu ihrem eigenen Vorteil wie zum Nachteil
des Uebrigen usurpiert hatte, wieder entfernt werden.
Dabei fand sie eine neue, nur behelfsweise Unterkunft
in dem Raume der Tiepolo-Fresken, denn die notwendig
werdende Rupfenbespannung der Wände macht einen
Teil des Freskenschmuckes zur Zeit unsichtbar.
Eine einschneidende Neuaufstellung wurde ferner
dem Saal der florentinisch-römischen Hochrenaissance
zuteil. Auch dieser wurde nach Möglichkeit auf sein
eigentliches Thema begrenzt, wobei allerdings das Ver-
bleiben von Corregios „Leda“, streng historisch betrach-
tet, eine gewisse Inkonsequenz darstellt. Im Gegensatz
zu den übrigen Sälen ließ sich in diesem besonders wich-
tigen, aber ebenso diffizilen Raume eine Entlastung
durchführen, die namentlich den Madonnenbildern
Raffaels zugute kam. In den Mittelpunkt des Ganzen
rückten wir Fra Bartoloumeos Assunta, ein bedeutendes,
hier erst zu voller Wirkung gelangendes Altarbild, das
früher in der „Basilika“ zwar günstig, aber allzu abge-
legen aufgestellt gewesen war. Es ist an einer früheren
Stelle durch eine große sienesische Assunta des 15.
Jahrhunderts (aus dem Vorrat) aufs glücklichste ersetzt
worden. Bacchiaccas „Enthauptung des Täufers“, ein
Hauptbild dieses Meisters, und ein prachtvolles Santa
Conversazione-Relief Sansovinos (ersteres bisher ma-
398
des Schloßmuseums zwecks Aufstellung der Stoffsamm-
lung gab daher Veranlassung zu einem Versuch, wenig-
stens den wichtigsten Teil der abgezweigten und der
nicht ausgestellten Bilder wieder in die Galerie zurück-
zuführen. Wir waren uns hierbei von vornherein dar-
über klar, daß eine im Gegensatz zu dem modernen
Dogma stehende Dichte der Hängung unvermeidlich
sein werde, wünschten auf der anderen Seite allerdings
eine system- und geschmacklose „Pflasterung“ der
Wände im alten Stile unbedingt zu vermeiden.
Nachdem der zuerst versuchsweise umgehängte
Tizian-Saal gestattet hatte, sowohl die Möglichkeiten
Paolo Veronese, Beweinung Christi
Kaiser-Friedrich-Museum Berlin
wie auch die Grenzen unseres Planes zu überblicken, er-
gab sich der einzuschlagende Weg von selber. Die Ge-
fahr der erdrückenden Fülle erwies sich — hauptsäch-
lich dank der mäßigen Höhe der Säle — als nicht so
groß wie zuerst befürchtet; was auf dieser Seite etwa
gegenüber dem bisherigen Zustand eingebüßt werden
sollte, war reichlich wett zu machen durch zwei wert-
volle Vorteile: die Wiedereinreihung (und Neuein-
reihung) von etwa einem halben Hundert wichtiger
Kunstwerke und die dank engerer Aufstellung möglich
werdende genauere Berücksichtigung der geschichtlichen
und Schul-Zusammenhänge. Was die letztere anlangt,
so ist sie ja keineswegs nur als eiu wesentlicher Faktor
für die kunsthistorisch belehrende Wirkung der Galerie
zu werten, sondern darüber hinaus als unerläßliche Vor-
aussetzung auch für den ästhetischen Eindruck. Denn
es ist einzig die systematische Zusammenhängung des
zeitlich und schulmäßig Zusammengehörigen, die den
durch keinerlei Künsteleien zu ersetzenden natürlichen
Zusammenklang des 'in farbiger und kompositio-
neller Hinsicht Gleichschwingenden hervorzurufen
imstande ist.
Ganz besonders gilt dies von der durch ihre ganze
Blütezeit hindurch erstaunlich homogenen veneziani-
schen Schule, und natürlich auch von ihrem Widerpart,
der fiorentinischen Malerei. Allein es findet ebensosehr
Anwendung auf lokal enger begrenzte Organismen, wie
z. B. die ferraresische, bolognesische und mailändische
Malerei. Daß es durch die Neuhängung möglich wurde,
die künstlerischen Besonderheiten selbst dieser kleine-
ren Gebilde zu berücksichtigen und durch die Gruppie-
rungen klar herauszuarbeiten, dürfen wir als Gewinn
in historischer wie in künstlerischer Beziehung verzeich-
nen. Statt der bisherigen bunt und zufällig wirkenden
Mischung der oberitalienischen Schulen in mehreren
Sälen haben wir nun, an die umbroflorentinische und
romagnolische Schule anschließend, nacheinander einen
geschlossenen Saal der Bolognesen und der übrigen
Emilianer, einen solchen der Nachbarschulen von
Ferrara und Padua und eine selbständige, sehr einheit-
liche Wandgruppe der Lombardei, mit Leonardo da
Vincis „Auferstehendem Christus“ als neugewonnenem,
qualitativ überragenden Mittelpunkt. Unmittelbar aui
die Nachbarschule von Padua folgend, sodann die Vene-
zianer der ersten Blütezeit, um Antionellos und Giorgio-
nes Jünglingsbildnisse, Giovanni Bellinis Madonna und
Sebastiano del Piombos Weibliches Idealporträt grup-
piert. Um diese systematische Folge zu gewinnen, war
ein Verzicht notwendig, dem eingestandenermaßen der
Charakter des Provisorischen anhaftet: die schöne,
wohlgerundete Sammlung des venezianischen Settecento
mußte aus einem Kabinett, das sie seit einigen Jahren
ebensosehr zu ihrem eigenen Vorteil wie zum Nachteil
des Uebrigen usurpiert hatte, wieder entfernt werden.
Dabei fand sie eine neue, nur behelfsweise Unterkunft
in dem Raume der Tiepolo-Fresken, denn die notwendig
werdende Rupfenbespannung der Wände macht einen
Teil des Freskenschmuckes zur Zeit unsichtbar.
Eine einschneidende Neuaufstellung wurde ferner
dem Saal der florentinisch-römischen Hochrenaissance
zuteil. Auch dieser wurde nach Möglichkeit auf sein
eigentliches Thema begrenzt, wobei allerdings das Ver-
bleiben von Corregios „Leda“, streng historisch betrach-
tet, eine gewisse Inkonsequenz darstellt. Im Gegensatz
zu den übrigen Sälen ließ sich in diesem besonders wich-
tigen, aber ebenso diffizilen Raume eine Entlastung
durchführen, die namentlich den Madonnenbildern
Raffaels zugute kam. In den Mittelpunkt des Ganzen
rückten wir Fra Bartoloumeos Assunta, ein bedeutendes,
hier erst zu voller Wirkung gelangendes Altarbild, das
früher in der „Basilika“ zwar günstig, aber allzu abge-
legen aufgestellt gewesen war. Es ist an einer früheren
Stelle durch eine große sienesische Assunta des 15.
Jahrhunderts (aus dem Vorrat) aufs glücklichste ersetzt
worden. Bacchiaccas „Enthauptung des Täufers“, ein
Hauptbild dieses Meisters, und ein prachtvolles Santa
Conversazione-Relief Sansovinos (ersteres bisher ma-
398