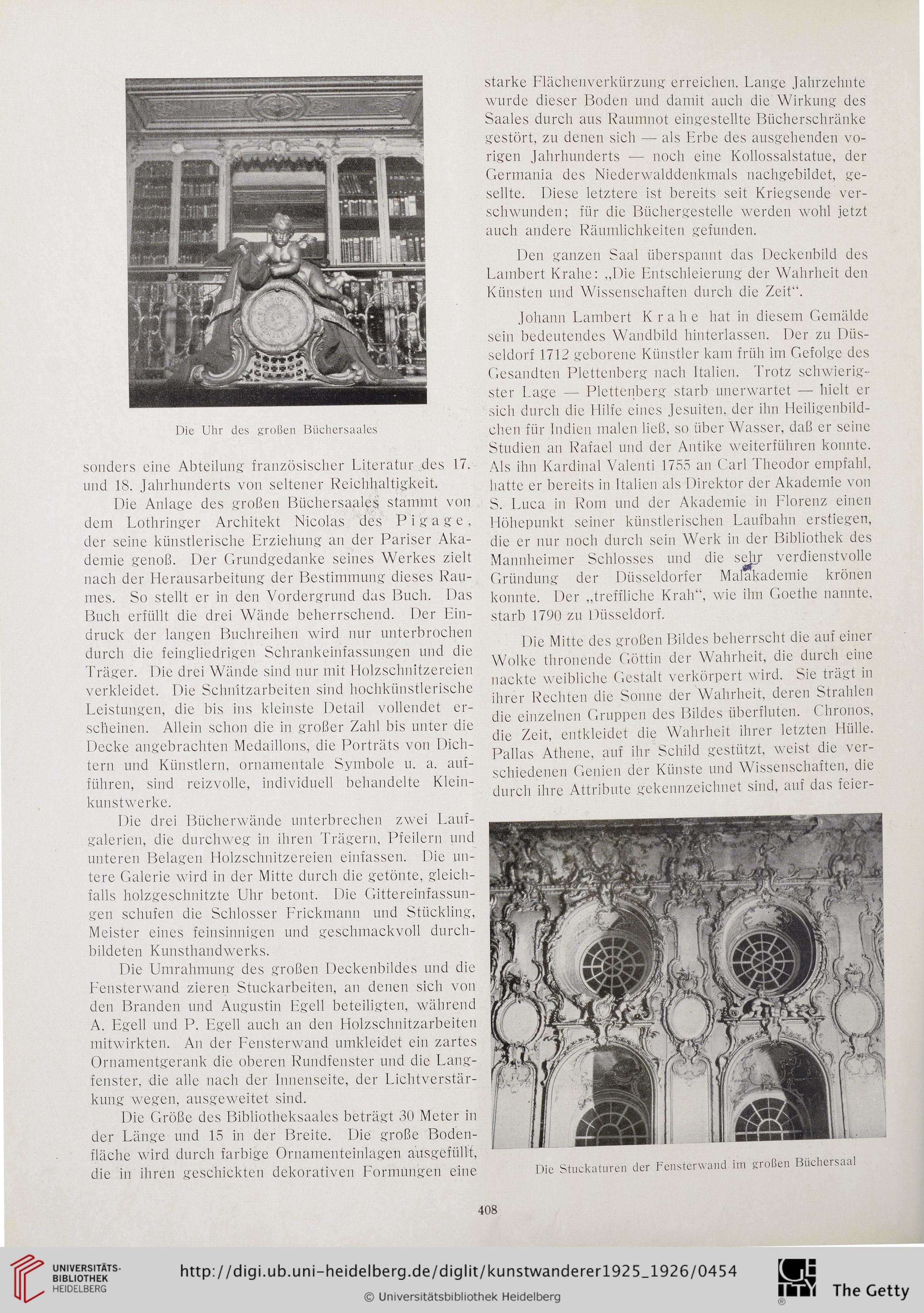Die Uhr des großen Biichersaales
sonders eine Abteilung französischer Literatur des 17.
und 18. Jahrhunderts von seltener Reichhaltigkeit.
Die Anlage des großen Büchersaales stammt von
dem Lothringer Architekt Nicolas des Pigage,
der seine künstlerische Erziehung an der Pariser Aka-
demie genoß. Der Grundgedanke seines Werkes zielt
nach der Herausarbeitung der Bestimmung dieses Rau-
mes. So stellt er in den Vordergrund das Buch. Das
Buch erfüllt die drei Wände beherrschend. Der Ein-
druck der langen Buchreihen wird nur unterbrochen
durch die feingliedrigen Schrankeinfassungen und die
Träger. Die drei Wände sind nur mit Holzschnitzereien
verkleidet. Die Schnltzarbeiten sind hochkünstlerische
Leistungen, die bis ins kleinste Detail vollendet er-
scheinen. Allein schon die in großer Zahl bis unter die
Decke angebrachten Medaillons, die Porträts von Dich-
tern und Künstlern, ornamentale Symbole u. a. auf-
führen, siird reizvolle, individueh behandelte Klein-
kunstwerke.
Die drei Bücherwände unterbrechen zwei Eauf-
galerien, die durchweg in ihren Trägern, Pfeilern und
unteren Belagen Holzschnitzereien einfassen. Die un-
tere Galerie wird in der Mitte durch die getönte, gleich-
falls holzgeschnitzte Uhr betont. Die Gittereinfassun-
gen schufen die Schlosser Frickmann und Stückling,
Meister eines feinsinnigen und geschmackvoll durch-
bildeten Kunsthandwerks.
Die Umrahmung des großen Deckenbildes und die
Eensterwand zieren Stuckarbeiten, an denen sich von
den Branden und Augustin Egell beteiligten, während
A. Egell und P. Egell auch an den Holzschnitzarbeiten
mitwirkten. An der Fensterwand umkleidet ein zartes
Ornamentgerank die oberen Rundfenster und die Lang-
fenster, die alle nach der Innenseite, der Lichtverstär-
kung wegen, ausgeweitet sind.
Die Größe des Bibliotheksaales beträgt 30 Meter in
der Länge und 15 in der Breite. Die große Boden-
fläche wird durch farbige Ornamenteinlagen ausgefüllt,
die in ihren geschickten dekorativen Eormüngen eine
starke Flächenverkürzung erreichen. Lange Jahrzehnte
wurde dieser Boden und damit auch die Wirkung des
Saales durch aus Raumnot eingestellte Bücherschränke
gestört, zu denen sich — als Erbe des ausgehenden vo-
rigen Jahrhunderts — noch eine Kollossalstatue, der
Germania des Niederwalddenkmals nachgebildet, ge-
sellte. Diese letztere ist bereits seit Kriegsende ver-
schwunden; fiir die Büchergestelle werden wohl jetzt
auch andere Räumlichkeiten gefunden.
Den ganzen Saal überspannt das Deckenbild des
Lambert Krahe: „Die Entschleierung der Wahrheit den
Künsten und Wissenschaften durch die Zeit“.
Johann Lambert Krahe hat in diesem Gemälde
sein bcdeutendes Wandbild hinterlassen. Der zu Düs-
seldorf 1712 geborene Künstler kam früh im Gefolge des
Gesandten Plettenberg nach Italien. Trotz schwierig-
ster Lage — Pletteiiberg starb unerwartet — hielt er
sich durch die Hilfe eines Jesuiten, der ihn Heiligenbild-
chen für Indien malen ließ, so über Wasser, daß er seine
Studien an Rafael und der Antike weiterführen konnte.
Als ihn Kardinal Valenti 1755 an Carl Theodor empfahl,
liatte er bereits in Italien als Direktor der Akademie von
S. Luca in Rom und der Akademie in Florenz einen
Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn erstiegen,
die er nur noch durch sein Werk in der Bibliothek des
Mannheimer Schlosses und die sehp verdienstvolle
Gründung der Düsseldorfer Mafakademie krönen
konnte. Der „treffliche Krah“, wie ihn Goethe nannte,
starb 1790 zu Düsseldorf.
Die Mitte des großen Bildes beherrscht die auf einer
Wolke thronende Göttin der Wahrheit, die durch eine
nackte weibliche Gestalt verkörpert wird. Sie trägt in
ihrer Rechten die Sonne der Wahrheit, deren Strahlen
die einzelnen Gruppen des Bildes tiberfluten. Chronos,
die Zeit, entkleidet die Wahrheit ihrer letzten Hülle.
Pallas Athene, auf ihr Schild gestützt, weist die ver-
schiedenen Genien der Klinste und Wissenschaften, die
durch ihre Attribute gekennzeiclmet sind, auf das feier-
Die Stuckaturen der Fensterwand iin großen Biichersaal
408