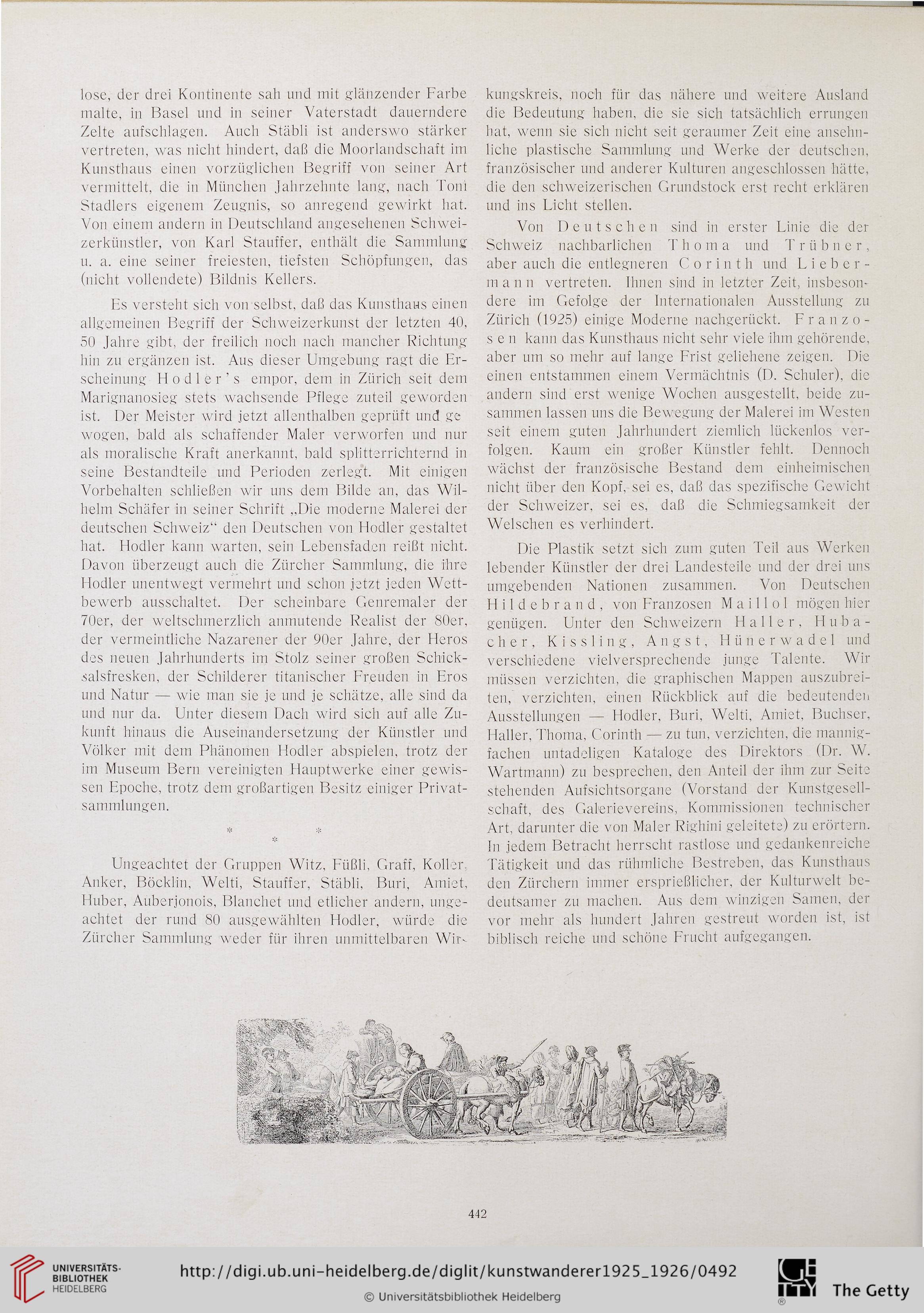lose, der drei Kontinente sah und mit glänzender Farbe
malte, in Basel und in seiner Vaterstadt dauerndere
Zelte aufsclilagen. Aucii Stäbli ist anderswo stärker
vertreten, was nicht hindert, daß die Moorlandschaft im
Kunsthaus einen vorzüglichen Begriff von seiner Art
vermittelt, die in München Jahrzehnte lang, nach Toni
Stadlers eigenem Zeugnis, so anregend gewirkt hat.
Von einem andern in Deutschland angesehenen Scliwei-
zerkünstler, von Karl Stauffer, enthält die Sammlung
u. a. eine seiner freiesten, tiefsten Schöpfungen, das
(nicht vollendete) Bildnis Kellers.
Es versteht sich von selbst, daß das Kunsthaus einen
allgemeinen Begriff der Schweizerkunst der letzten 40,
50 Jahre gibt, der freilich noch nach mancher Richtung
hin zu ergänzen ist. Aus dieser Umgebung ragt die Er-
scheinung H o d 1 e r ’ s empor, dem in Zürich seit dem
Marignanosieg stets wachsende Pflege zuteil geworden
ist. Der Meister wird jetzt allenthalben geprüft und ge
wogen, bald als schaffender Maler verworfen und nur
als moralische Kraft anerkannt, bald splitterrichternd in
seine Bestandteile und Perioden zerlegt. Mit einigen
Vorbehalten schließen wir uns dem Bilde an, das Wil-
helm Schäfer in seiner Schrift „Die moderne Malerei der
deutschen Schweiz“ den Deutschen von Hodler gestaltet
hat. Hodler kann warten, sein Lebensfaden reißt nicht.
Davon überzeugt auch die Zürcher Sammlung, die ihre
Hodler unentwegt vermehrt und schon jetzt jeden Wett-
bewerb ausschaltet. Der scheinbare Genremaler der
70er, der weltschmerzlich anmutende Realist der 80er,
der vermeintliche Nazarener der 90er Jahre, der Heros
des neuen Jahrhunderts im Stolz seiner großen Schick-
salsfresken, der Schilderer titanischer Freuden in Eros
und Natur — wie man sie je und je schätze, alle sind da
und nur da. Unter diesein Dach wird sicli auf alle Zu-
kunft hinaus die Auseinandersetzung der Künstler und
Völker mit dem Phänomen Hodler abspielen, trotz der
im Museum Bern vereinigten Hauptwerke einer gewis-
sen Epoche, trotz dem großartigen Besitz einiger Privat-
sammlungen.
Ungeachtet der Gruppen Witz, Füßli, Graff, Koller.
Anker, Böcklin, Welti, Stauffer, Stäbli, Buri, Amiet,
Huber, Auberjonois, Blanchet und etlicher andern, unge-
achtet der rund 80 ausgewählten Hodler, würde die
Zürcher Sammlung weder fiir ihren unmittelbaren Wim
kungskreis, noch für das nähere und weitere Ausland
die Bedeutung haben, die sie sich tatsächlich errungen
hat, wenn sie sich nicht seit geraumer Zeit eine ansehn-
liche plastische Sammlung und Werke der deutschen,
französischer und anderer Kulturen angeschlossen hätte,
die den schweizerischen Grundstock erst recht erklären
und ins Licht stellen.
Von Deutschen sind in erster Linie die der
Schweiz nachbarlichen T h o m a und T r ü b n e r ,
aber auch die entlegneren C o r i n t h und L i e b e r -
m a n n vertreten. Ihnen sind in letzter Zeit, insbeson-
dere im Gefolge der Internationalen Ausstellung zu
Zürich (1925) einige Moderne nachgerückt. F r a n z o -
s e n kann das Kunsthaus nicht sehr viele ihm gehörende,
aber um so mehr auf lange Frist geliehene zeigen. Die
einen entstammen einem Vermächtnis (D. Schuler), die
andern sind erst wenige Wochen ausgestellt, beide zu-
sammen lassen uns die Bewegung der Malerei im Westen
seit einem guten Jahrhundert ziemlich lückenlos ver-
folgen. Kaum ein großer Künstler fehlt. Dennoch
wächst der französische Bestand dem einheimischen
nicht über den Kopf, sei es, daß das spezifische Gewicht
der Schweizer, sei es, daß die Schmiegsamkeit der
Welschen es verhindert.
Die Plastik setzt sich zum guten Teil aus Werken
lebender Künstler der drei Landesteile und der drei uns
umgebenden Nationen zusammen. Von Deutschen
H i 1 d e b r a n d , von Franzosen M a i 11 o 1 mögen hier
genügen. Unter den Schweizern Haller, Huba-
c h e r , K i s s 1 i n g , A n g s t, H ü n e r w a d e 1 und
verschiedene vielversprechende junge Talente. Wir
müssen verzichten, die graphischen Mappen auszubrei-
ten, verzichten, einen Rückblick auf die bedeutenden
Ausstellungen — Hodler, Buri, Welti, Amiet, Buchser,
Haller, Thoma, Corinth — zu tun, verzichten, die mannig-
fachen untadeligen Kataloge des Direktors (Dr. W.
Wartmann) zu besprechen, den Anteil der ihm zur Seite
stehenden Aufsichtsorgane (Vorstand der Kunstgesell-
schaft, des Gaterievereins, Kommissionen technischer
Art, darunter die von Maler Righini geleitete) zu erörtern.
In jedem Betracht herrscht rastlose und gedankenreiche
Tätigkeit und das rühmliche Bestreben, das Kunstliaus
den Zürchern imrner ersprießlicher, der Kulturwelt be-
deutsamer zu machen. Aus dem winzigen Samen, der
vor mehr als hundert Jahren gestreut worden ist, ist
biblisch reiche und schöne Frucht aufgegangen.
442
malte, in Basel und in seiner Vaterstadt dauerndere
Zelte aufsclilagen. Aucii Stäbli ist anderswo stärker
vertreten, was nicht hindert, daß die Moorlandschaft im
Kunsthaus einen vorzüglichen Begriff von seiner Art
vermittelt, die in München Jahrzehnte lang, nach Toni
Stadlers eigenem Zeugnis, so anregend gewirkt hat.
Von einem andern in Deutschland angesehenen Scliwei-
zerkünstler, von Karl Stauffer, enthält die Sammlung
u. a. eine seiner freiesten, tiefsten Schöpfungen, das
(nicht vollendete) Bildnis Kellers.
Es versteht sich von selbst, daß das Kunsthaus einen
allgemeinen Begriff der Schweizerkunst der letzten 40,
50 Jahre gibt, der freilich noch nach mancher Richtung
hin zu ergänzen ist. Aus dieser Umgebung ragt die Er-
scheinung H o d 1 e r ’ s empor, dem in Zürich seit dem
Marignanosieg stets wachsende Pflege zuteil geworden
ist. Der Meister wird jetzt allenthalben geprüft und ge
wogen, bald als schaffender Maler verworfen und nur
als moralische Kraft anerkannt, bald splitterrichternd in
seine Bestandteile und Perioden zerlegt. Mit einigen
Vorbehalten schließen wir uns dem Bilde an, das Wil-
helm Schäfer in seiner Schrift „Die moderne Malerei der
deutschen Schweiz“ den Deutschen von Hodler gestaltet
hat. Hodler kann warten, sein Lebensfaden reißt nicht.
Davon überzeugt auch die Zürcher Sammlung, die ihre
Hodler unentwegt vermehrt und schon jetzt jeden Wett-
bewerb ausschaltet. Der scheinbare Genremaler der
70er, der weltschmerzlich anmutende Realist der 80er,
der vermeintliche Nazarener der 90er Jahre, der Heros
des neuen Jahrhunderts im Stolz seiner großen Schick-
salsfresken, der Schilderer titanischer Freuden in Eros
und Natur — wie man sie je und je schätze, alle sind da
und nur da. Unter diesein Dach wird sicli auf alle Zu-
kunft hinaus die Auseinandersetzung der Künstler und
Völker mit dem Phänomen Hodler abspielen, trotz der
im Museum Bern vereinigten Hauptwerke einer gewis-
sen Epoche, trotz dem großartigen Besitz einiger Privat-
sammlungen.
Ungeachtet der Gruppen Witz, Füßli, Graff, Koller.
Anker, Böcklin, Welti, Stauffer, Stäbli, Buri, Amiet,
Huber, Auberjonois, Blanchet und etlicher andern, unge-
achtet der rund 80 ausgewählten Hodler, würde die
Zürcher Sammlung weder fiir ihren unmittelbaren Wim
kungskreis, noch für das nähere und weitere Ausland
die Bedeutung haben, die sie sich tatsächlich errungen
hat, wenn sie sich nicht seit geraumer Zeit eine ansehn-
liche plastische Sammlung und Werke der deutschen,
französischer und anderer Kulturen angeschlossen hätte,
die den schweizerischen Grundstock erst recht erklären
und ins Licht stellen.
Von Deutschen sind in erster Linie die der
Schweiz nachbarlichen T h o m a und T r ü b n e r ,
aber auch die entlegneren C o r i n t h und L i e b e r -
m a n n vertreten. Ihnen sind in letzter Zeit, insbeson-
dere im Gefolge der Internationalen Ausstellung zu
Zürich (1925) einige Moderne nachgerückt. F r a n z o -
s e n kann das Kunsthaus nicht sehr viele ihm gehörende,
aber um so mehr auf lange Frist geliehene zeigen. Die
einen entstammen einem Vermächtnis (D. Schuler), die
andern sind erst wenige Wochen ausgestellt, beide zu-
sammen lassen uns die Bewegung der Malerei im Westen
seit einem guten Jahrhundert ziemlich lückenlos ver-
folgen. Kaum ein großer Künstler fehlt. Dennoch
wächst der französische Bestand dem einheimischen
nicht über den Kopf, sei es, daß das spezifische Gewicht
der Schweizer, sei es, daß die Schmiegsamkeit der
Welschen es verhindert.
Die Plastik setzt sich zum guten Teil aus Werken
lebender Künstler der drei Landesteile und der drei uns
umgebenden Nationen zusammen. Von Deutschen
H i 1 d e b r a n d , von Franzosen M a i 11 o 1 mögen hier
genügen. Unter den Schweizern Haller, Huba-
c h e r , K i s s 1 i n g , A n g s t, H ü n e r w a d e 1 und
verschiedene vielversprechende junge Talente. Wir
müssen verzichten, die graphischen Mappen auszubrei-
ten, verzichten, einen Rückblick auf die bedeutenden
Ausstellungen — Hodler, Buri, Welti, Amiet, Buchser,
Haller, Thoma, Corinth — zu tun, verzichten, die mannig-
fachen untadeligen Kataloge des Direktors (Dr. W.
Wartmann) zu besprechen, den Anteil der ihm zur Seite
stehenden Aufsichtsorgane (Vorstand der Kunstgesell-
schaft, des Gaterievereins, Kommissionen technischer
Art, darunter die von Maler Righini geleitete) zu erörtern.
In jedem Betracht herrscht rastlose und gedankenreiche
Tätigkeit und das rühmliche Bestreben, das Kunstliaus
den Zürchern imrner ersprießlicher, der Kulturwelt be-
deutsamer zu machen. Aus dem winzigen Samen, der
vor mehr als hundert Jahren gestreut worden ist, ist
biblisch reiche und schöne Frucht aufgegangen.
442