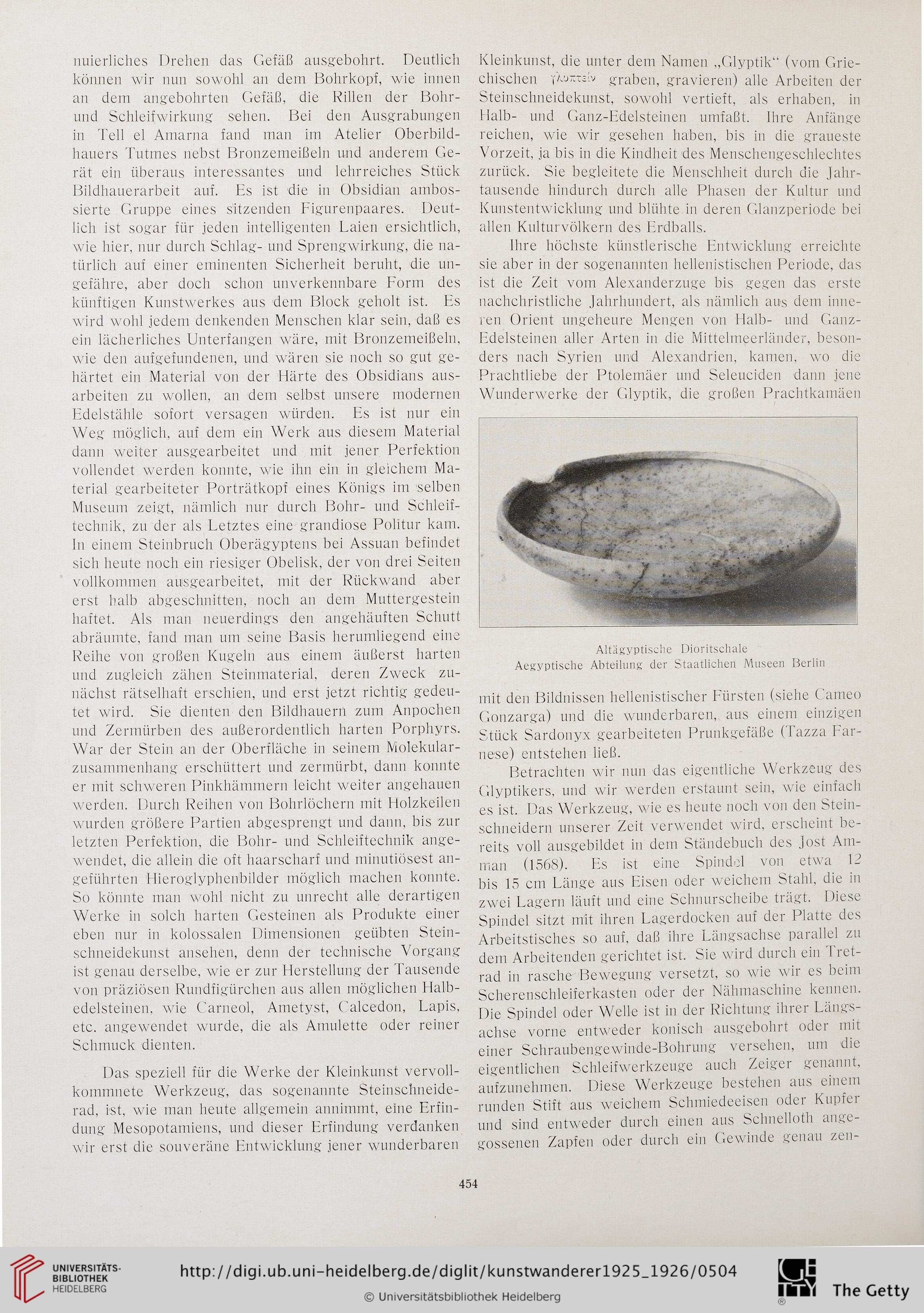nuierliches Drehen das Gefäß ausgebohrt. Deutlich
können wir nun sowohl an dem Bohrkopf, wie innen
an dem angebohrten Gefäß, die Rillen der Bohr-
und Schleifwirkung sehen. Bei den Ausgrabungen
in Tell el Amarna fand man im Atelier Oberbild-
hauers Tutmes nebst Bronzemeißeln und anderem Ge-
rät ein überaus interessantes und lehrreicbes Stück
Bildhauerarbeit auf. Es ist die in Obsidian ambos-
sierte Gruppe eines s'itzenden Figurenpaares. Deut-
lich ist sogar für jeden intelligenten Laien ersichtlich,
wie hier, nur durch Sclilag- und Sprengwirkung, die na-
türlich auf einer eminenten Sicherheit beruht, die un-
gefähre, aber doch schon unverkennbare Form des
künftigen Kunstwerkes aus dem Block geholt ist. Es
wird wohl jedem denkenden Menschen klar sein, daß es
ein lächerliches Flnterfangen wäre, mit Bronzemeißeln,
wie den aufgefundenen, und wären sie noch so gut ge-
härtet ein Material von der Härte des Obsidians aus-
arbeiten zu wollen, an dem selbst unsere modernen
Edelstähle sofort versagen würden. Es ist nur ein
Weg möglich, auf dem ein Werk aus diesem Materiai
dann weiter ausgearbeitet und mit jener Perfektion
vollendet werden konnte, wie ihn ein in gleichem Ma-
terial gearbeiteter Porträtkopf eines Königs im selben
Museum zeigt, nämlich nur durcli Bohr- und Schleif-
technik, zu der als Letztes eine grandiose Politur kam.
In einem Steinbruch Oberägyptens bei Assuan befindet
sich lieute noch ein riesiger Obelisk, der von drei Seiten
vollkommen ausgearbeitet, mit der Rückwand aber
erst halb abgeschnitten, noch an dem Muttergestein
haftet. Als man neuerdings den angehäuften Scliutt
abräumte, fand man um seine Basis herumiiegend eine
Reilie von großen Kugeln aus einem äußerst harten
und zugleich zähen Steinmaterial, deren Zweck zu-
nächst rätselhaft erschien, und erst jetzt richtig gedeu-
tet wird. Sie dienten den Bildhauern zum Anpochen
und Zermürben des außerordentlich harten Porphyrs.
War der Stein an der Oberfläche in seinem Molekular-
zusammenhang erschüttert und zermürbt, dann konnte
er mit schweren Pinkhämmern leicht weiter angehauen
werden. Durch Reihen von Bohrlöchern mit Holzkeilen
wurden größere Partien abgesprengt und dann, bis zur
letzten Perfektion, die Bohr- und Schleiftechnik ange-
wendet, die allein die oft haarscharf und minutiösest an-
geführten Hieroglyphenbilder möglich machen konnte.
So könnte man wohl nicht zu unrecht alle derartigen
Werke in solch harten Gesteinen als Produkte einer
eben nur in kolossalen Dimensionen geübten Stein-
schneidekunst ansehen, denn der technische Vorgang
ist genau derselbe, wie er zur Herstellung der Tausende
von präziösen Rundfigürchen aus allen möglichen Halb-
edelsteinen, wie Carneol, Ametyst, Calcedon, Lapis,
etc. angewendet wurde, die als Amulette oder reiner
Schmuck dienten.
Das speziell für die Werke der Kleinkunst vervoll-
kommnete Werkzeug, das sogenannte Steinschneide-
rad, ist, wie man heute allgemein annimmt, eine Erfin-
dung Mesopotamiens, und dieser Erfindung verdanken
wir erst die souveräne Entwicklung jener wunderbaren
Kleinkunst, die unter dem Namen „Glyptik“ (vom Grie-
chischen ikj-tak graben, gravieren) alle Arbeiten der
Steinschneidekunst, sowohi vertieft, als erhaben, in
Halb- und Ganz-Edelsteinen umfaßt. Ihre Anfänge
reichen, wie wir gesehen haben, bis in die graueste
Vorzeit, ja bis in die Kindheit des Menschengeschlechtes
zurück. Sie begleitete die Menschheit durch die Jahr-
tausende hindurch durch alle Phasen der Kultur und
Kunstentwicklung und blühte in deren Glanzperiode bei
allen Kulturvölkern des Erdballs.
Ihre höchste künstlerische Entwickfung erreichte
sie aber in der sogenannten hellenistischen Periode, das
ist die Zeit vom Alexanderzuge bis gegen das erste
nachchristliche Jahrhundert, als nämlich aus dem inne-
ren Orient ungeheure Mengen von Halb- und Ganz-
Edelsteinen aller Arten in die Mittelmeerländer, beson-
ders nach Syrien un-d Alexandrien, kamen, wo die
Prachtliebe der Ptolemäer und Seleuciden dann jene
Wunderwerke der Glyptik, die großen Prachtkamäen
Aegyptische Abteilung der Staatlichen Museen Berlin
mit den Bildnissen hellenistischer Fürsten (siehe Cameo
Gonzarga) und die wunderbaren, aus einem einzigen
Stück Sardonyx gearbeiteten Prunkgefäße (Tazza Far-
nese) entstehen ließ.
Betrachten wir nun das eigentliche Werkzeug des
Glyptikers, und wir werden erstaunt sein, wie einfacli
es ist. Das Werkzeug, wie es heute noch von den Stein-
schneidern unserer Zeit verwendet wird, erscheint be-
reits voll ausgebildet in dem Ständebuch des Jost Am-
man (1568). Es ist eine Spindol von etwa 12
bis 15 cm Länge aus Eisen oder weichem Stahl, die in
zwei Lagern läuft und eine Schnurscheibe trägt. Diese
Spindel sitzt mit ihren Lagerdocken auf der Platte des
Arbeitstisch.es so auf, daß ihre Langsachse parallel zu
dem Arbeitenden gerichtet ist. Sie wird durch ein I ret-
rad in rasche Bewegung versetzt, so wie wir es beim
Scherenschleiferkasten oder der Nähmaschine kennen.
Die Spindel oder Welle ist in der Richtung ihrer Längs-
achse vorne entweder konisch ausgebohrt oder mit
einer Schraubengewinde-Bohrung versehen, um die
eigentlichen Schleifwerkzeuge auch Zeiger genannt,
aufzunehmen. Diese Werkzeuge bestehen aus einem
runden Stift aus weichem Schmiedeeisen oder Kupfer
und sind entweder durch einen aus Schnelloth ange-
gossenen Zapfen oder durch ein Gewinde genau zen-
454
können wir nun sowohl an dem Bohrkopf, wie innen
an dem angebohrten Gefäß, die Rillen der Bohr-
und Schleifwirkung sehen. Bei den Ausgrabungen
in Tell el Amarna fand man im Atelier Oberbild-
hauers Tutmes nebst Bronzemeißeln und anderem Ge-
rät ein überaus interessantes und lehrreicbes Stück
Bildhauerarbeit auf. Es ist die in Obsidian ambos-
sierte Gruppe eines s'itzenden Figurenpaares. Deut-
lich ist sogar für jeden intelligenten Laien ersichtlich,
wie hier, nur durch Sclilag- und Sprengwirkung, die na-
türlich auf einer eminenten Sicherheit beruht, die un-
gefähre, aber doch schon unverkennbare Form des
künftigen Kunstwerkes aus dem Block geholt ist. Es
wird wohl jedem denkenden Menschen klar sein, daß es
ein lächerliches Flnterfangen wäre, mit Bronzemeißeln,
wie den aufgefundenen, und wären sie noch so gut ge-
härtet ein Material von der Härte des Obsidians aus-
arbeiten zu wollen, an dem selbst unsere modernen
Edelstähle sofort versagen würden. Es ist nur ein
Weg möglich, auf dem ein Werk aus diesem Materiai
dann weiter ausgearbeitet und mit jener Perfektion
vollendet werden konnte, wie ihn ein in gleichem Ma-
terial gearbeiteter Porträtkopf eines Königs im selben
Museum zeigt, nämlich nur durcli Bohr- und Schleif-
technik, zu der als Letztes eine grandiose Politur kam.
In einem Steinbruch Oberägyptens bei Assuan befindet
sich lieute noch ein riesiger Obelisk, der von drei Seiten
vollkommen ausgearbeitet, mit der Rückwand aber
erst halb abgeschnitten, noch an dem Muttergestein
haftet. Als man neuerdings den angehäuften Scliutt
abräumte, fand man um seine Basis herumiiegend eine
Reilie von großen Kugeln aus einem äußerst harten
und zugleich zähen Steinmaterial, deren Zweck zu-
nächst rätselhaft erschien, und erst jetzt richtig gedeu-
tet wird. Sie dienten den Bildhauern zum Anpochen
und Zermürben des außerordentlich harten Porphyrs.
War der Stein an der Oberfläche in seinem Molekular-
zusammenhang erschüttert und zermürbt, dann konnte
er mit schweren Pinkhämmern leicht weiter angehauen
werden. Durch Reihen von Bohrlöchern mit Holzkeilen
wurden größere Partien abgesprengt und dann, bis zur
letzten Perfektion, die Bohr- und Schleiftechnik ange-
wendet, die allein die oft haarscharf und minutiösest an-
geführten Hieroglyphenbilder möglich machen konnte.
So könnte man wohl nicht zu unrecht alle derartigen
Werke in solch harten Gesteinen als Produkte einer
eben nur in kolossalen Dimensionen geübten Stein-
schneidekunst ansehen, denn der technische Vorgang
ist genau derselbe, wie er zur Herstellung der Tausende
von präziösen Rundfigürchen aus allen möglichen Halb-
edelsteinen, wie Carneol, Ametyst, Calcedon, Lapis,
etc. angewendet wurde, die als Amulette oder reiner
Schmuck dienten.
Das speziell für die Werke der Kleinkunst vervoll-
kommnete Werkzeug, das sogenannte Steinschneide-
rad, ist, wie man heute allgemein annimmt, eine Erfin-
dung Mesopotamiens, und dieser Erfindung verdanken
wir erst die souveräne Entwicklung jener wunderbaren
Kleinkunst, die unter dem Namen „Glyptik“ (vom Grie-
chischen ikj-tak graben, gravieren) alle Arbeiten der
Steinschneidekunst, sowohi vertieft, als erhaben, in
Halb- und Ganz-Edelsteinen umfaßt. Ihre Anfänge
reichen, wie wir gesehen haben, bis in die graueste
Vorzeit, ja bis in die Kindheit des Menschengeschlechtes
zurück. Sie begleitete die Menschheit durch die Jahr-
tausende hindurch durch alle Phasen der Kultur und
Kunstentwicklung und blühte in deren Glanzperiode bei
allen Kulturvölkern des Erdballs.
Ihre höchste künstlerische Entwickfung erreichte
sie aber in der sogenannten hellenistischen Periode, das
ist die Zeit vom Alexanderzuge bis gegen das erste
nachchristliche Jahrhundert, als nämlich aus dem inne-
ren Orient ungeheure Mengen von Halb- und Ganz-
Edelsteinen aller Arten in die Mittelmeerländer, beson-
ders nach Syrien un-d Alexandrien, kamen, wo die
Prachtliebe der Ptolemäer und Seleuciden dann jene
Wunderwerke der Glyptik, die großen Prachtkamäen
Aegyptische Abteilung der Staatlichen Museen Berlin
mit den Bildnissen hellenistischer Fürsten (siehe Cameo
Gonzarga) und die wunderbaren, aus einem einzigen
Stück Sardonyx gearbeiteten Prunkgefäße (Tazza Far-
nese) entstehen ließ.
Betrachten wir nun das eigentliche Werkzeug des
Glyptikers, und wir werden erstaunt sein, wie einfacli
es ist. Das Werkzeug, wie es heute noch von den Stein-
schneidern unserer Zeit verwendet wird, erscheint be-
reits voll ausgebildet in dem Ständebuch des Jost Am-
man (1568). Es ist eine Spindol von etwa 12
bis 15 cm Länge aus Eisen oder weichem Stahl, die in
zwei Lagern läuft und eine Schnurscheibe trägt. Diese
Spindel sitzt mit ihren Lagerdocken auf der Platte des
Arbeitstisch.es so auf, daß ihre Langsachse parallel zu
dem Arbeitenden gerichtet ist. Sie wird durch ein I ret-
rad in rasche Bewegung versetzt, so wie wir es beim
Scherenschleiferkasten oder der Nähmaschine kennen.
Die Spindel oder Welle ist in der Richtung ihrer Längs-
achse vorne entweder konisch ausgebohrt oder mit
einer Schraubengewinde-Bohrung versehen, um die
eigentlichen Schleifwerkzeuge auch Zeiger genannt,
aufzunehmen. Diese Werkzeuge bestehen aus einem
runden Stift aus weichem Schmiedeeisen oder Kupfer
und sind entweder durch einen aus Schnelloth ange-
gossenen Zapfen oder durch ein Gewinde genau zen-
454