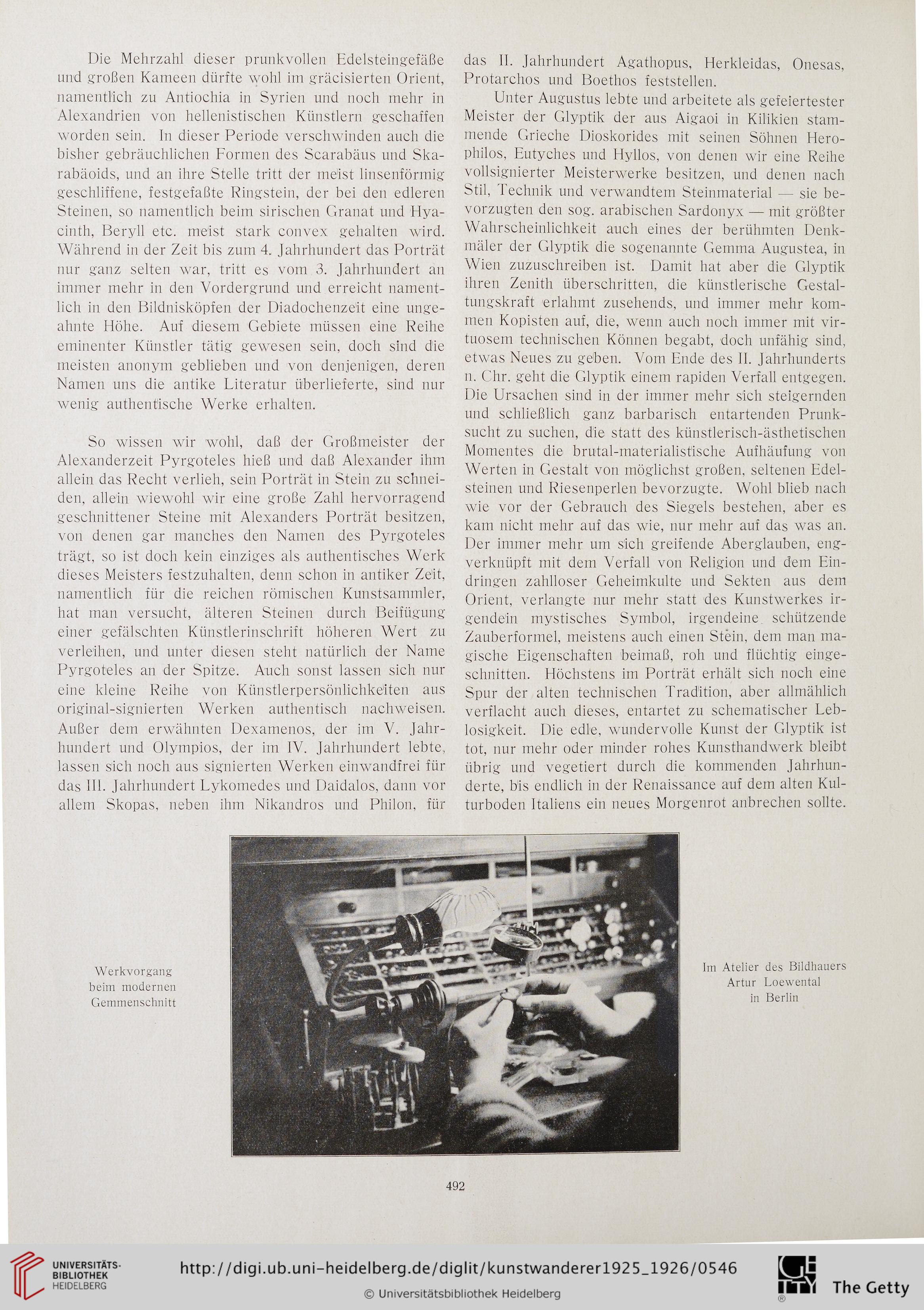Die Mehrzahl dieser prunkvollen Edelsteingefäße
und großen Kameen dürfte wohl im gräcisierten Or'ient,
namentiich zu Antiochia in Syrien und noch mehr in
Alexandrien von hellenistischen Künstlern geschaffen
worden sein. In dieser Periode verschwinden auch die
bisher gebräuchlichen Formen des Scarabäus und Ska-
rabäoids, und an ihre Stelle tritt der meist linsenförmig
geschliffene, festgefaßte Ringstein, der bei den edleren
Steinen, so namentlich beim sirischen Granat und Hya-
cinth, Beryll etc. meist stark convex gehalten wird.
Während in der Zeit bis zum 4. Jahrhundert das Porträt
nur ganz selten war, tritt es vom 3. Jahrhundert an
immer mehr in den Vordergrund und erreicht nament-
lich in den Bildnisköpfen der Diadochenze'it eine unge-
ahnte Höhe. Auf diesem Gebiete müssen eine Reihe
eminenter Ktinstler tätig gewesen sein, doch sind die
meisten anonyin geblieben und von denjenigen, deren
Namen uns die antike Literatur überlieferte, sind nur
wenig authent’ische Werke erhalten.
So wissen wir wohl, daß der Großmeister der
Alexanderzeit Pyrgoteles hieß und daß Alexander ihm
allein das Recht verlieh, sein Porträt in Stein zu schnei-
den, allein wiewohl wir eine große Zahl hervorragend
geschnittener Steine mit Alexanders Porträt besitzen,
von denen gar manches den Namen des Pyrgoteles
trägt, so ist doch kein einziges als authentisches Werk
dieses Meisters festzuhalten, denn schon in antiker Ze’it,
namentlich für die reichen römischen Kunstsammler,
hat man versucht, älteren Steinen durch Beifügung
einer gefälschten Künstlerinschrift höheren Wert zu
verleihen, und unter diesen steht natürlich der Name
Pyrgoteles an der Spitze. Auch sonst lassen sich nur
eine kleine Reihe von Künstlerpersönlichkeiten aus
original-signierten Werken authentisch nachweisen.
Außer dem erwähnten Dexamenos, der im V. Jahr-
hundert und Olympios, der im IV. Jahrhundert lebte,
lassen sich noch aus signierten Werken einwandfrei für
das III. Jahrhundert Lykomedes und Daidalos, dann vor
allem Skopas, neben ihm Nikandros und Philon, für
das II. Jahrhundert Agathopus, Herkleidas, Onesas,
Protarchos und Boethos feststellen.
Unter Augustus lebte und arbeitete als gefeiertester
Meister der Glyptik der aus Aigaoi in Kilikien stam-
mende Grieche Dioskorides mit seinen Söhnen Hero-
philos, Eutyches und Hyllos, von denen wir eine Reihe
vollsignierter Meisterwerke besitzen, und denen nach
Stil, Technik und verwandtem Steinmaterial — sie be-
vorzugten den sog. arabischen Sardonyx — mit größter
Wahrscheinlichkeit auch eines der berühmten Denk-
mäler der Glyptik die sogenannte Gemma Augustea, in
Wien zuzuschreiben ist. Damit hat aber die Glyptik
ihren Zenith überschritten, die künstlerische Gestal-
tungskraft erlahmt zusehends, und immer mehr kom-
men Kopisten auf, die, wenn auch noch immer mit vir-
tuosem technischen Können begabt, doch unfähig sind,
etwas Neues zu geben. Vom Ende des II. Jahrhunderts
n. Chr. geht die Glyptik einem rapiden Verfall entgegen.
Die Ursachen sind in der immer mehr sich steigernden
und schließlich ganz barbarisch entartenden Prunk-
sucht zu suchen, die statt des künstlerisch-ästhetischen
Momentes die brutal-materialistische Aufhäufung von
Werten in Gestalt von möglichst großen, seltenen Edel-
steinen und Riesenperlen bevorzugte. Wohl blieb nach
wie vor der Gebrauch des Siegels bestehen, aber es
kam nicht mehr auf das wie, nur mehr auf das was an.
Der immer mehr um s'ich greifende Aberglauben, eng-
verknüpft mit dem Verfall von Religion und dem Ein-
dringen zahlloser Geheimkulte und Sekten aus dem
Orient, verlangte nur mehr statt 'des Kunstwerkes ir-
gendein mystisches Symbol, irgendeine schützende
Zauberformel, meistens auch einen Stein, dem man ma-
gische Eigenschaften beimaß, roh und flüchtig einge-
schnitten. Höchstens im Porträt erhält sich noch eine
Spur der alten technischen Tradition, aber allmählich
verflacht auch dieses, entartet zu schematischer Leb-
losigkeit. Die edle, wundervolle Kunst der Glyptik ist
tot, nur mehr oder minder rohes Kunsthandwerk bleibt
übrig und vegetiert durch die kommenden Jahrhun-
derte, bis endlich in der Renaissance auf dem alten Kul-
turboden Italiens ein neues Morgenrot anbrechen sollte.
Werkvorgang
beim modernen
Gemmenschnitt
Im Atelier des Bildhauers
Artur Loewental
in Berlin
492
und großen Kameen dürfte wohl im gräcisierten Or'ient,
namentiich zu Antiochia in Syrien und noch mehr in
Alexandrien von hellenistischen Künstlern geschaffen
worden sein. In dieser Periode verschwinden auch die
bisher gebräuchlichen Formen des Scarabäus und Ska-
rabäoids, und an ihre Stelle tritt der meist linsenförmig
geschliffene, festgefaßte Ringstein, der bei den edleren
Steinen, so namentlich beim sirischen Granat und Hya-
cinth, Beryll etc. meist stark convex gehalten wird.
Während in der Zeit bis zum 4. Jahrhundert das Porträt
nur ganz selten war, tritt es vom 3. Jahrhundert an
immer mehr in den Vordergrund und erreicht nament-
lich in den Bildnisköpfen der Diadochenze'it eine unge-
ahnte Höhe. Auf diesem Gebiete müssen eine Reihe
eminenter Ktinstler tätig gewesen sein, doch sind die
meisten anonyin geblieben und von denjenigen, deren
Namen uns die antike Literatur überlieferte, sind nur
wenig authent’ische Werke erhalten.
So wissen wir wohl, daß der Großmeister der
Alexanderzeit Pyrgoteles hieß und daß Alexander ihm
allein das Recht verlieh, sein Porträt in Stein zu schnei-
den, allein wiewohl wir eine große Zahl hervorragend
geschnittener Steine mit Alexanders Porträt besitzen,
von denen gar manches den Namen des Pyrgoteles
trägt, so ist doch kein einziges als authentisches Werk
dieses Meisters festzuhalten, denn schon in antiker Ze’it,
namentlich für die reichen römischen Kunstsammler,
hat man versucht, älteren Steinen durch Beifügung
einer gefälschten Künstlerinschrift höheren Wert zu
verleihen, und unter diesen steht natürlich der Name
Pyrgoteles an der Spitze. Auch sonst lassen sich nur
eine kleine Reihe von Künstlerpersönlichkeiten aus
original-signierten Werken authentisch nachweisen.
Außer dem erwähnten Dexamenos, der im V. Jahr-
hundert und Olympios, der im IV. Jahrhundert lebte,
lassen sich noch aus signierten Werken einwandfrei für
das III. Jahrhundert Lykomedes und Daidalos, dann vor
allem Skopas, neben ihm Nikandros und Philon, für
das II. Jahrhundert Agathopus, Herkleidas, Onesas,
Protarchos und Boethos feststellen.
Unter Augustus lebte und arbeitete als gefeiertester
Meister der Glyptik der aus Aigaoi in Kilikien stam-
mende Grieche Dioskorides mit seinen Söhnen Hero-
philos, Eutyches und Hyllos, von denen wir eine Reihe
vollsignierter Meisterwerke besitzen, und denen nach
Stil, Technik und verwandtem Steinmaterial — sie be-
vorzugten den sog. arabischen Sardonyx — mit größter
Wahrscheinlichkeit auch eines der berühmten Denk-
mäler der Glyptik die sogenannte Gemma Augustea, in
Wien zuzuschreiben ist. Damit hat aber die Glyptik
ihren Zenith überschritten, die künstlerische Gestal-
tungskraft erlahmt zusehends, und immer mehr kom-
men Kopisten auf, die, wenn auch noch immer mit vir-
tuosem technischen Können begabt, doch unfähig sind,
etwas Neues zu geben. Vom Ende des II. Jahrhunderts
n. Chr. geht die Glyptik einem rapiden Verfall entgegen.
Die Ursachen sind in der immer mehr sich steigernden
und schließlich ganz barbarisch entartenden Prunk-
sucht zu suchen, die statt des künstlerisch-ästhetischen
Momentes die brutal-materialistische Aufhäufung von
Werten in Gestalt von möglichst großen, seltenen Edel-
steinen und Riesenperlen bevorzugte. Wohl blieb nach
wie vor der Gebrauch des Siegels bestehen, aber es
kam nicht mehr auf das wie, nur mehr auf das was an.
Der immer mehr um s'ich greifende Aberglauben, eng-
verknüpft mit dem Verfall von Religion und dem Ein-
dringen zahlloser Geheimkulte und Sekten aus dem
Orient, verlangte nur mehr statt 'des Kunstwerkes ir-
gendein mystisches Symbol, irgendeine schützende
Zauberformel, meistens auch einen Stein, dem man ma-
gische Eigenschaften beimaß, roh und flüchtig einge-
schnitten. Höchstens im Porträt erhält sich noch eine
Spur der alten technischen Tradition, aber allmählich
verflacht auch dieses, entartet zu schematischer Leb-
losigkeit. Die edle, wundervolle Kunst der Glyptik ist
tot, nur mehr oder minder rohes Kunsthandwerk bleibt
übrig und vegetiert durch die kommenden Jahrhun-
derte, bis endlich in der Renaissance auf dem alten Kul-
turboden Italiens ein neues Morgenrot anbrechen sollte.
Werkvorgang
beim modernen
Gemmenschnitt
Im Atelier des Bildhauers
Artur Loewental
in Berlin
492