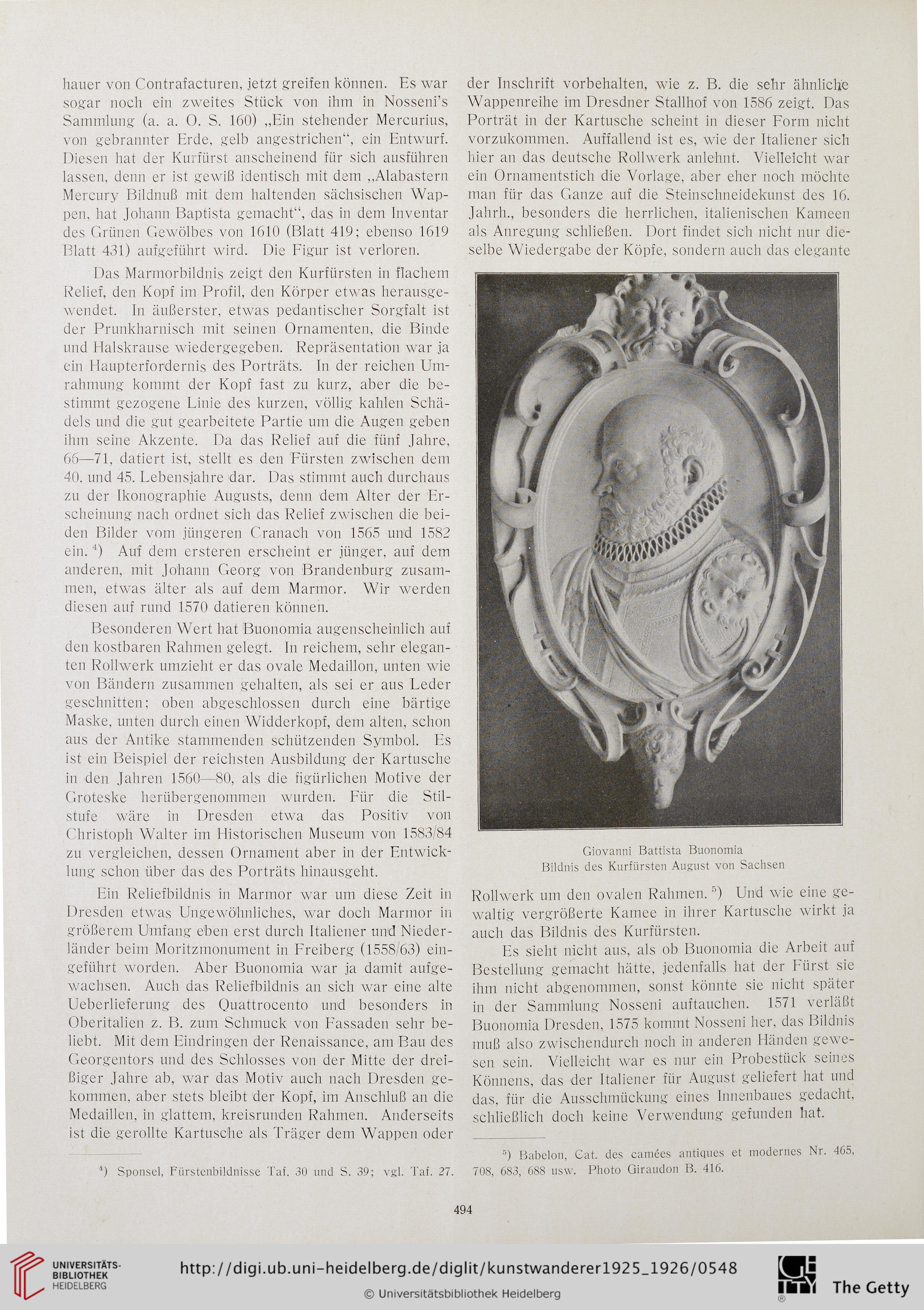hauer von Contrafacturen, jetzt greifen können. Es war
sogar noch ein zweites Stück von ihm in Nosseni’s
Sammlung (a. a. 0. S. 160) „Ein stehender Mercurius,
von gebrannter Erde, gelb angestrichen“, ein Entwurf.
Diesen hat der Kurfürst anscheinend für sich ausführen
lassen, denn er ist gewiß identisch mit dem „Alabastern
Mercury Bildnuß mit dem haltenden sächsischen Wap-
pen, hat Johann Baptista gemacht“, das in dem Inventar
des Grünen Gewölbes von 1610 (Blatt 419; ebenso 1619
Blatt 431) aufgeführt wird. Die Figur ist verloren.
Das Marmorbildnis zeigt den Kurfürsten in flachem
Relief, den Kopf im Profil, den Körper etwas herausge-
wendet. In äußerster, etwas pedantischer Sorgfalt ist
der Prunkharnisch mit seinen Ornamenten, die Binde
und Halskrause wiedergegeben. Repräsentation war ja
ein Haupterfordernis des Porträts. In der reichen Um-
rahmung kommt der Kopf fast zu kurz, aber die be-
stimmt gezogene Linie des kurzen, völlig kahlen Schä-
dels und die gut gearbeitete Partie um die Augen geben
ihm seine Akzente. Da das Relief auf die fünf Jahre,
66—71, datiert ist, stellt es den Fürsten zwischen dem
40. und 45. Lebensjahre dar. Das stimmt auch durchaus
zu der Ikonographie Augusts, denn dem Alter der Er-
scheinung nach ordnet sich das Relief zwischen die bei-
den Bilder vom jüngeren Cranach von 1565 und 1582
ein. 4) Auf dem ersteren erscheint er jünger, auf dem
anderen, mit Jo'hann Georg von Brandenburg zusam-
men, etwas äjter als auf dem Marmor. Wir werden
diesen auf rund 1570 datieren können.
Besonderen Wert hat Buonomia augenscheinlich auf
den kostbaren Rahmen gelegt. In reichem, sehr elegan-
ten Rollwerk umzieht er das ovale Medaillon, unten wie
von Bändern zusammen gehalten, als sei er aus Leder
geschnitten; oben abgeschlossen durch eine bärtige
Maske, unten durch einen Widderkopf, dem alten, schon
aus der Antike stammenden schützenden Symbol. Es
ist ein Beispiel der reichsten Ausbildung der Kartusche
in den Jahren 1560—80, als die figürlichen Motive der
Groteske herübergenommen wurden. Für die Stil-
stufe wäre in Dresden etwa das Positiv von
Christoph Walter im Historischen Museum von 1583/84
zu vergleichen, dessen Ornament aber in der Entwick-
lung schon über das des Porträts hinausgeht.
Ein Reliefbildnis in Marmor war um diese Zeit in
Dresden etwas Ungewöhnliches, war docli Marmor in
größerem Umfang e'ben erst durch Italiener und Nieder-
länder beim Moritzmonument in Freiberg (1558/63) ein-
geftihrt worden. Aber Buonomia war ja damit aufge-
wachsen. Auch das Reliefbildnis an sich war eine alte
Ueberlieferung des Quattrocento und besonders in
Oberitalien z. B. zum Schmuck von Eassaden sehr be-
liebt. Mit dem Eindringen der Renaissance, am Bau des
Georgentors uud des Schlosses von der Mitte der drei-
ßiger Jahre ab, war das Motiv auch nacli Dresden ge-
kommen, aber stets bleibt der Kopf, im Anschluß an die
Medaillen, in glattem, kreisrunden Rahmen. Anderseits
ist die gerollte Kartusche als Träger dem Wappen oder
4) Sponsel, Fürstenbildnisse Taf. 30 und S. 39; vgl. Taf. 27.
der Inschrift vorbehalten, wie z. B. die sehr ähnlich'e
Wappenreihe im Dresdner Stallhof von 1586 zeigt. Das
Porträt in der Kartusche scheint in dieser Form nicht
vorzukommen. Auffallend ist es, wie der Italiener sich
hier an das deutsche Rollwerk anlehnt. Vielleicht war
ein Ornamentstich die Vorlage, aber eher noch möchte
man für das Ganze auf die Steinschneidekunst des 16.
Jahrh., besonders die herrlichen, italienischen Kameen
als Anregung schließen. Dort findet sich nicht nur die-
selbe Wiedergabe der Köpfe, sondern auch das elegante
Giovanni Battista Buonomia
Bildnis des Kurfürsten August von Sachsen
Rollwerk um den ovalen Rahmen. 0 Un'd wie eine ge-
waltig vergrößerte Kamee in ihrer Kartusche wirkt ja
auch das Bildnis des Kurfürsten.
Es sieht nicht aus, als ob Buonomia die Arbeit auf
Bestellung gemacht hätte, jedenfalls hat der Fürst sie
ihm nicht abgenommen, sonst könnte sie nicht später
in der Sammlung Nosseni auftauchen. 1571 verläßt
Buonomia Dresden, 1575 kommt Nosseni her, das Bildnis
muß also zwischendurch noch in anderen Händen gewe-
sen sein. Vielleicht war es nur ein Probestück seines
Könnens, das der Italiener für August geliefert hat und
das, für die Aussclunückung eines Innenbaues gedacht,
schließlich doch keine Verwendung gefunden hat.
5) Babelon, Gat. des camees antiques et modernes Nr. 465,
708, 683, 688 usw. Photo Giraudon B. 416.
494
sogar noch ein zweites Stück von ihm in Nosseni’s
Sammlung (a. a. 0. S. 160) „Ein stehender Mercurius,
von gebrannter Erde, gelb angestrichen“, ein Entwurf.
Diesen hat der Kurfürst anscheinend für sich ausführen
lassen, denn er ist gewiß identisch mit dem „Alabastern
Mercury Bildnuß mit dem haltenden sächsischen Wap-
pen, hat Johann Baptista gemacht“, das in dem Inventar
des Grünen Gewölbes von 1610 (Blatt 419; ebenso 1619
Blatt 431) aufgeführt wird. Die Figur ist verloren.
Das Marmorbildnis zeigt den Kurfürsten in flachem
Relief, den Kopf im Profil, den Körper etwas herausge-
wendet. In äußerster, etwas pedantischer Sorgfalt ist
der Prunkharnisch mit seinen Ornamenten, die Binde
und Halskrause wiedergegeben. Repräsentation war ja
ein Haupterfordernis des Porträts. In der reichen Um-
rahmung kommt der Kopf fast zu kurz, aber die be-
stimmt gezogene Linie des kurzen, völlig kahlen Schä-
dels und die gut gearbeitete Partie um die Augen geben
ihm seine Akzente. Da das Relief auf die fünf Jahre,
66—71, datiert ist, stellt es den Fürsten zwischen dem
40. und 45. Lebensjahre dar. Das stimmt auch durchaus
zu der Ikonographie Augusts, denn dem Alter der Er-
scheinung nach ordnet sich das Relief zwischen die bei-
den Bilder vom jüngeren Cranach von 1565 und 1582
ein. 4) Auf dem ersteren erscheint er jünger, auf dem
anderen, mit Jo'hann Georg von Brandenburg zusam-
men, etwas äjter als auf dem Marmor. Wir werden
diesen auf rund 1570 datieren können.
Besonderen Wert hat Buonomia augenscheinlich auf
den kostbaren Rahmen gelegt. In reichem, sehr elegan-
ten Rollwerk umzieht er das ovale Medaillon, unten wie
von Bändern zusammen gehalten, als sei er aus Leder
geschnitten; oben abgeschlossen durch eine bärtige
Maske, unten durch einen Widderkopf, dem alten, schon
aus der Antike stammenden schützenden Symbol. Es
ist ein Beispiel der reichsten Ausbildung der Kartusche
in den Jahren 1560—80, als die figürlichen Motive der
Groteske herübergenommen wurden. Für die Stil-
stufe wäre in Dresden etwa das Positiv von
Christoph Walter im Historischen Museum von 1583/84
zu vergleichen, dessen Ornament aber in der Entwick-
lung schon über das des Porträts hinausgeht.
Ein Reliefbildnis in Marmor war um diese Zeit in
Dresden etwas Ungewöhnliches, war docli Marmor in
größerem Umfang e'ben erst durch Italiener und Nieder-
länder beim Moritzmonument in Freiberg (1558/63) ein-
geftihrt worden. Aber Buonomia war ja damit aufge-
wachsen. Auch das Reliefbildnis an sich war eine alte
Ueberlieferung des Quattrocento und besonders in
Oberitalien z. B. zum Schmuck von Eassaden sehr be-
liebt. Mit dem Eindringen der Renaissance, am Bau des
Georgentors uud des Schlosses von der Mitte der drei-
ßiger Jahre ab, war das Motiv auch nacli Dresden ge-
kommen, aber stets bleibt der Kopf, im Anschluß an die
Medaillen, in glattem, kreisrunden Rahmen. Anderseits
ist die gerollte Kartusche als Träger dem Wappen oder
4) Sponsel, Fürstenbildnisse Taf. 30 und S. 39; vgl. Taf. 27.
der Inschrift vorbehalten, wie z. B. die sehr ähnlich'e
Wappenreihe im Dresdner Stallhof von 1586 zeigt. Das
Porträt in der Kartusche scheint in dieser Form nicht
vorzukommen. Auffallend ist es, wie der Italiener sich
hier an das deutsche Rollwerk anlehnt. Vielleicht war
ein Ornamentstich die Vorlage, aber eher noch möchte
man für das Ganze auf die Steinschneidekunst des 16.
Jahrh., besonders die herrlichen, italienischen Kameen
als Anregung schließen. Dort findet sich nicht nur die-
selbe Wiedergabe der Köpfe, sondern auch das elegante
Giovanni Battista Buonomia
Bildnis des Kurfürsten August von Sachsen
Rollwerk um den ovalen Rahmen. 0 Un'd wie eine ge-
waltig vergrößerte Kamee in ihrer Kartusche wirkt ja
auch das Bildnis des Kurfürsten.
Es sieht nicht aus, als ob Buonomia die Arbeit auf
Bestellung gemacht hätte, jedenfalls hat der Fürst sie
ihm nicht abgenommen, sonst könnte sie nicht später
in der Sammlung Nosseni auftauchen. 1571 verläßt
Buonomia Dresden, 1575 kommt Nosseni her, das Bildnis
muß also zwischendurch noch in anderen Händen gewe-
sen sein. Vielleicht war es nur ein Probestück seines
Könnens, das der Italiener für August geliefert hat und
das, für die Aussclunückung eines Innenbaues gedacht,
schließlich doch keine Verwendung gefunden hat.
5) Babelon, Gat. des camees antiques et modernes Nr. 465,
708, 683, 688 usw. Photo Giraudon B. 416.
494