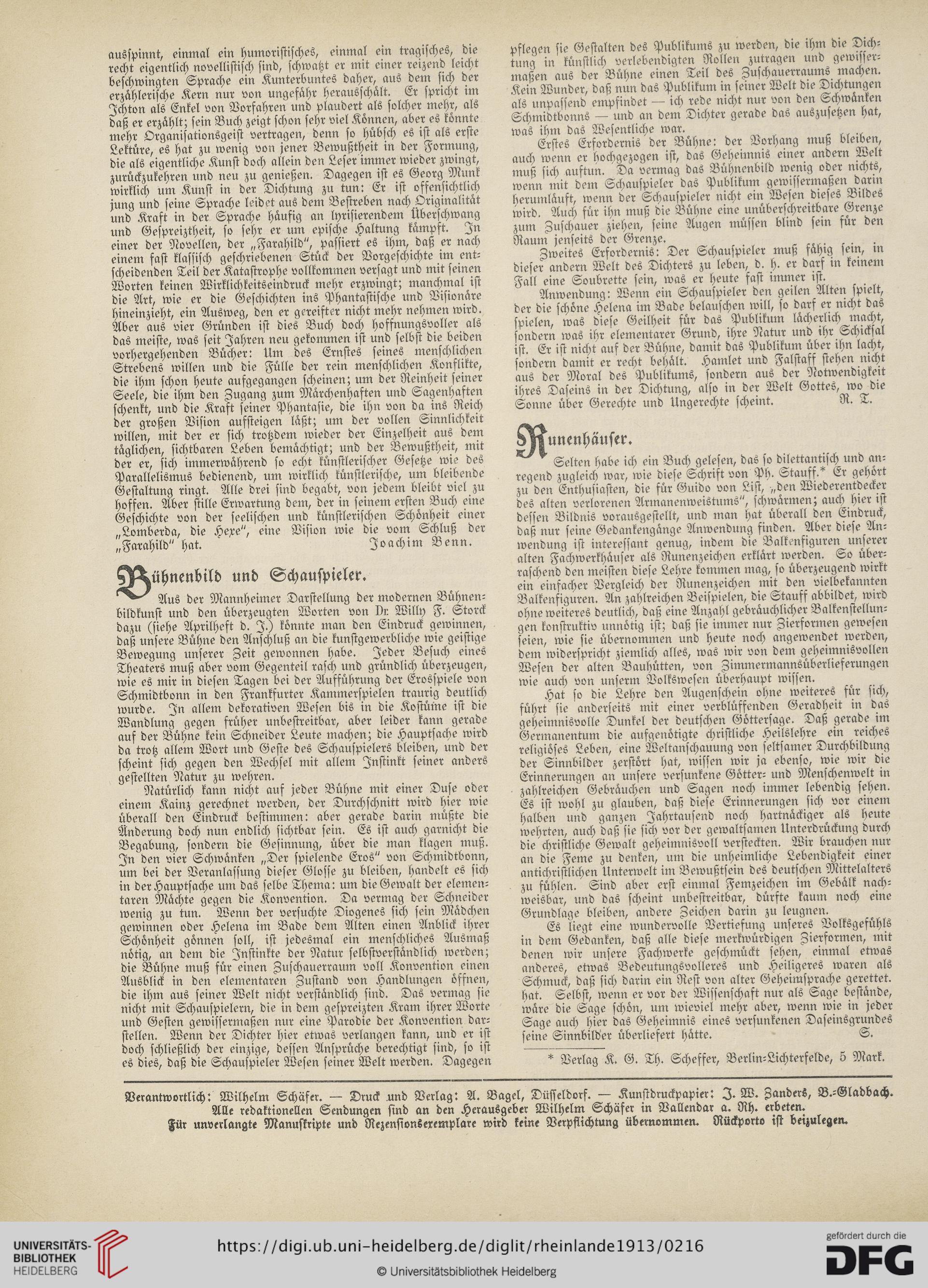ausspinnt, einmal ein humoristisches, einmal ein tragisches, die
recht eigentlich novellistisch sind, schwatzt er mit einer reizend leicht
beschwingten Sprache ein Kunterbuntes daher, aus dem sich der
erzählerische Kern nur von ungefähr herausschält. Er spricht im
Ichton als Enkel von Vorfahren und plaudert als solcher mehr, als
daß er erzählt; sein Buch zeigt schon sehr viel Können, aber es könnte
mehr Organisationsgeist vertragen, denn so hübsch es ist als erste
Lektüre, es hat zu wenig von jener Bewußtheit in der Formung,
die als eigentliche Kunst doch allein den Leser immer wieder zwingt,
zurückzukehren und neu zu genießen. Dagegen ist es Georg Munk
wirklich um Kunst in der Dichtung zu tun: Er ist offensichtlich
jung und seine Sprache leidet aus dem Bestreben nach Originalität
und Kraft in der Sprache häufig an lyrisierendem Überschwang
und Gespreiztheit, so sehr er um epische Haltung kämpft. In
einer der Novellen, der „Farahild", passiert es ihm, daß er nach
einem fast klassisch geschriebenen Stück der Vorgeschichte im ent:
scheidenden Teil der Katastrophe vollkommen versagt und mit seinen
Worten keinen Wirklichkeitseindruck mehr erzwingt; manchmal ist
die Art, wie er die Geschichten ins Phantastische und Visionäre
hineinzieht, ein Ausweg, den er gereifter nicht mehr nehmen wird.
Aber aus vier Gründen ist dies Buch doch hoffnungsvoller als
das meiste, was seit Jahren neu gekommen ist und selbst die beiden
vorhergehenden Bücher: Um des Ernstes seines menschlichen
Strebens willen und die Fülle der rein menschlichen Konflikte,
die ihm schon heute aufgegangen scheinen; um der Reinheit seiner
Seele, die ihm den Zugang zum Märchenhaften und Sagenhaften
schenkt, und die Kraft seiner Phantasie, die ihn von da ins Reich
der großen Vision aufsteigen läßt; um der vollen Sinnlichkeit
willen, mit der er sich trotzdem wieder der Einzelheit aus dem
täglichen, sichtbaren Leben bemächtigt; und der Bewußtheit, mit
der er, sich immerwährend so echt künstlerischer Gesetze wie des
Parallelismus bedienend, um wirklich künstlerische, um bleibende
Gestaltung ringt. Alle drei sind begabt, von jedem bleibt viel zu
hoffen. Aber stille Erwartung dem, der in seinem ersten Buch eine
Geschichte von der seelischen und künstlerischen Schönheit einer
„Lomberda, die Hexe", eine Vision wie die vom Schluß der
„Farahild" hat. Joachim Benn.
ühnenbild und Schauspieler.
Aus der Mannheimer Darstellung der modernen Bühnen-
bildkunst und den überzeugten Worten von üi: Willy F. Storck
dazu (siehe Aprilheft d. I.) könnte man den Eindruck gewinnen,
daß unsere Bühne den Anschluß an die kunstgewerbliche wie geistige
Bewegung unserer Zeit gewonnen habe. Jeder Besuch eines
Theaters muß aber vom Gegenteil rasch und gründlich überzeugen,
wie es mir in diesen Tagen bei der Aufführung der Erosspiele von
Schmidtbonn in den Frankfurter Kammerspielen traurig deutlich
wurde. In allem dekorativen Wesen bis in die Kostüme ist die
Wandlung gegen früher unbestreitbar, aber leider kann gerade
auf der Bühne kein Schneider Leute machen; die Hauptsache wird
da trotz allem Wort und Geste des Schauspielers bleiben, und der
scheint sich gegen den Wechsel mit allem Instinkt seiner anders
gestellten Natur zu wehren.
Natürlich kann nicht auf jeder Bühne mit einer Düse oder
einem Kainz gerechnet werden, der Durchschnitt wird hier wie
überall den Eindruck bestimmen: aber gerade darin müßte die
Änderung doch nun endlich sichtbar sein. Es ist auch garnicht die
Begabung, sondern die Gesinnung, über die man klagen muß.
In den vier Schwänken „Der spielende Eros" von Schmidtbonn,
um bei der Veranlassung dieser Glosse zu bleiben, handelt es sich
in der Hauptsache um das selbe Thema: um die Gewalt der elemen-
taren Mächte gegen die Konvention. Da vermag der Schneider
wenig zu tun. Wenn der versuchte Diogenes sich sein Mädchen
gewinnen oder Helena im Bade dem Alten einen Anblick ihrer
Schönheit gönnen soll, ist jedesmal ein menschliches Ausmaß
nötig, an dem die Instinkte der Natur selbstverständlich werden;
die Bühne muß für einen Zuschauerraum voll Konvention einen
Ausblick in den elementaren Zustand von Handlungen öffnen,
die ihm aus seiner Welt nicht verständlich sind. Das vermag sie
nicht mit Schauspielern, die in dem gespreizten Kram ihrer Worte
und Gesten gewissermaßen nur eine Parodie der Konvention dar-
stellen. Wenn der Dichter hier etwas verlangen kann, und er ist
doch schließlich der einzige, dessen Ansprüche berechtigt sind, so ist
es dies, daß die Schauspieler Wesen seiner Welt werden. Dagegen
pflegen sie Gestalten des Publikums zu werden, die ihm die Dich-
tung in künstlich verlebendigten Rollen zutragen und gewisser-
maßen aus der Bühne einen Teil des Zuschauerraums machen.
Kein Wunder, daß nun das Publikum in seiner Welt die Dichtungen
als unpassend empfindet — ich rede nicht nur von den Schwänken
Schmidtbonns — und an dem Dichter gerade das auszusetzen hat,
was ihm das Wesentliche war.
Erstes Erfordernis der Bühne: der Vorhang muß bleiben,
auch wenn er hochgezogen ist, das Geheimnis einer andern Welt
muß sich auftun. Da vermag das Bühnenbild wenig oder nichts,
wenn mit dem Schauspieler das Publikum gewissermaßen darin
herumläuft, wenn der Schauspieler nicht ein Wesen dieses Bildes
wird. Auch für ihn muß die Bühne eine unüberschreitbare Grenze
zum Zuschauer ziehen, seine Augen müssen blind sein für den
Raum jenseits der Grenze.
Zweites Erfordernis: Der Schauspieler muß fähig sein, in
dieser andern Welt des Dichters zu leben, d. h. er darf in keinem
Fall eine Soubrette sein, was er heute fast immer ist.
Anwendung: Wenn ein Schauspieler den geilen Alten spielt,
der die schöne Helena im Bade belauschen will, so darf er nicht das
spielen, was diese Geilheit für das Publikum lächerlich macht,
sondern was ihr elementarer Grund, ihre Natur und ihr Schicksal
ist. Er ist nicht auf der Bühne, damit das Publikum über ihn lacht,
sondern damit er recht behält. Hamlet und Falstaff stehen nicht
aus der Moral des Publikums, sondern aus der Notwendigkeit
ihres Daseins in der Dichtung, also in der Welt Gottes, wo die
Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint. R. T.
§Kunenhäuser.
Selten habe ich ein Buch gelesen, das so dilettantisch und an-
regend zugleich war, wie diese Schrift von PH. Stauff.* Er gehört
zu den Enthusiasten, die für Guido von List, „den Wiederentdecker
des alten verlorenen Armanenweistums", schwärmen; auch hier ist
desseu Bildnis vorausgestellt, und man hat überall den Eindruck,
daß nur seine Gedankengänge Anwendung finden. Aber diese An-
wendung ist interessant genug, indem die Balkenfiguren unserer
alten Fachwerkhäuser als Runenzeichen erklärt werden. So über-
raschend den meisten diese Lehre kommen mag, so überzeugend wirkt
ein einfacher Vergleich der Runenzeichen mit den vielbekannten
Balkenfiguren. An zahlreichen Beispielen, die Stauff abbildet, wird
ohne weiteres deutlich, daß eine Anzahl gebräuchlicher Balkenstellun-
gen konstruktiv unuötig ist; daß sie immer nur Zierformen gewesen
seien, wie sie übernommen und heute noch angewendet werden,
dem widerspricht ziemlich alles, was wir von dem geheimnisvollen
Wesen der alten Bauhütten, von Zimmermannsüberlieferungen
wie auch von unserm Volkswesen überhaupt wissen.
Hat so die Lehre den Augenschein ohne weiteres für sich,
führt sie anderseits mit einer verblüffenden Geradheit in das
geheimnisvolle Dunkel der deutschen Göttersage. Daß gerade im
Germanentum die aufgenötigte christliche Heilslehre ein reiches
religiöses Leben, eine Weltanschauung von seltsamer Durchbildung
der Sinnbilder zerstört hat, wissen wir ja ebenso, wie wir die
Erinnerungen an unsere versunkene Götter- und Menschenwelt in
zahlreichen Gebräuchen und Sagen noch immer lebendig sehen.
Es ist wohl zu glauben, daß diese Erinnerungen sich vor einem
halben und ganzen Jahrtausend noch hartnäckiger als heute
wehrten, auch daß sie sich vor der gewaltsamen Unterdrückung durch
die christliche Gewalt geheimnisvoll versteckten. Wir brauchen nur
an die Feme zu denken, um die unheimliche Lebendigkeit einer
antichristlichen Unterwelt im Bewußtsein des deutschen Mittelalters
zu fühlen. Sind aber erst einmal Femzeichen im Gebälk nach-
weisbar, und das scheint unbestreitbar, dürfte kaum noch eine
Grundlage bleiben, andere Zeichen darin zu leugnen.
Es liegt eine wundervolle Vertiefung unseres Volksgefühls
in dem Gedanken, daß alle diese merkwürdigen Zierformen, mit
denen wir unsere Fachwerke geschmückt sehen, einmal etwas
anderes, etwas Bedeutungsvolleres und Heiligeres waren als
Schmuck, daß sich darin ein Rest von alter Geheimsprache gerettet,
hat. Selbst, wenn er vor der Wissenschaft nur als Sage bestände,
wäre die Sage schön, um wieviel mehr aber, wenn wie in jeder
Sage auch hier das Geheimnis eines versunkenen Daseinsgrundes
seine Sinnbilder überliefert hätte. S.
* Verlag K. G. Th. Scheffer, Berlin-Lichterfelde, 5 Mark.
Verantwortlich: Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düffeldorf. — Kunftdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Nh. erbeten.
Für unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.
recht eigentlich novellistisch sind, schwatzt er mit einer reizend leicht
beschwingten Sprache ein Kunterbuntes daher, aus dem sich der
erzählerische Kern nur von ungefähr herausschält. Er spricht im
Ichton als Enkel von Vorfahren und plaudert als solcher mehr, als
daß er erzählt; sein Buch zeigt schon sehr viel Können, aber es könnte
mehr Organisationsgeist vertragen, denn so hübsch es ist als erste
Lektüre, es hat zu wenig von jener Bewußtheit in der Formung,
die als eigentliche Kunst doch allein den Leser immer wieder zwingt,
zurückzukehren und neu zu genießen. Dagegen ist es Georg Munk
wirklich um Kunst in der Dichtung zu tun: Er ist offensichtlich
jung und seine Sprache leidet aus dem Bestreben nach Originalität
und Kraft in der Sprache häufig an lyrisierendem Überschwang
und Gespreiztheit, so sehr er um epische Haltung kämpft. In
einer der Novellen, der „Farahild", passiert es ihm, daß er nach
einem fast klassisch geschriebenen Stück der Vorgeschichte im ent:
scheidenden Teil der Katastrophe vollkommen versagt und mit seinen
Worten keinen Wirklichkeitseindruck mehr erzwingt; manchmal ist
die Art, wie er die Geschichten ins Phantastische und Visionäre
hineinzieht, ein Ausweg, den er gereifter nicht mehr nehmen wird.
Aber aus vier Gründen ist dies Buch doch hoffnungsvoller als
das meiste, was seit Jahren neu gekommen ist und selbst die beiden
vorhergehenden Bücher: Um des Ernstes seines menschlichen
Strebens willen und die Fülle der rein menschlichen Konflikte,
die ihm schon heute aufgegangen scheinen; um der Reinheit seiner
Seele, die ihm den Zugang zum Märchenhaften und Sagenhaften
schenkt, und die Kraft seiner Phantasie, die ihn von da ins Reich
der großen Vision aufsteigen läßt; um der vollen Sinnlichkeit
willen, mit der er sich trotzdem wieder der Einzelheit aus dem
täglichen, sichtbaren Leben bemächtigt; und der Bewußtheit, mit
der er, sich immerwährend so echt künstlerischer Gesetze wie des
Parallelismus bedienend, um wirklich künstlerische, um bleibende
Gestaltung ringt. Alle drei sind begabt, von jedem bleibt viel zu
hoffen. Aber stille Erwartung dem, der in seinem ersten Buch eine
Geschichte von der seelischen und künstlerischen Schönheit einer
„Lomberda, die Hexe", eine Vision wie die vom Schluß der
„Farahild" hat. Joachim Benn.
ühnenbild und Schauspieler.
Aus der Mannheimer Darstellung der modernen Bühnen-
bildkunst und den überzeugten Worten von üi: Willy F. Storck
dazu (siehe Aprilheft d. I.) könnte man den Eindruck gewinnen,
daß unsere Bühne den Anschluß an die kunstgewerbliche wie geistige
Bewegung unserer Zeit gewonnen habe. Jeder Besuch eines
Theaters muß aber vom Gegenteil rasch und gründlich überzeugen,
wie es mir in diesen Tagen bei der Aufführung der Erosspiele von
Schmidtbonn in den Frankfurter Kammerspielen traurig deutlich
wurde. In allem dekorativen Wesen bis in die Kostüme ist die
Wandlung gegen früher unbestreitbar, aber leider kann gerade
auf der Bühne kein Schneider Leute machen; die Hauptsache wird
da trotz allem Wort und Geste des Schauspielers bleiben, und der
scheint sich gegen den Wechsel mit allem Instinkt seiner anders
gestellten Natur zu wehren.
Natürlich kann nicht auf jeder Bühne mit einer Düse oder
einem Kainz gerechnet werden, der Durchschnitt wird hier wie
überall den Eindruck bestimmen: aber gerade darin müßte die
Änderung doch nun endlich sichtbar sein. Es ist auch garnicht die
Begabung, sondern die Gesinnung, über die man klagen muß.
In den vier Schwänken „Der spielende Eros" von Schmidtbonn,
um bei der Veranlassung dieser Glosse zu bleiben, handelt es sich
in der Hauptsache um das selbe Thema: um die Gewalt der elemen-
taren Mächte gegen die Konvention. Da vermag der Schneider
wenig zu tun. Wenn der versuchte Diogenes sich sein Mädchen
gewinnen oder Helena im Bade dem Alten einen Anblick ihrer
Schönheit gönnen soll, ist jedesmal ein menschliches Ausmaß
nötig, an dem die Instinkte der Natur selbstverständlich werden;
die Bühne muß für einen Zuschauerraum voll Konvention einen
Ausblick in den elementaren Zustand von Handlungen öffnen,
die ihm aus seiner Welt nicht verständlich sind. Das vermag sie
nicht mit Schauspielern, die in dem gespreizten Kram ihrer Worte
und Gesten gewissermaßen nur eine Parodie der Konvention dar-
stellen. Wenn der Dichter hier etwas verlangen kann, und er ist
doch schließlich der einzige, dessen Ansprüche berechtigt sind, so ist
es dies, daß die Schauspieler Wesen seiner Welt werden. Dagegen
pflegen sie Gestalten des Publikums zu werden, die ihm die Dich-
tung in künstlich verlebendigten Rollen zutragen und gewisser-
maßen aus der Bühne einen Teil des Zuschauerraums machen.
Kein Wunder, daß nun das Publikum in seiner Welt die Dichtungen
als unpassend empfindet — ich rede nicht nur von den Schwänken
Schmidtbonns — und an dem Dichter gerade das auszusetzen hat,
was ihm das Wesentliche war.
Erstes Erfordernis der Bühne: der Vorhang muß bleiben,
auch wenn er hochgezogen ist, das Geheimnis einer andern Welt
muß sich auftun. Da vermag das Bühnenbild wenig oder nichts,
wenn mit dem Schauspieler das Publikum gewissermaßen darin
herumläuft, wenn der Schauspieler nicht ein Wesen dieses Bildes
wird. Auch für ihn muß die Bühne eine unüberschreitbare Grenze
zum Zuschauer ziehen, seine Augen müssen blind sein für den
Raum jenseits der Grenze.
Zweites Erfordernis: Der Schauspieler muß fähig sein, in
dieser andern Welt des Dichters zu leben, d. h. er darf in keinem
Fall eine Soubrette sein, was er heute fast immer ist.
Anwendung: Wenn ein Schauspieler den geilen Alten spielt,
der die schöne Helena im Bade belauschen will, so darf er nicht das
spielen, was diese Geilheit für das Publikum lächerlich macht,
sondern was ihr elementarer Grund, ihre Natur und ihr Schicksal
ist. Er ist nicht auf der Bühne, damit das Publikum über ihn lacht,
sondern damit er recht behält. Hamlet und Falstaff stehen nicht
aus der Moral des Publikums, sondern aus der Notwendigkeit
ihres Daseins in der Dichtung, also in der Welt Gottes, wo die
Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint. R. T.
§Kunenhäuser.
Selten habe ich ein Buch gelesen, das so dilettantisch und an-
regend zugleich war, wie diese Schrift von PH. Stauff.* Er gehört
zu den Enthusiasten, die für Guido von List, „den Wiederentdecker
des alten verlorenen Armanenweistums", schwärmen; auch hier ist
desseu Bildnis vorausgestellt, und man hat überall den Eindruck,
daß nur seine Gedankengänge Anwendung finden. Aber diese An-
wendung ist interessant genug, indem die Balkenfiguren unserer
alten Fachwerkhäuser als Runenzeichen erklärt werden. So über-
raschend den meisten diese Lehre kommen mag, so überzeugend wirkt
ein einfacher Vergleich der Runenzeichen mit den vielbekannten
Balkenfiguren. An zahlreichen Beispielen, die Stauff abbildet, wird
ohne weiteres deutlich, daß eine Anzahl gebräuchlicher Balkenstellun-
gen konstruktiv unuötig ist; daß sie immer nur Zierformen gewesen
seien, wie sie übernommen und heute noch angewendet werden,
dem widerspricht ziemlich alles, was wir von dem geheimnisvollen
Wesen der alten Bauhütten, von Zimmermannsüberlieferungen
wie auch von unserm Volkswesen überhaupt wissen.
Hat so die Lehre den Augenschein ohne weiteres für sich,
führt sie anderseits mit einer verblüffenden Geradheit in das
geheimnisvolle Dunkel der deutschen Göttersage. Daß gerade im
Germanentum die aufgenötigte christliche Heilslehre ein reiches
religiöses Leben, eine Weltanschauung von seltsamer Durchbildung
der Sinnbilder zerstört hat, wissen wir ja ebenso, wie wir die
Erinnerungen an unsere versunkene Götter- und Menschenwelt in
zahlreichen Gebräuchen und Sagen noch immer lebendig sehen.
Es ist wohl zu glauben, daß diese Erinnerungen sich vor einem
halben und ganzen Jahrtausend noch hartnäckiger als heute
wehrten, auch daß sie sich vor der gewaltsamen Unterdrückung durch
die christliche Gewalt geheimnisvoll versteckten. Wir brauchen nur
an die Feme zu denken, um die unheimliche Lebendigkeit einer
antichristlichen Unterwelt im Bewußtsein des deutschen Mittelalters
zu fühlen. Sind aber erst einmal Femzeichen im Gebälk nach-
weisbar, und das scheint unbestreitbar, dürfte kaum noch eine
Grundlage bleiben, andere Zeichen darin zu leugnen.
Es liegt eine wundervolle Vertiefung unseres Volksgefühls
in dem Gedanken, daß alle diese merkwürdigen Zierformen, mit
denen wir unsere Fachwerke geschmückt sehen, einmal etwas
anderes, etwas Bedeutungsvolleres und Heiligeres waren als
Schmuck, daß sich darin ein Rest von alter Geheimsprache gerettet,
hat. Selbst, wenn er vor der Wissenschaft nur als Sage bestände,
wäre die Sage schön, um wieviel mehr aber, wenn wie in jeder
Sage auch hier das Geheimnis eines versunkenen Daseinsgrundes
seine Sinnbilder überliefert hätte. S.
* Verlag K. G. Th. Scheffer, Berlin-Lichterfelde, 5 Mark.
Verantwortlich: Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düffeldorf. — Kunftdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Nh. erbeten.
Für unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.