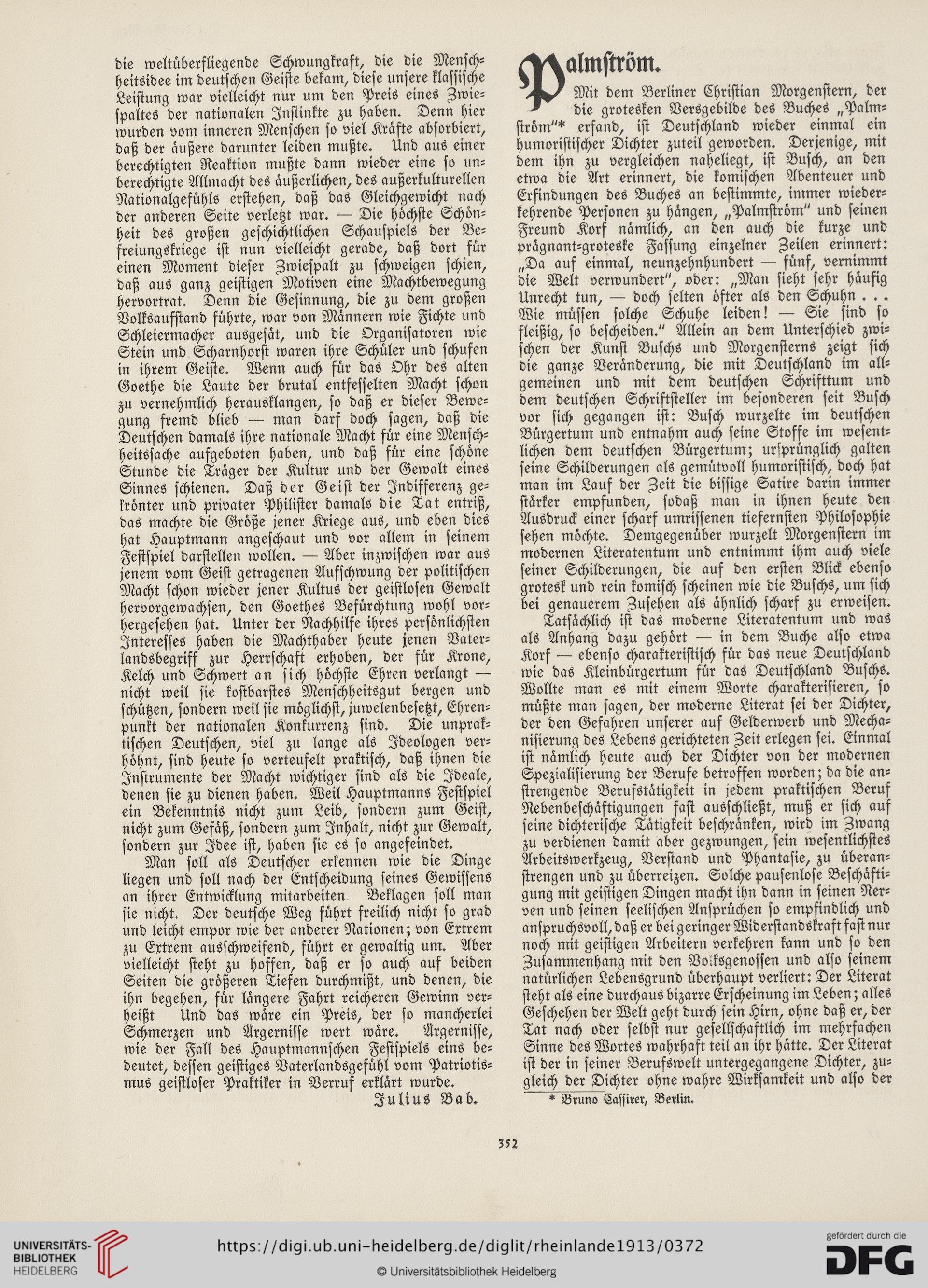die weltüberfliegende Schwungkraft, die die Mensch-
heitsidee im deutschen Geiste bekam, diese unsere klassische
Leistung war vielleicht nur um den Preis eines Zwie-
spaltes der nationalen Instinkte zu haben. Denn hier
wurden vom inneren Menschen so viel Kräfte absorbiert,
daß der äußere darunter leiden mußte. Und aus einer
berechtigten Reaktion mußte dann wieder eine so un-
berechtigte Allmacht des äußerlichen, des außerkulturellen
Nationalgefühls erstehen, daß das Gleichgewicht nach
der anderen Seite verletzt war. — Die höchste Schön-
heit des großen geschichtlichen Schauspiels der Be-
freiungskriege ist nun vielleicht gerade, daß dort für
einen Moment dieser Zwiespalt zu schweigen schien,
daß aus ganz geistigen Motiven eine Machtbewegung
hervortrat. Denn die Gesinnung, die zu dem großen
Volksaufstand führte, war von Männern wie Fichte und
Schleiermacher ausgesät, und die Organisatoren wie
Stein und Scharnhorst waren ihre Schüler und schufen
in ihrem Geiste. Wenn auch für das Ohr des alten
Goethe die Laute der brutal entfesselten Macht schon
zu vernehmlich herausklangen, so daß er dieser Bewe-
gung fremd blieb — man darf doch sagen, daß die
Deutschen damals ihre nationale Macht für eine Mensch-
heitssache aufgeboten haben, und daß für eine schöne
Stunde die Träger der Kultur und der Gewalt eines
Sinnes schienen. Daß der Geist der Indifferenz ge-
krönter und privater Philister damals die Tat entriß,
das machte die Größe jener Kriege aus, und eben dies
hat Hauptmann angeschaut und vor allem in seinem
Festspiel darstellen wollen. — Aber inzwischen war aus
jenem vom Geist getragenen Aufschwung der politischen
Macht schon wieder jener Kultus der geistlosen Gewalt
hervorgewachsen, den Goethes Befürchtung wohl vor-
hergesehen hat. Unter der Nachhilfe ihres persönlichsten
Interesses haben die Machthaber heute jenen Vater-
landsbegriff zur Herrschaft erhoben, der für Krone,
Kelch und Schwert an sich höchste Ehren verlangt —
nicht weil sie kostbarstes Menschheitsgut bergen und
schützen, sondern weil sie möglichst, juwelenbesetzt, Ehren-
punkt der nationalen Konkurrenz sind. Die unprak-
tischen Deutschen, viel zu lange als Ideologen ver-
höhnt, sind heute so verteufelt praktisch, daß ihnen die
Instrumente der Macht wichtiger sind als die Ideale,
denen sie zu dienen haben. Weil Hauptmanns Festspiel
ein Bekenntnis nicht zum Leib, sondern zum Geist,
nicht zum Gefäß, sondern zum Inhalt, nicht zur Gewalt,
sondern zur Idee ist, haben sie es so angefeindet.
Man soll als Deutscher erkennen wie die Dinge
liegen und soll nach der Entscheidung seines Gewissens
an ihrer Entwicklung mitarbeiten Beklagen soll man
sie nicht. Der deutsche Weg führt freilich nicht so grad
und leicht empor wie der anderer Nationen; von Ertrem
zu Ertrem ausschweifend, führt er gewaltig um. Aber
vielleicht steht zu hoffen, daß er so auch auf beiden
Seiten die größeren Tiefen durchmißt, und denen, die
ihn begehen, für längere Fahrt reicheren Gewinn ver-
heißt Und das wäre ein Preis, der so mancherlei
Schmerzen und Ärgernisse wert wäre. Ärgernisse,
wie der Fall des Hauptmannschen Festspiels eins be-
deutet, dessen geistiges Vaterlandsgefühl vom Patriotis-
mus geistloser Praktiker in Verruf erklärt wurde.
Julius Bab.
almström.
Mit dem Berliner Christian Morgenstern, der
die grotesken Versgebilde des Buches „Palm-
ström"* erfand, ist Deutschland wieder einmal ein
humoristischer Dichter zuteil geworden. Derjenige, mit
dem ihn zu vergleichen naheliegt, ist Busch, an den
etwa die Art erinnert, die komischen Abenteuer und
Erfindungen des Buches an bestimmte, immer wieder-
kehrende Personen zu hängen, „Palmström" und seinen
Freund Korf nämlich, an den auch die kurze und
prägnant-groteske Fassung einzelner Zeilen erinnert:
„Da auf einmal, neunzehnhundert — fünf, vernimmt
die Welt verwundert", oder: „Man sieht sehr häufig
Unrecht tun, — doch selten öfter als den Schuhn . ..
Wie müssen solche Schuhe leiden! — Sie sind so
fleißig, so bescheiden." Allein an dem Unterschied zwi-
schen der Kunst Buschs und Morgensterns zeigt sich
die ganze Veränderung, die mit Deutschland im all-
gemeinen und mit dem deutschen Schrifttum und
dem deutschen Schriftsteller im besonderen seit Busch
vor sich gegangen ist: Busch wurzelte im deutschen
Bürgertum und entnahm auch seine Stoffe im wesent-
lichen dem deutschen Bürgertum; ursprünglich galten
seine Schilderungen als gemütvoll humoristisch, doch hat
man im Lauf der Zeit die bissige Satire darin immer
stärker empfunden, sodaß man in ihnen heute den
Ausdruck einer scharf umrissenen tiefernsten Philosophie
sehen möchte. Demgegenüber wurzelt Morgenstern im
modernen Literatentum und entnimmt ihm auch viele
seiner Schilderungen, die auf den ersten Blick ebenso
grotesk und rein komisch scheinen wie die Buschs, um sich
bei genauerem Zusehen als ähnlich scharf zu erweisen.
Tatsächlich ist das moderne Literatentum und was
als Anhang dazu gehört — in dem Buche also etwa
Korf — ebenso charakteristisch für das neue Deutschland
wie das Kleinbürgertum für das Deutschland Buschs.
Wollte man es mit einem Worte charakterisieren, so
müßte man sagen, der moderne Literat sei der Dichter,
der den Gefahren unserer auf Gelderwerb und Mecha-
nisierung des Lebens gerichteten Zeit erlegen sei. Einmal
ist nämlich heute auch der Dichter von der modernen
Spezialisierung der Berufe betroffen worden; da die an-
strengende Berufstätigkeit in jedem praktischen Beruf
Nebenbeschäftigungen fast ausschließt, muß er sich auf
seine dichterische Tätigkeit beschränken, wird im Zwang
zu verdienen damit aber gezwungen, sein wesentlichstes
Arbeitswerkzeug, Verstand und Phantasie, zu überan-
strengen und zu überreizen. Solche pausenlose Beschäfti-
gung mit geistigen Dingen macht ihn dann in seinen Ner-
ven und seinen seelischen Ansprüchen so empfindlich und
anspruchsvoll, daß er bei geringer Widerstandskraft fast nur
noch mit geistigen Arbeitern verkehren kann und so den
Zusammenhang mit den Volksgenossen und also seinem
natürlichen Lebensgrund überhaupt verliert: Der Literat
steht als eine durchaus bizarre Erscheinung im Leben; alles
Geschehen der Welt geht durch sein Hirn, ohne daß er, der
Tat nach oder selbst nur gesellschaftlich im mehrfachen
Sinne des Wortes wahrhaft teil an ihr hätte. Der Literat
ist der in seiner Berufswelt untergegangene Dichter, zu-
gleich der Dichter ohne wahre Wirksamkeit und also der
* Bruno Cassirer, Berlin.
Z52
heitsidee im deutschen Geiste bekam, diese unsere klassische
Leistung war vielleicht nur um den Preis eines Zwie-
spaltes der nationalen Instinkte zu haben. Denn hier
wurden vom inneren Menschen so viel Kräfte absorbiert,
daß der äußere darunter leiden mußte. Und aus einer
berechtigten Reaktion mußte dann wieder eine so un-
berechtigte Allmacht des äußerlichen, des außerkulturellen
Nationalgefühls erstehen, daß das Gleichgewicht nach
der anderen Seite verletzt war. — Die höchste Schön-
heit des großen geschichtlichen Schauspiels der Be-
freiungskriege ist nun vielleicht gerade, daß dort für
einen Moment dieser Zwiespalt zu schweigen schien,
daß aus ganz geistigen Motiven eine Machtbewegung
hervortrat. Denn die Gesinnung, die zu dem großen
Volksaufstand führte, war von Männern wie Fichte und
Schleiermacher ausgesät, und die Organisatoren wie
Stein und Scharnhorst waren ihre Schüler und schufen
in ihrem Geiste. Wenn auch für das Ohr des alten
Goethe die Laute der brutal entfesselten Macht schon
zu vernehmlich herausklangen, so daß er dieser Bewe-
gung fremd blieb — man darf doch sagen, daß die
Deutschen damals ihre nationale Macht für eine Mensch-
heitssache aufgeboten haben, und daß für eine schöne
Stunde die Träger der Kultur und der Gewalt eines
Sinnes schienen. Daß der Geist der Indifferenz ge-
krönter und privater Philister damals die Tat entriß,
das machte die Größe jener Kriege aus, und eben dies
hat Hauptmann angeschaut und vor allem in seinem
Festspiel darstellen wollen. — Aber inzwischen war aus
jenem vom Geist getragenen Aufschwung der politischen
Macht schon wieder jener Kultus der geistlosen Gewalt
hervorgewachsen, den Goethes Befürchtung wohl vor-
hergesehen hat. Unter der Nachhilfe ihres persönlichsten
Interesses haben die Machthaber heute jenen Vater-
landsbegriff zur Herrschaft erhoben, der für Krone,
Kelch und Schwert an sich höchste Ehren verlangt —
nicht weil sie kostbarstes Menschheitsgut bergen und
schützen, sondern weil sie möglichst, juwelenbesetzt, Ehren-
punkt der nationalen Konkurrenz sind. Die unprak-
tischen Deutschen, viel zu lange als Ideologen ver-
höhnt, sind heute so verteufelt praktisch, daß ihnen die
Instrumente der Macht wichtiger sind als die Ideale,
denen sie zu dienen haben. Weil Hauptmanns Festspiel
ein Bekenntnis nicht zum Leib, sondern zum Geist,
nicht zum Gefäß, sondern zum Inhalt, nicht zur Gewalt,
sondern zur Idee ist, haben sie es so angefeindet.
Man soll als Deutscher erkennen wie die Dinge
liegen und soll nach der Entscheidung seines Gewissens
an ihrer Entwicklung mitarbeiten Beklagen soll man
sie nicht. Der deutsche Weg führt freilich nicht so grad
und leicht empor wie der anderer Nationen; von Ertrem
zu Ertrem ausschweifend, führt er gewaltig um. Aber
vielleicht steht zu hoffen, daß er so auch auf beiden
Seiten die größeren Tiefen durchmißt, und denen, die
ihn begehen, für längere Fahrt reicheren Gewinn ver-
heißt Und das wäre ein Preis, der so mancherlei
Schmerzen und Ärgernisse wert wäre. Ärgernisse,
wie der Fall des Hauptmannschen Festspiels eins be-
deutet, dessen geistiges Vaterlandsgefühl vom Patriotis-
mus geistloser Praktiker in Verruf erklärt wurde.
Julius Bab.
almström.
Mit dem Berliner Christian Morgenstern, der
die grotesken Versgebilde des Buches „Palm-
ström"* erfand, ist Deutschland wieder einmal ein
humoristischer Dichter zuteil geworden. Derjenige, mit
dem ihn zu vergleichen naheliegt, ist Busch, an den
etwa die Art erinnert, die komischen Abenteuer und
Erfindungen des Buches an bestimmte, immer wieder-
kehrende Personen zu hängen, „Palmström" und seinen
Freund Korf nämlich, an den auch die kurze und
prägnant-groteske Fassung einzelner Zeilen erinnert:
„Da auf einmal, neunzehnhundert — fünf, vernimmt
die Welt verwundert", oder: „Man sieht sehr häufig
Unrecht tun, — doch selten öfter als den Schuhn . ..
Wie müssen solche Schuhe leiden! — Sie sind so
fleißig, so bescheiden." Allein an dem Unterschied zwi-
schen der Kunst Buschs und Morgensterns zeigt sich
die ganze Veränderung, die mit Deutschland im all-
gemeinen und mit dem deutschen Schrifttum und
dem deutschen Schriftsteller im besonderen seit Busch
vor sich gegangen ist: Busch wurzelte im deutschen
Bürgertum und entnahm auch seine Stoffe im wesent-
lichen dem deutschen Bürgertum; ursprünglich galten
seine Schilderungen als gemütvoll humoristisch, doch hat
man im Lauf der Zeit die bissige Satire darin immer
stärker empfunden, sodaß man in ihnen heute den
Ausdruck einer scharf umrissenen tiefernsten Philosophie
sehen möchte. Demgegenüber wurzelt Morgenstern im
modernen Literatentum und entnimmt ihm auch viele
seiner Schilderungen, die auf den ersten Blick ebenso
grotesk und rein komisch scheinen wie die Buschs, um sich
bei genauerem Zusehen als ähnlich scharf zu erweisen.
Tatsächlich ist das moderne Literatentum und was
als Anhang dazu gehört — in dem Buche also etwa
Korf — ebenso charakteristisch für das neue Deutschland
wie das Kleinbürgertum für das Deutschland Buschs.
Wollte man es mit einem Worte charakterisieren, so
müßte man sagen, der moderne Literat sei der Dichter,
der den Gefahren unserer auf Gelderwerb und Mecha-
nisierung des Lebens gerichteten Zeit erlegen sei. Einmal
ist nämlich heute auch der Dichter von der modernen
Spezialisierung der Berufe betroffen worden; da die an-
strengende Berufstätigkeit in jedem praktischen Beruf
Nebenbeschäftigungen fast ausschließt, muß er sich auf
seine dichterische Tätigkeit beschränken, wird im Zwang
zu verdienen damit aber gezwungen, sein wesentlichstes
Arbeitswerkzeug, Verstand und Phantasie, zu überan-
strengen und zu überreizen. Solche pausenlose Beschäfti-
gung mit geistigen Dingen macht ihn dann in seinen Ner-
ven und seinen seelischen Ansprüchen so empfindlich und
anspruchsvoll, daß er bei geringer Widerstandskraft fast nur
noch mit geistigen Arbeitern verkehren kann und so den
Zusammenhang mit den Volksgenossen und also seinem
natürlichen Lebensgrund überhaupt verliert: Der Literat
steht als eine durchaus bizarre Erscheinung im Leben; alles
Geschehen der Welt geht durch sein Hirn, ohne daß er, der
Tat nach oder selbst nur gesellschaftlich im mehrfachen
Sinne des Wortes wahrhaft teil an ihr hätte. Der Literat
ist der in seiner Berufswelt untergegangene Dichter, zu-
gleich der Dichter ohne wahre Wirksamkeit und also der
* Bruno Cassirer, Berlin.
Z52